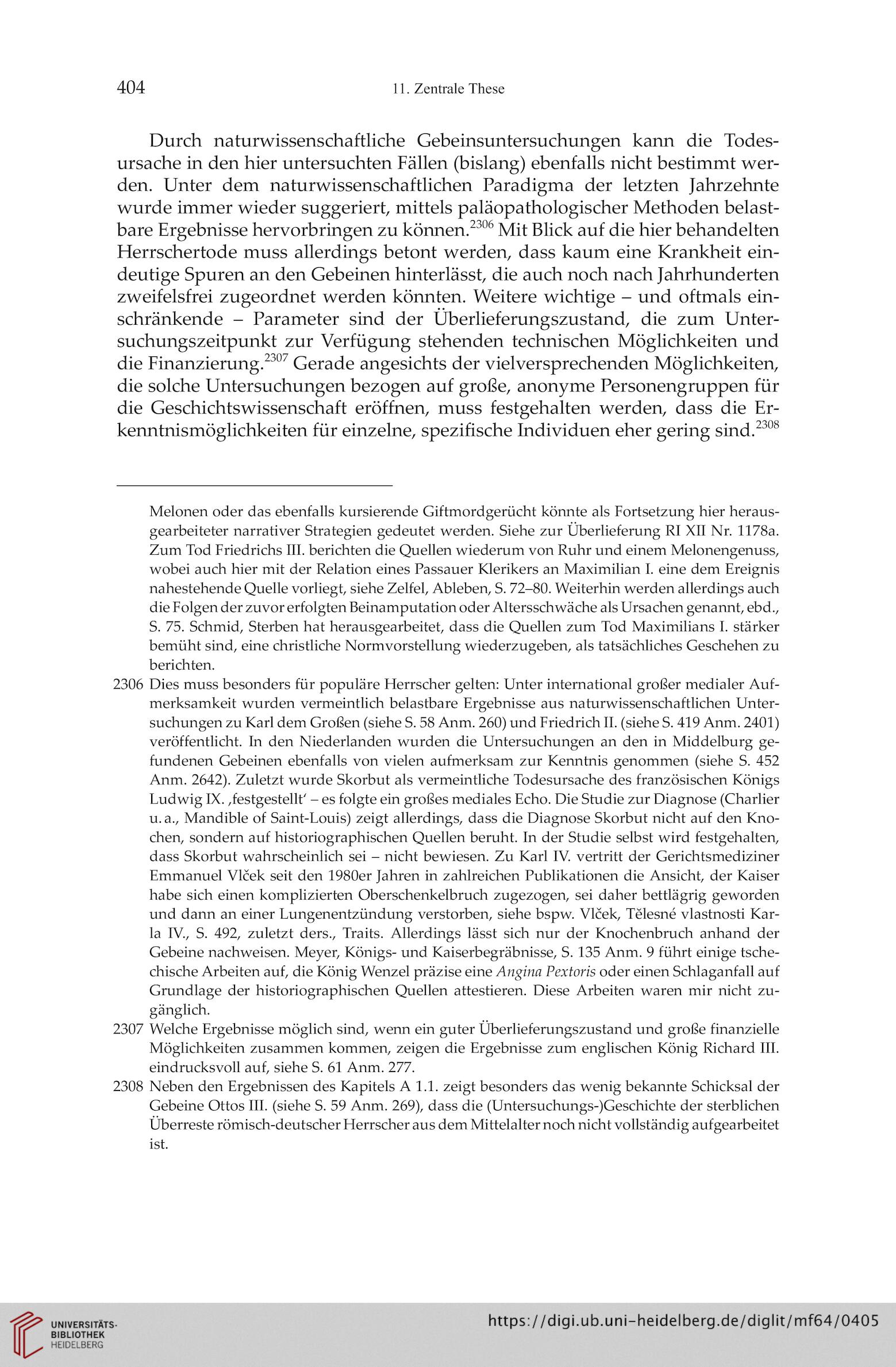404
11. Zentrale These
Durch naturwissenschaftliche Gebeinsuntersuchungen kann die Todes-
ursache in den hier untersuchten Fällen (bislang) ebenfalls nicht bestimmt wer-
den. Unter dem naturwissenschaftlichen Paradigma der letzten Jahrzehnte
wurde immer wieder suggeriert, mittels paläopathologischer Methoden belast-
bare Ergebnisse hervorbringen zu können.2306 Mit Blick auf die hier behandelten
Herrschertode muss allerdings betont werden, dass kaum eine Krankheit ein-
deutige Spuren an den Gebeinen hinterlässt, die auch noch nach Jahrhunderten
zweifelsfrei zugeordnet werden könnten. Weitere wichtige - und oftmals ein-
schränkende - Parameter sind der Uberlieferungszustand, die zum Unter-
suchungszeitpunkt zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten und
die Finanzierung.2307 Gerade angesichts der vielversprechenden Möglichkeiten,
die solche Untersuchungen bezogen auf große, anonyme Personengruppen für
die Geschichtswissenschaft eröffnen, muss festgehalten werden, dass die Er-
kenntnismöglichkeiten für einzelne, spezifische Individuen eher gering sind.2308
Melonen oder das ebenfalls kursierende Giftmordgerücht könnte als Fortsetzung hier heraus-
gearbeiteter narrativer Strategien gedeutet werden. Siehe zur Überlieferung RI XII Nr. 1178a.
Zum Tod Friedrichs III. berichten die Quellen wiederum von Ruhr und einem Melonengenuss,
wobei auch hier mit der Relation eines Passauer Klerikers an Maximilian I. eine dem Ereignis
nahestehende Quelle vorliegt, siehe Zelfel, Ableben, S. 72-80. Weiterhin werden allerdings auch
die Folgen der zuvor erfolgten Beinamputation oder Altersschwäche als Ursachen genannt, ebd.,
S. 75. Schmid, Sterben hat herausgearbeitet, dass die Quellen zum Tod Maximilians I. stärker
bemüht sind, eine christliche Normvorstellung wiederzugeben, als tatsächliches Geschehen zu
berichten.
2306 Dies muss besonders für populäre Herrscher gelten: Unter international großer medialer Auf-
merksamkeit wurden vermeintlich belastbare Ergebnisse aus naturwissenschaftlichen Unter-
suchungen zu Karl dem Großen (siehe S. 58 Anm. 260) und Friedrich II. (siehe S. 419 Anm. 2401)
veröffentlicht. In den Niederlanden wurden die Untersuchungen an den in Middelburg ge-
fundenen Gebeinen ebenfalls von vielen aufmerksam zur Kenntnis genommen (siehe S. 452
Anm. 2642). Zuletzt wurde Skorbut als vermeintliche Todesursache des französischen Königs
Ludwig IX.,festgestellt' - es folgte ein großes mediales Echo. Die Studie zur Diagnose (Charlier
u. a., Mandible of Saint-Louis) zeigt allerdings, dass die Diagnose Skorbut nicht auf den Kno-
chen, sondern auf historiographischen Quellen beruht. In der Studie selbst wird festgehalten,
dass Skorbut wahrscheinlich sei - nicht bewiesen. Zu Karl IV. vertritt der Gerichtsmediziner
Emmanuel Vlcek seit den 1980er Jahren in zahlreichen Publikationen die Ansicht, der Kaiser
habe sich einen komplizierten Oberschenkelbruch zugezogen, sei daher bettlägrig geworden
und dann an einer Lungenentzündung verstorben, siehe bspw. Vlcek, Telesne vlastnosti Kar-
la IV., S. 492, zuletzt ders., Traits. Allerdings lässt sich nur der Knochenbruch anhand der
Gebeine nachweisen. Meyer, Königs- und Kaiserbegräbnisse, S. 135 Anm. 9 führt einige tsche-
chische Arbeiten auf, die König Wenzel präzise eine Angina Pextoris oder einen Schlaganfall auf
Grundlage der historiographischen Quellen attestieren. Diese Arbeiten waren mir nicht zu-
gänglich.
2307 Welche Ergebnisse möglich sind, wenn ein guter Überlieferungszustand und große finanzielle
Möglichkeiten zusammen kommen, zeigen die Ergebnisse zum englischen König Richard III.
eindrucksvoll auf, siehe S. 61 Anm. 277.
2308 Neben den Ergebnissen des Kapitels A 1.1. zeigt besonders das wenig bekannte Schicksal der
Gebeine Ottos III. (siehe S. 59 Anm. 269), dass die (Untersuchungs-)Geschichte der sterblichen
Überreste römisch-deutscher Herrscher aus dem Mittelalter noch nicht vollständig aufgearbeitet
ist.
11. Zentrale These
Durch naturwissenschaftliche Gebeinsuntersuchungen kann die Todes-
ursache in den hier untersuchten Fällen (bislang) ebenfalls nicht bestimmt wer-
den. Unter dem naturwissenschaftlichen Paradigma der letzten Jahrzehnte
wurde immer wieder suggeriert, mittels paläopathologischer Methoden belast-
bare Ergebnisse hervorbringen zu können.2306 Mit Blick auf die hier behandelten
Herrschertode muss allerdings betont werden, dass kaum eine Krankheit ein-
deutige Spuren an den Gebeinen hinterlässt, die auch noch nach Jahrhunderten
zweifelsfrei zugeordnet werden könnten. Weitere wichtige - und oftmals ein-
schränkende - Parameter sind der Uberlieferungszustand, die zum Unter-
suchungszeitpunkt zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten und
die Finanzierung.2307 Gerade angesichts der vielversprechenden Möglichkeiten,
die solche Untersuchungen bezogen auf große, anonyme Personengruppen für
die Geschichtswissenschaft eröffnen, muss festgehalten werden, dass die Er-
kenntnismöglichkeiten für einzelne, spezifische Individuen eher gering sind.2308
Melonen oder das ebenfalls kursierende Giftmordgerücht könnte als Fortsetzung hier heraus-
gearbeiteter narrativer Strategien gedeutet werden. Siehe zur Überlieferung RI XII Nr. 1178a.
Zum Tod Friedrichs III. berichten die Quellen wiederum von Ruhr und einem Melonengenuss,
wobei auch hier mit der Relation eines Passauer Klerikers an Maximilian I. eine dem Ereignis
nahestehende Quelle vorliegt, siehe Zelfel, Ableben, S. 72-80. Weiterhin werden allerdings auch
die Folgen der zuvor erfolgten Beinamputation oder Altersschwäche als Ursachen genannt, ebd.,
S. 75. Schmid, Sterben hat herausgearbeitet, dass die Quellen zum Tod Maximilians I. stärker
bemüht sind, eine christliche Normvorstellung wiederzugeben, als tatsächliches Geschehen zu
berichten.
2306 Dies muss besonders für populäre Herrscher gelten: Unter international großer medialer Auf-
merksamkeit wurden vermeintlich belastbare Ergebnisse aus naturwissenschaftlichen Unter-
suchungen zu Karl dem Großen (siehe S. 58 Anm. 260) und Friedrich II. (siehe S. 419 Anm. 2401)
veröffentlicht. In den Niederlanden wurden die Untersuchungen an den in Middelburg ge-
fundenen Gebeinen ebenfalls von vielen aufmerksam zur Kenntnis genommen (siehe S. 452
Anm. 2642). Zuletzt wurde Skorbut als vermeintliche Todesursache des französischen Königs
Ludwig IX.,festgestellt' - es folgte ein großes mediales Echo. Die Studie zur Diagnose (Charlier
u. a., Mandible of Saint-Louis) zeigt allerdings, dass die Diagnose Skorbut nicht auf den Kno-
chen, sondern auf historiographischen Quellen beruht. In der Studie selbst wird festgehalten,
dass Skorbut wahrscheinlich sei - nicht bewiesen. Zu Karl IV. vertritt der Gerichtsmediziner
Emmanuel Vlcek seit den 1980er Jahren in zahlreichen Publikationen die Ansicht, der Kaiser
habe sich einen komplizierten Oberschenkelbruch zugezogen, sei daher bettlägrig geworden
und dann an einer Lungenentzündung verstorben, siehe bspw. Vlcek, Telesne vlastnosti Kar-
la IV., S. 492, zuletzt ders., Traits. Allerdings lässt sich nur der Knochenbruch anhand der
Gebeine nachweisen. Meyer, Königs- und Kaiserbegräbnisse, S. 135 Anm. 9 führt einige tsche-
chische Arbeiten auf, die König Wenzel präzise eine Angina Pextoris oder einen Schlaganfall auf
Grundlage der historiographischen Quellen attestieren. Diese Arbeiten waren mir nicht zu-
gänglich.
2307 Welche Ergebnisse möglich sind, wenn ein guter Überlieferungszustand und große finanzielle
Möglichkeiten zusammen kommen, zeigen die Ergebnisse zum englischen König Richard III.
eindrucksvoll auf, siehe S. 61 Anm. 277.
2308 Neben den Ergebnissen des Kapitels A 1.1. zeigt besonders das wenig bekannte Schicksal der
Gebeine Ottos III. (siehe S. 59 Anm. 269), dass die (Untersuchungs-)Geschichte der sterblichen
Überreste römisch-deutscher Herrscher aus dem Mittelalter noch nicht vollständig aufgearbeitet
ist.