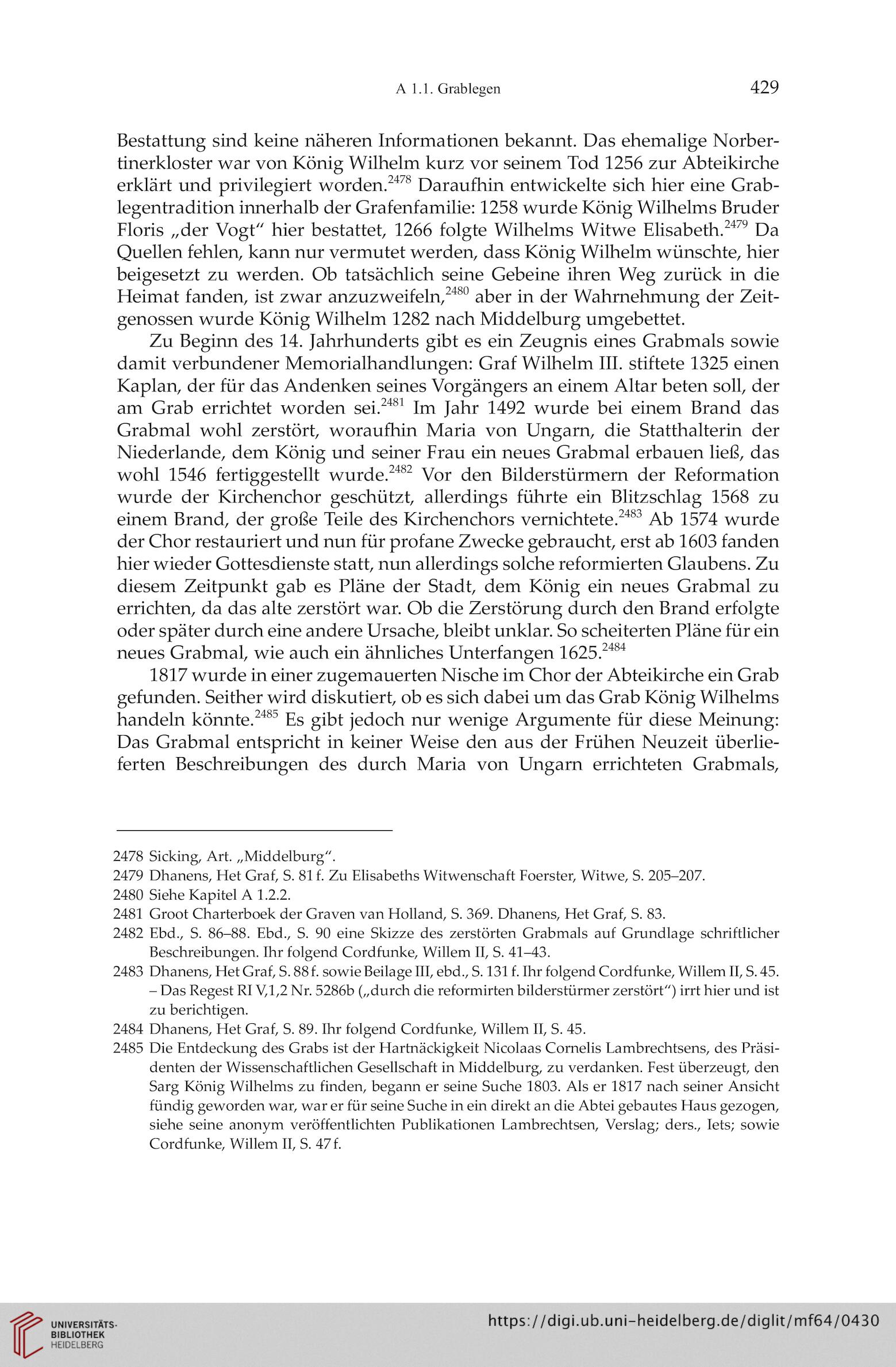A 1.1. Grablegen
429
Bestattung sind keine näheren Informationen bekannt. Das ehemalige Norber-
tinerkloster war von König Wilhelm kurz vor seinem Tod 1256 zur Abteikirche
erklärt und privilegiert worden.2478 Daraufhin entwickelte sich hier eine Grab-
legentradition innerhalb der Grafenfamilie: 1258 wurde König Wilhelms Bruder
Floris „der Vogt" hier bestattet, 1266 folgte Wilhelms Witwe Elisabeth.2479 Da
Quellen fehlen, kann nur vermutet werden, dass König Wilhelm wünschte, hier
beigesetzt zu werden. Ob tatsächlich seine Gebeine ihren Weg zurück in die
Heimat fanden, ist zwar anzuzweifeln,2480 aber in der Wahrnehmung der Zeit-
genossen wurde König Wilhelm 1282 nach Middelburg umgebettet.
Zu Beginn des 14. Jahrhunderts gibt es ein Zeugnis eines Grabmals sowie
damit verbundener Memorialhandlungen: Graf Wilhelm III. stiftete 1325 einen
Kaplan, der für das Andenken seines Vorgängers an einem Altar beten soll, der
am Grab errichtet worden sei.2481 Im Jahr 1492 wurde bei einem Brand das
Grabmal wohl zerstört, woraufhin Maria von Ungarn, die Statthalterin der
Niederlande, dem König und seiner Frau ein neues Grabmal erbauen ließ, das
wohl 1546 fertiggestellt wurde.2482 Vor den Bilderstürmern der Reformation
wurde der Kirchenchor geschützt, allerdings führte ein Blitzschlag 1568 zu
einem Brand, der große Teile des Kirchenchors vernichtete.2483 Ab 1574 wurde
der Chor restauriert und nun für profane Zwecke gebraucht, erst ab 1603 fanden
hier wieder Gottesdienste statt, mm allerdings solche reformierten Glaubens. Zu
diesem Zeitpunkt gab es Pläne der Stadt, dem König ein neues Grabmal zu
errichten, da das alte zerstört war. Ob die Zerstörung durch den Brand erfolgte
oder später durch eine andere Ursache, bleibt unklar. So scheiterten Pläne für ein
neues Grabmal, wie auch ein ähnliches Unterfangen 1625.2484
1817 wurde in einer zugemauerten Nische im Chor der Abteikirche ein Grab
gefunden. Seither wird diskutiert, ob es sich dabei um das Grab König Wilhelms
handeln könnte.2485 Es gibt jedoch nur wenige Argumente für diese Meinung:
Das Grabmal entspricht in keiner Weise den aus der Frühen Neuzeit überlie-
ferten Beschreibungen des durch Maria von Ungarn errichteten Grabmals,
2478 Sicking, Art. „Middelburg".
2479 Dhanens, Het Graf, S. 81 f. Zu Elisabeths Witwenschaft Foerster, Witwe, S. 205-207.
2480 Siehe Kapitel A 1.2.2.
2481 Groot Charterboek der Graven van Holland, S. 369. Dhanens, Het Graf, S. 83.
2482 Ebd., S. 86-88. Ebd., S. 90 eine Skizze des zerstörten Grabmals auf Grundlage schriftlicher
Beschreibungen. Ihr folgend Cordfunke, Willem II, S. 41-43.
2483 Dhanens, Het Graf, S. 88 f. sowie Beilage III, ebd., S. 131 f. Ihr folgend Cordfunke, Willem II, S. 45.
- Das Regest RI V,l,2 Nr. 5286b („durch die reformirten bilderstürmer zerstört") irrt hier und ist
zu berichtigen.
2484 Dhanens, Het Graf, S. 89. Ihr folgend Cordfunke, Willem II, S. 45.
2485 Die Entdeckung des Grabs ist der Hartnäckigkeit Nicolaas Cornelis Lambrechtsens, des Präsi-
denten der Wissenschaftlichen Gesellschaft in Middelburg, zu verdanken. Fest überzeugt, den
Sarg König Wilhelms zu finden, begann er seine Suche 1803. Als er 1817 nach seiner Ansicht
fündig geworden war, war er für seine Suche in ein direkt an die Abtei gebautes Haus gezogen,
siehe seine anonym veröffentlichten Publikationen Lambrechtsen, Verslag; ders., lets; sowie
Cordfunke, Willem II, S. 47 f.
429
Bestattung sind keine näheren Informationen bekannt. Das ehemalige Norber-
tinerkloster war von König Wilhelm kurz vor seinem Tod 1256 zur Abteikirche
erklärt und privilegiert worden.2478 Daraufhin entwickelte sich hier eine Grab-
legentradition innerhalb der Grafenfamilie: 1258 wurde König Wilhelms Bruder
Floris „der Vogt" hier bestattet, 1266 folgte Wilhelms Witwe Elisabeth.2479 Da
Quellen fehlen, kann nur vermutet werden, dass König Wilhelm wünschte, hier
beigesetzt zu werden. Ob tatsächlich seine Gebeine ihren Weg zurück in die
Heimat fanden, ist zwar anzuzweifeln,2480 aber in der Wahrnehmung der Zeit-
genossen wurde König Wilhelm 1282 nach Middelburg umgebettet.
Zu Beginn des 14. Jahrhunderts gibt es ein Zeugnis eines Grabmals sowie
damit verbundener Memorialhandlungen: Graf Wilhelm III. stiftete 1325 einen
Kaplan, der für das Andenken seines Vorgängers an einem Altar beten soll, der
am Grab errichtet worden sei.2481 Im Jahr 1492 wurde bei einem Brand das
Grabmal wohl zerstört, woraufhin Maria von Ungarn, die Statthalterin der
Niederlande, dem König und seiner Frau ein neues Grabmal erbauen ließ, das
wohl 1546 fertiggestellt wurde.2482 Vor den Bilderstürmern der Reformation
wurde der Kirchenchor geschützt, allerdings führte ein Blitzschlag 1568 zu
einem Brand, der große Teile des Kirchenchors vernichtete.2483 Ab 1574 wurde
der Chor restauriert und nun für profane Zwecke gebraucht, erst ab 1603 fanden
hier wieder Gottesdienste statt, mm allerdings solche reformierten Glaubens. Zu
diesem Zeitpunkt gab es Pläne der Stadt, dem König ein neues Grabmal zu
errichten, da das alte zerstört war. Ob die Zerstörung durch den Brand erfolgte
oder später durch eine andere Ursache, bleibt unklar. So scheiterten Pläne für ein
neues Grabmal, wie auch ein ähnliches Unterfangen 1625.2484
1817 wurde in einer zugemauerten Nische im Chor der Abteikirche ein Grab
gefunden. Seither wird diskutiert, ob es sich dabei um das Grab König Wilhelms
handeln könnte.2485 Es gibt jedoch nur wenige Argumente für diese Meinung:
Das Grabmal entspricht in keiner Weise den aus der Frühen Neuzeit überlie-
ferten Beschreibungen des durch Maria von Ungarn errichteten Grabmals,
2478 Sicking, Art. „Middelburg".
2479 Dhanens, Het Graf, S. 81 f. Zu Elisabeths Witwenschaft Foerster, Witwe, S. 205-207.
2480 Siehe Kapitel A 1.2.2.
2481 Groot Charterboek der Graven van Holland, S. 369. Dhanens, Het Graf, S. 83.
2482 Ebd., S. 86-88. Ebd., S. 90 eine Skizze des zerstörten Grabmals auf Grundlage schriftlicher
Beschreibungen. Ihr folgend Cordfunke, Willem II, S. 41-43.
2483 Dhanens, Het Graf, S. 88 f. sowie Beilage III, ebd., S. 131 f. Ihr folgend Cordfunke, Willem II, S. 45.
- Das Regest RI V,l,2 Nr. 5286b („durch die reformirten bilderstürmer zerstört") irrt hier und ist
zu berichtigen.
2484 Dhanens, Het Graf, S. 89. Ihr folgend Cordfunke, Willem II, S. 45.
2485 Die Entdeckung des Grabs ist der Hartnäckigkeit Nicolaas Cornelis Lambrechtsens, des Präsi-
denten der Wissenschaftlichen Gesellschaft in Middelburg, zu verdanken. Fest überzeugt, den
Sarg König Wilhelms zu finden, begann er seine Suche 1803. Als er 1817 nach seiner Ansicht
fündig geworden war, war er für seine Suche in ein direkt an die Abtei gebautes Haus gezogen,
siehe seine anonym veröffentlichten Publikationen Lambrechtsen, Verslag; ders., lets; sowie
Cordfunke, Willem II, S. 47 f.