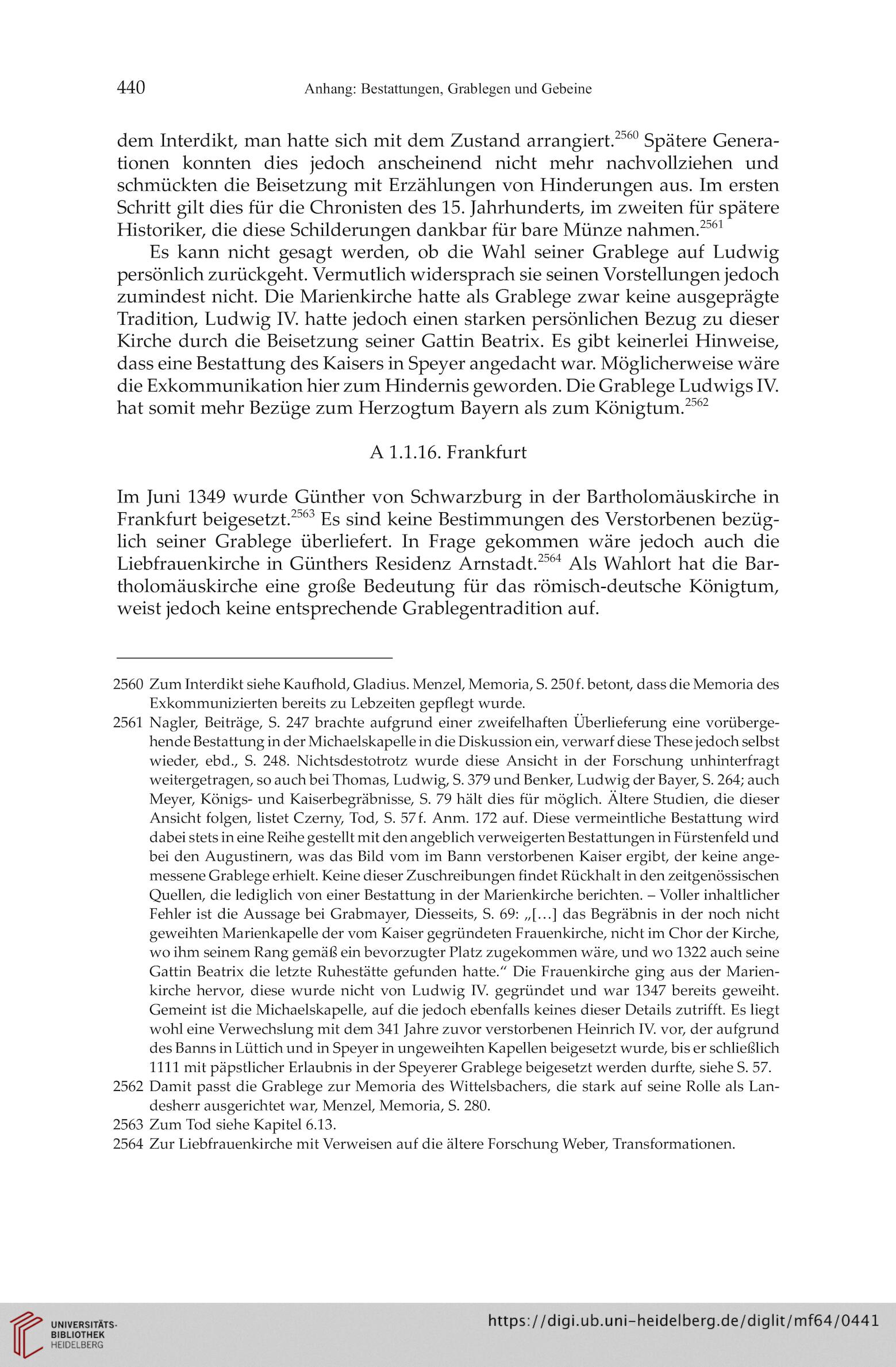440
Anhang: Bestattungen, Grablegen und Gebeine
dem Interdikt, man hatte sich mit dem Zustand arrangiert.2560 Spätere Genera-
tionen konnten dies jedoch anscheinend nicht mehr nachvollziehen und
schmückten die Beisetzung mit Erzählungen von Hinderungen aus. Im ersten
Schritt gilt dies für die Chronisten des 15. Jahrhunderts, im zweiten für spätere
Historiker, die diese Schilderungen dankbar für bare Münze nahmen.2561
Es kann nicht gesagt werden, ob die Wahl seiner Grablege auf Ludwig
persönlich zurückgeht. Vermutlich widersprach sie seinen Vorstellungen jedoch
zumindest nicht. Die Marienkirche hatte als Grablege zwar keine ausgeprägte
Tradition, Ludwig IV. hatte jedoch einen starken persönlichen Bezug zu dieser
Kirche durch die Beisetzung seiner Gattin Beatrix. Es gibt keinerlei Hinweise,
dass eine Bestattung des Kaisers in Speyer angedacht war. Möglicherweise wäre
die Exkommunikation hier zum Hindernis geworden. Die Grablege Ludwigs IV.
hat somit mehr Bezüge zum Herzogtum Bayern als zum Königtum.2562
A 1.1.16. Frankfurt
Im Juni 1349 wurde Günther von Schwarzburg in der Bartholomäuskirche in
Frankfurt beigesetzt.2563 Es sind keine Bestimmungen des Verstorbenen bezüg-
lich seiner Grablege überliefert. In Frage gekommen wäre jedoch auch die
Liebfrauenkirche in Günthers Residenz Arnstadt.2564 Als Wahlort hat die Bar-
tholomäuskirche eine große Bedeutung für das römisch-deutsche Königtum,
weist jedoch keine entsprechende Grablegentradition auf.
2560 Zum Interdikt siehe Kaufhold, Gladius. Menzel, Memoria, S. 250f. betont, dass die Memoria des
Exkommunizierten bereits zu Lebzeiten gepflegt wurde.
2561 Nagler, Beiträge, S. 247 brachte aufgrund einer zweifelhaften Überlieferung eine vorüberge-
hende Bestattung in der Michaelskapelle in die Diskussion ein, verwarf diese These jedoch selbst
wieder, ebd., S. 248. Nichtsdestotrotz wurde diese Ansicht in der Forschung unhinterfragt
weitergetragen, so auch bei Thomas, Ludwig, S. 379 und Benker, Ludwig der Bayer, S. 264; auch
Meyer, Königs- und Kaiserbegräbnisse, S. 79 hält dies für möglich. Ältere Studien, die dieser
Ansicht folgen, listet Czerny, Tod, S. 57 f. Anm. 172 auf. Diese vermeintliche Bestattung wird
dabei stets in eine Reihe gestellt mit den angeblich verweigerten Bestattungen in Fürstenfeld und
bei den Augustinern, was das Bild vom im Bann verstorbenen Kaiser ergibt, der keine ange-
messene Grablege erhielt. Keine dieser Zuschreibungen findet Rückhalt in den zeitgenössischen
Quellen, die lediglich von einer Bestattung in der Marienkirche berichten. - Voller inhaltlicher
Fehler ist die Aussage bei Grabmayer, Diesseits, S. 69: „[...] das Begräbnis in der noch nicht
geweihten Marienkapelle der vom Kaiser gegründeten Frauenkirche, nicht im Chor der Kirche,
wo ihm seinem Rang gemäß ein bevorzugter Platz zugekommen wäre, und wo 1322 auch seine
Gattin Beatrix die letzte Ruhestätte gefunden hatte." Die Frauenkirche ging aus der Marien-
kirche hervor, diese wurde nicht von Ludwig IV. gegründet und war 1347 bereits geweiht.
Gemeint ist die Michaelskapelle, auf die jedoch ebenfalls keines dieser Details zutrifft. Es liegt
wohl eine Verwechslung mit dem 341 Jahre zuvor verstorbenen Heinrich IV. vor, der aufgrund
des Banns in Lüttich und in Speyer in ungeweihten Kapellen beigesetzt wurde, bis er schließlich
1111 mit päpstlicher Erlaubnis in der Speyerer Grablege beigesetzt werden durfte, siehe S. 57.
2562 Damit passt die Grablege zur Memoria des Wittelsbachers, die stark auf seine Rolle als Lan-
desherr ausgerichtet war, Menzel, Memoria, S. 280.
2563 Zum Tod siehe Kapitel 6.13.
2564 Zur Liebfrauenkirche mit Verweisen auf die ältere Forschung Weber, Transformationen.
Anhang: Bestattungen, Grablegen und Gebeine
dem Interdikt, man hatte sich mit dem Zustand arrangiert.2560 Spätere Genera-
tionen konnten dies jedoch anscheinend nicht mehr nachvollziehen und
schmückten die Beisetzung mit Erzählungen von Hinderungen aus. Im ersten
Schritt gilt dies für die Chronisten des 15. Jahrhunderts, im zweiten für spätere
Historiker, die diese Schilderungen dankbar für bare Münze nahmen.2561
Es kann nicht gesagt werden, ob die Wahl seiner Grablege auf Ludwig
persönlich zurückgeht. Vermutlich widersprach sie seinen Vorstellungen jedoch
zumindest nicht. Die Marienkirche hatte als Grablege zwar keine ausgeprägte
Tradition, Ludwig IV. hatte jedoch einen starken persönlichen Bezug zu dieser
Kirche durch die Beisetzung seiner Gattin Beatrix. Es gibt keinerlei Hinweise,
dass eine Bestattung des Kaisers in Speyer angedacht war. Möglicherweise wäre
die Exkommunikation hier zum Hindernis geworden. Die Grablege Ludwigs IV.
hat somit mehr Bezüge zum Herzogtum Bayern als zum Königtum.2562
A 1.1.16. Frankfurt
Im Juni 1349 wurde Günther von Schwarzburg in der Bartholomäuskirche in
Frankfurt beigesetzt.2563 Es sind keine Bestimmungen des Verstorbenen bezüg-
lich seiner Grablege überliefert. In Frage gekommen wäre jedoch auch die
Liebfrauenkirche in Günthers Residenz Arnstadt.2564 Als Wahlort hat die Bar-
tholomäuskirche eine große Bedeutung für das römisch-deutsche Königtum,
weist jedoch keine entsprechende Grablegentradition auf.
2560 Zum Interdikt siehe Kaufhold, Gladius. Menzel, Memoria, S. 250f. betont, dass die Memoria des
Exkommunizierten bereits zu Lebzeiten gepflegt wurde.
2561 Nagler, Beiträge, S. 247 brachte aufgrund einer zweifelhaften Überlieferung eine vorüberge-
hende Bestattung in der Michaelskapelle in die Diskussion ein, verwarf diese These jedoch selbst
wieder, ebd., S. 248. Nichtsdestotrotz wurde diese Ansicht in der Forschung unhinterfragt
weitergetragen, so auch bei Thomas, Ludwig, S. 379 und Benker, Ludwig der Bayer, S. 264; auch
Meyer, Königs- und Kaiserbegräbnisse, S. 79 hält dies für möglich. Ältere Studien, die dieser
Ansicht folgen, listet Czerny, Tod, S. 57 f. Anm. 172 auf. Diese vermeintliche Bestattung wird
dabei stets in eine Reihe gestellt mit den angeblich verweigerten Bestattungen in Fürstenfeld und
bei den Augustinern, was das Bild vom im Bann verstorbenen Kaiser ergibt, der keine ange-
messene Grablege erhielt. Keine dieser Zuschreibungen findet Rückhalt in den zeitgenössischen
Quellen, die lediglich von einer Bestattung in der Marienkirche berichten. - Voller inhaltlicher
Fehler ist die Aussage bei Grabmayer, Diesseits, S. 69: „[...] das Begräbnis in der noch nicht
geweihten Marienkapelle der vom Kaiser gegründeten Frauenkirche, nicht im Chor der Kirche,
wo ihm seinem Rang gemäß ein bevorzugter Platz zugekommen wäre, und wo 1322 auch seine
Gattin Beatrix die letzte Ruhestätte gefunden hatte." Die Frauenkirche ging aus der Marien-
kirche hervor, diese wurde nicht von Ludwig IV. gegründet und war 1347 bereits geweiht.
Gemeint ist die Michaelskapelle, auf die jedoch ebenfalls keines dieser Details zutrifft. Es liegt
wohl eine Verwechslung mit dem 341 Jahre zuvor verstorbenen Heinrich IV. vor, der aufgrund
des Banns in Lüttich und in Speyer in ungeweihten Kapellen beigesetzt wurde, bis er schließlich
1111 mit päpstlicher Erlaubnis in der Speyerer Grablege beigesetzt werden durfte, siehe S. 57.
2562 Damit passt die Grablege zur Memoria des Wittelsbachers, die stark auf seine Rolle als Lan-
desherr ausgerichtet war, Menzel, Memoria, S. 280.
2563 Zum Tod siehe Kapitel 6.13.
2564 Zur Liebfrauenkirche mit Verweisen auf die ältere Forschung Weber, Transformationen.