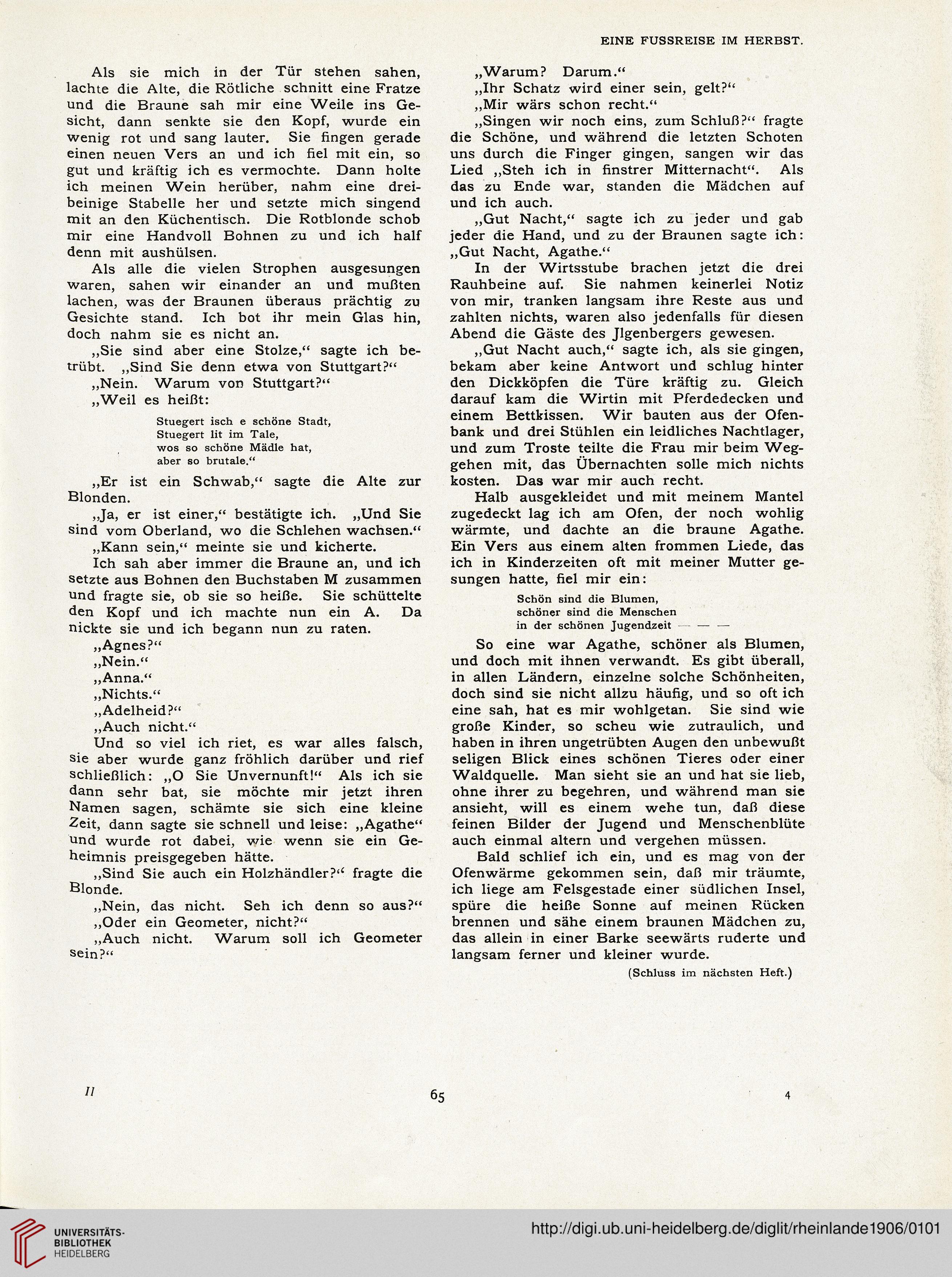EINE FUSSREISE IM HERBST.
Als sie mich in der Tür stehen sahen,
lachte die Alte, die Rötliche schnitt eine Fratze
und die Braune sah mir eine Weile ins Ge-
sicht, dann senkte sie den Kopf, wurde ein
wenig rot und sang lauter. Sie fingen gerade
einen neuen Vers an und ich fiel mit ein, so
gut und kräftig ich es vermochte. Dann holte
ich meinen Wein herüber, nahm eine drei-
beinige Stabelle her und setzte mich singend
mit an den Küchentisch. Die Rotblonde schob
mir eine Handvoll Bohnen zu und ich half
denn mit aushülsen.
Als alle die vielen Strophen ausgesungen
waren, sahen wir einander an und mußten
lachen, was der Braunen überaus prächtig zu
Gesichte stand. Ich bot ihr mein Glas hin,
doch nahm sie es nicht an.
„Sie sind aber eine Stolze,“ sagte ich be-
trübt. „Sind Sie denn etwa von Stuttgart?“
„Nein. Warum von Stuttgart?“
„Weil es heißt:
Stuegert isch e schöne Stadt,
Stuegert lit im Tale,
wos so schöne Madie hat,
aber so brutale/*
„Er ist ein Schwab,“ sagte die Alte zur
Blonden.
„Ja, er ist einer,“ bestätigte ich. „Und Sie
sind vom Oberland, wo die Schlehen wachsen.“
„Kann sein,“ meinte sie und kicherte.
Ich sah aber immer die Braune an, und ich
setzte aus Bohnen den Buchstaben M zusammen
und fragte sie, ob sie so heiße. Sie schüttelte
den Kopf und ich machte nun ein A. Da
nickte sie und ich begann nun zu raten.
„Agnes?“
„Nein.“
„Anna.“
„Nichts.“
„Adelheid?“
„Auch nicht.“
Und so viel ich riet, es war alles falsch,
sie aber wurde ganz fröhlich darüber und rief
schließlich: „O Sie Unvernunft!“ Als ich sie
dann sehr bat, sie möchte mir jetzt ihren
Namen sagen, schämte sie sich eine kleine
Zeit, dann sagte sie schnell und leise: „Agathe“
und wurde rot dabei, wie wenn sie ein Ge-
heimnis preisgegeben hätte.
„Sind Sie auch ein Holzhändler?“ fragte die
Blonde.
„Nein, das nicht. Seh ich denn so aus?“
„Oder ein Geometer, nicht?“
„Auch nicht. Warum soll ich Geometer
sein?“
„Warum? Darum.“
„Ihr Schatz wird einer sein, gelt?“
„Mir wärs schon recht.“
„Singen wir noch eins, zum Schluß?“ fragte
die Schöne, und während die letzten Schoten
uns durch die Finger gingen, sangen wir das
Lied „Steh ich in finstrer Mitternacht“. Als
das zu Ende war, standen die Mädchen auf
und ich auch.
„Gut Nacht,“ sagte ich zu jeder und gab
jeder die Hand, und zu der Braunen sagte ich:
„Gut Nacht, Agathe.“
In der Wirtsstube brachen jetzt die drei
Rauhbeine auf. Sie nahmen keinerlei Notiz
von mir, tranken langsam ihre Reste aus und
zahlten nichts, waren also jedenfalls für diesen
Abend die Gäste des Jlgenbergers gewesen.
„Gut Nacht auch,“ sagte ich, als sie gingen,
bekam aber keine Antwort und schlug hinter
den Dickköpfen die Türe kräftig zu. Gleich
darauf kam die Wirtin mit Pferdedecken und
einem Bettkissen. Wir bauten aus der Ofen-
bank und drei Stühlen ein leidliches Nachtlager,
und zum Tröste teilte die Frau mir beim Weg-
gehen mit, das Übernachten solle mich nichts
kosten. Das war mir auch recht.
Halb ausgekleidet und mit meinem Mantel
zugedeckt lag ich am Ofen, der noch wohlig
wärmte, und dachte an die braune Agathe.
Ein Vers aus einem alten frommen Liede, das
ich in Kinderzeiten oft mit meiner Mutter ge-
sungen hatte, fiel mir ein:
Schön sind die Blumen,
schöner sind die Menschen
in der schönen Jugendzeit — —
So eine war Agathe, schöner als Blumen,
und doch mit ihnen verwandt. Es gibt überall,
in allen Ländern, einzelne solche Schönheiten,
doch sind sie nicht allzu häufig, und so oft ich
eine sah, hat es mir wohlgetan. Sie sind wie
große Kinder, so scheu wie zutraulich, und
haben in ihren ungetrübten Augen den unbewußt
seligen Blick eines schönen Tieres oder einer
Waldquelle. Man sieht sie an und hat sie lieb,
ohne ihrer zu begehren, und während man sie
ansieht, will es einem wehe tun, daß diese
feinen Bilder der Jugend und Menschenblüte
auch einmal altern und vergehen müssen.
Bald schlief ich ein, und es mag von der
Ofenwärme gekommen sein, daß mir träumte,
ich liege am Felsgestade einer südlichen Insel,
spüre die heiße Sonne auf meinen Rücken
brennen und sähe einem braunen Mädchen zu,
das allein in einer Barke seewärts ruderte und
langsam ferner und kleiner wurde.
(Schluss im nächsten Heft.)
II
65
4
Als sie mich in der Tür stehen sahen,
lachte die Alte, die Rötliche schnitt eine Fratze
und die Braune sah mir eine Weile ins Ge-
sicht, dann senkte sie den Kopf, wurde ein
wenig rot und sang lauter. Sie fingen gerade
einen neuen Vers an und ich fiel mit ein, so
gut und kräftig ich es vermochte. Dann holte
ich meinen Wein herüber, nahm eine drei-
beinige Stabelle her und setzte mich singend
mit an den Küchentisch. Die Rotblonde schob
mir eine Handvoll Bohnen zu und ich half
denn mit aushülsen.
Als alle die vielen Strophen ausgesungen
waren, sahen wir einander an und mußten
lachen, was der Braunen überaus prächtig zu
Gesichte stand. Ich bot ihr mein Glas hin,
doch nahm sie es nicht an.
„Sie sind aber eine Stolze,“ sagte ich be-
trübt. „Sind Sie denn etwa von Stuttgart?“
„Nein. Warum von Stuttgart?“
„Weil es heißt:
Stuegert isch e schöne Stadt,
Stuegert lit im Tale,
wos so schöne Madie hat,
aber so brutale/*
„Er ist ein Schwab,“ sagte die Alte zur
Blonden.
„Ja, er ist einer,“ bestätigte ich. „Und Sie
sind vom Oberland, wo die Schlehen wachsen.“
„Kann sein,“ meinte sie und kicherte.
Ich sah aber immer die Braune an, und ich
setzte aus Bohnen den Buchstaben M zusammen
und fragte sie, ob sie so heiße. Sie schüttelte
den Kopf und ich machte nun ein A. Da
nickte sie und ich begann nun zu raten.
„Agnes?“
„Nein.“
„Anna.“
„Nichts.“
„Adelheid?“
„Auch nicht.“
Und so viel ich riet, es war alles falsch,
sie aber wurde ganz fröhlich darüber und rief
schließlich: „O Sie Unvernunft!“ Als ich sie
dann sehr bat, sie möchte mir jetzt ihren
Namen sagen, schämte sie sich eine kleine
Zeit, dann sagte sie schnell und leise: „Agathe“
und wurde rot dabei, wie wenn sie ein Ge-
heimnis preisgegeben hätte.
„Sind Sie auch ein Holzhändler?“ fragte die
Blonde.
„Nein, das nicht. Seh ich denn so aus?“
„Oder ein Geometer, nicht?“
„Auch nicht. Warum soll ich Geometer
sein?“
„Warum? Darum.“
„Ihr Schatz wird einer sein, gelt?“
„Mir wärs schon recht.“
„Singen wir noch eins, zum Schluß?“ fragte
die Schöne, und während die letzten Schoten
uns durch die Finger gingen, sangen wir das
Lied „Steh ich in finstrer Mitternacht“. Als
das zu Ende war, standen die Mädchen auf
und ich auch.
„Gut Nacht,“ sagte ich zu jeder und gab
jeder die Hand, und zu der Braunen sagte ich:
„Gut Nacht, Agathe.“
In der Wirtsstube brachen jetzt die drei
Rauhbeine auf. Sie nahmen keinerlei Notiz
von mir, tranken langsam ihre Reste aus und
zahlten nichts, waren also jedenfalls für diesen
Abend die Gäste des Jlgenbergers gewesen.
„Gut Nacht auch,“ sagte ich, als sie gingen,
bekam aber keine Antwort und schlug hinter
den Dickköpfen die Türe kräftig zu. Gleich
darauf kam die Wirtin mit Pferdedecken und
einem Bettkissen. Wir bauten aus der Ofen-
bank und drei Stühlen ein leidliches Nachtlager,
und zum Tröste teilte die Frau mir beim Weg-
gehen mit, das Übernachten solle mich nichts
kosten. Das war mir auch recht.
Halb ausgekleidet und mit meinem Mantel
zugedeckt lag ich am Ofen, der noch wohlig
wärmte, und dachte an die braune Agathe.
Ein Vers aus einem alten frommen Liede, das
ich in Kinderzeiten oft mit meiner Mutter ge-
sungen hatte, fiel mir ein:
Schön sind die Blumen,
schöner sind die Menschen
in der schönen Jugendzeit — —
So eine war Agathe, schöner als Blumen,
und doch mit ihnen verwandt. Es gibt überall,
in allen Ländern, einzelne solche Schönheiten,
doch sind sie nicht allzu häufig, und so oft ich
eine sah, hat es mir wohlgetan. Sie sind wie
große Kinder, so scheu wie zutraulich, und
haben in ihren ungetrübten Augen den unbewußt
seligen Blick eines schönen Tieres oder einer
Waldquelle. Man sieht sie an und hat sie lieb,
ohne ihrer zu begehren, und während man sie
ansieht, will es einem wehe tun, daß diese
feinen Bilder der Jugend und Menschenblüte
auch einmal altern und vergehen müssen.
Bald schlief ich ein, und es mag von der
Ofenwärme gekommen sein, daß mir träumte,
ich liege am Felsgestade einer südlichen Insel,
spüre die heiße Sonne auf meinen Rücken
brennen und sähe einem braunen Mädchen zu,
das allein in einer Barke seewärts ruderte und
langsam ferner und kleiner wurde.
(Schluss im nächsten Heft.)
II
65
4