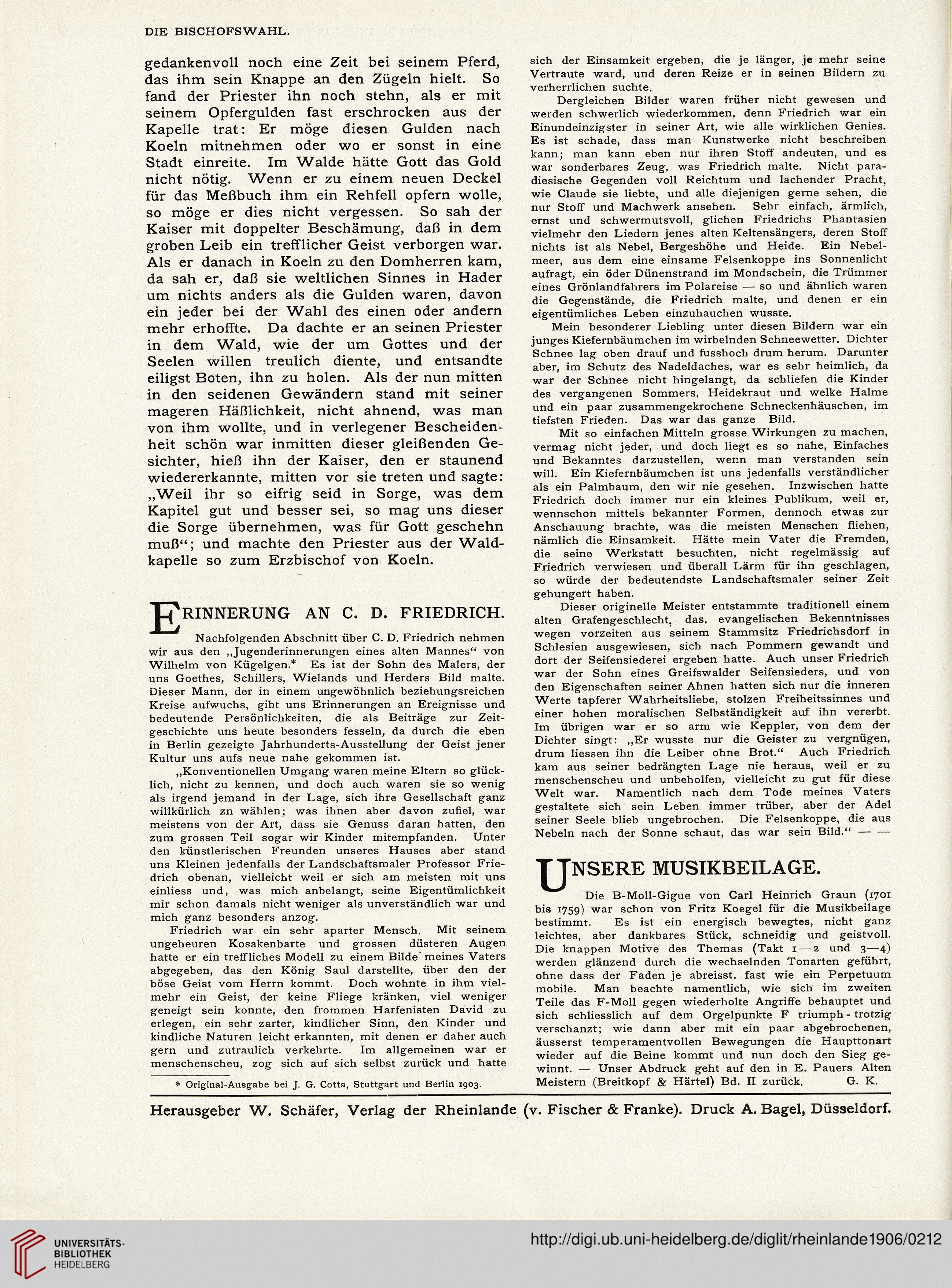DIE BISCHOFSWAHL.
gedankenvoll noch eine Zeit bei seinem Pferd,
das ihm sein Knappe an den Zügeln hielt. So
fand der Priester ihn noch stehn, als er mit
seinem Opfergulden fast erschrocken aus der
Kapelle trat: Er möge diesen Gulden nach
Koeln mitnehmen oder wo er sonst in eine
Stadt einreite. Im Walde hätte Gott das Gold
nicht nötig. Wenn er zu einem neuen Deckel
für das Meßbuch ihm ein Rehfell opfern wolle,
so möge er dies nicht vergessen. So sah der
Kaiser mit doppelter Beschämung, daß in dem
groben Leib ein trefflicher Geist verborgen war.
Als er danach in Koeln zu den Domherren kam,
da sah er, daß sie weltlichen Sinnes in Hader
um nichts anders als die Gulden waren, davon
ein jeder bei der Wahl des einen oder andern
mehr erhoffte. Da dachte er an seinen Priester
in dem Wald, wie der um Gottes und der
Seelen willen treulich diente, und entsandte
eiligst Boten, ihn zu holen. Als der nun mitten
in den seidenen Gewändern stand mit seiner
mageren Häßlichkeit, nicht ahnend, was man
von ihm wollte, und in verlegener Bescheiden-
heit schön war inmitten dieser gleißenden Ge-
sichter, hieß ihn der Kaiser, den er staunend
wiedererkannte, mitten vor sie treten und sagte:
„Weil ihr so eifrig seid in Sorge, was dem
Kapitel gut und besser sei, so mag uns dieser
die Sorge übernehmen, was für Gott geschehn
muß“; und machte den Priester aus der Wald-
kapelle so zum Erzbischof von Koeln.
RINNERUNG AN C. D. FRIEDRICH.
Nachfolgenden Abschnitt über C. D. Friedrich nehmen
wir aus den „Jugenderinnerungen eines alten Mannes“ von
Wilhelm von Kügelgen.* Es ist der Sohn des Malers, der
uns Goethes, Schillers, Wielands und Herders Bild malte.
Dieser Mann, der in einem ungewöhnlich beziehungsreichen
Kreise aufwuchs, gibt uns Erinnerungen an Ereignisse und
bedeutende Persönlichkeiten, die als Beiträge zur Zeit-
geschichte uns heute besonders fesseln, da durch die eben
in Berlin gezeigte Jahrhunderts-Ausstellung der Geist jener
Kultur uns aufs neue nahe gekommen ist.
„Konventionellen Umgang waren meine Eltern so glück-
lich, nicht zu kennen, und doch auch waren sie so wenig
als irgend jemand in der Lage, sich ihre Gesellschaft ganz
willkürlich zn wählen; was ihnen aber davon zufiel, war
meistens von der Art, dass sie Genuss daran hatten, den
zum grossen Teil sogar wir Kinder mitempfanden. Unter
den künstlerischen Freunden unseres Hauses aber stand
uns Kleinen jedenfalls der Landschaftsmaler Professor Frie-
drich obenan, vielleicht weil er sich am meisten mit uns
einliess und, was mich anbelangt, seine Eigentümlichkeit
mir schon damals nicht weniger als unverständlich war und
mich ganz besonders anzog.
Friedrich war ein sehr aparter Mensch. Mit seinem
ungeheuren Kosakenbarte und grossen düsteren Augen
hatte er ein treffliches Modell zu einem Bilde meines Vaters
abgegeben, das den König Saul darstellte, über den der
böse Geist vom Herrn kommt. Doch wohnte in ihm viel-
mehr ein Geist, der keine Fliege kränken, viel weniger
geneigt sein konnte, den frommen Harfenisten David zu
erlegen, ein sehr zarter, kindlicher Sinn, den Kinder und
kindliche Naturen leicht erkannten, mit denen er daher auch
gern und zutraulich verkehrte. Im allgemeinen war er
menschenscheu, zog sich auf sich selbst zurück und hatte
* Original-Ausgabe bei J. G. Cotta, Stuttgart und Berlin 1903.
sich der Einsamkeit ergeben, die je länger, je mehr seine
Vertraute ward, und deren Reize er in seinen Bildern zu
verherrlichen suchte.
Dergleichen Bilder waren früher nicht gewesen und
werden schwerlich wiederkommen, denn Friedrich war ein
Einundeinzigster in seiner Art, wie alle wirklichen Genies.
Es ist schade, dass man Kunstwerke nicht beschreiben
kann; man kann eben nur ihren Stoff andeuten, und es
war sonderbares Zeug, was Friedrich malte. Nicht para-
diesische Gegenden voll Reichtum und lachender Pracht,
wie Claude sie liebte, und alle diejenigen gerne sehen, die
nur Stoff und Machwerk ansehen. Sehr einfach, ärmlich,
ernst und schwermutsvoll, glichen Friedrichs Phantasien
vielmehr den Liedern jenes alten Keltensängers, deren Stoff
nichts ist als Nebel, Bergeshöhe und Heide. Ein Nebel-
meer, aus dem eine einsame Felsenkoppe ins Sonnenlicht
aufragt, ein öder Dünenstrand im Mondschein, die Trümmer
eines Grönlandfahrers im Polareise — so und ähnlich waren
die Gegenstände, die Friedrich malte, und denen er ein
eigentümliches Leben einzuhauchen wusste.
Mein besonderer Liebling unter diesen Bildern war ein
junges Kiefernbäumchen im wirbelnden Schneewetter. Dichter
Schnee lag oben drauf und fusshoch drum herum. Darunter
aber, im Schutz des Nadeldaches, war es sehr heimlich, da
war der Schnee nicht hingelangt, da schliefen die Kinder
des vergangenen Sommers, Heidekraut und welke Halme
und ein paar zusammengekrochene Schneckenhäuschen, im
tiefsten Frieden. Das war das ganze Bild.
Mit so einfachen Mitteln grosse Wirkungen zu machen,
vermag nicht jeder, und doch liegt es so nahe, Einfaches
und Bekanntes darzustellen, wenn man verstanden sein
will. Ein Kiefernbäumchen ist uns jedenfalls verständlicher
als ein Palmbaum, den wir nie gesehen. Inzwischen hatte
Friedrich doch immer nur ein kleines Publikum, weil er,
wennschon mittels bekannter Formen, dennoch etwas zur
Anschauung brachte, was die meisten Menschen fliehen,
nämlich die Einsamkeit. Hätte mein Vater die Fremden,
die seine Werkstatt besuchten, nicht regelmässig auf
Friedrich verwiesen und überall Lärm für ihn geschlagen,
so würde der bedeutendste Landschaftsmaler seiner Zeit
gehungert haben.
Dieser originelle Meister entstammte traditionell einem
alten Grafengeschlecht, das, evangelischen Bekenntnisses
wegen vorzeiten aus seinem Stammsitz Friedrichsdorf in
Schlesien ausgewiesen, sich nach Pommern gewandt und
dort der Seifensiederei ergeben hatte. Auch unser Friedrich
war der Sohn eines Greifswalder Seifensieders, und von
den Eigenschaften seiner Ahnen hatten sich nur die inneren
Werte tapferer Wahrheitsliebe, stolzen Freiheitssinnes und
einer hohen moralischen Selbständigkeit auf ihn vererbt.
Im übrigen war er so arm wie Keppler, von dem der
Dichter singt: „Er wusste nur die Geister zu vergnügen,
drum Hessen ihn die Leiber ohne Brot.“ Auch Friedrich
kam aus seiner bedrängten Lage nie heraus, weil er zu
menschenscheu und unbeholfen, vielleicht zu gut für diese
Welt war. Namentlich nach dem Tode meines Vaters
gestaltete sich sein Leben immer trüber, aber der Adel
seiner Seele blieb ungebrochen. Die Felsenkoppe, die aus
Nebeln nach der Sonne schaut, das war sein Bild.“ — —
'QNSERE MUSIKBEILAGE.
Die B-Moll-Gigue von Carl Heinrich Graun (1701
bis 1759) war schon von Fritz Koegel für die Musikbeilage
bestimmt. Es ist ein energisch bewegtes, nicht ganz
leichtes, aber dankbares Stück, schneidig und geistvoll.
Die knappen Motive des Themas (Takt 1 — 2 und 3—4)
werden glänzend durch die wechselnden Tonarten geführt,
ohne dass der Faden je abreisst, fast wie ein Perpetuum
mobile. Man beachte namentlich, wie sich im zweiten
Teile das F-Moll gegen wiederholte Angriffe behauptet und
sich schliesslich auf dem Orgelpunkte F triumph - trotzig
verschanzt; wie dann aber mit ein paar abgebrochenen,
äusserst temperamentvollen Bewegungen die Haupttonart
wieder auf die Beine kommt und nun doch den Sieg ge-
winnt. — Unser Abdruck geht auf den in E. Pauers Alten
Meistern (Breitkopf & Härtel) Bd. II zurück. G. K.
Herausgeber W. Schäfer, Verlag der Rheinlande (v. Fischer & Franke). Druck A. Bagel, Düsseldorf.
gedankenvoll noch eine Zeit bei seinem Pferd,
das ihm sein Knappe an den Zügeln hielt. So
fand der Priester ihn noch stehn, als er mit
seinem Opfergulden fast erschrocken aus der
Kapelle trat: Er möge diesen Gulden nach
Koeln mitnehmen oder wo er sonst in eine
Stadt einreite. Im Walde hätte Gott das Gold
nicht nötig. Wenn er zu einem neuen Deckel
für das Meßbuch ihm ein Rehfell opfern wolle,
so möge er dies nicht vergessen. So sah der
Kaiser mit doppelter Beschämung, daß in dem
groben Leib ein trefflicher Geist verborgen war.
Als er danach in Koeln zu den Domherren kam,
da sah er, daß sie weltlichen Sinnes in Hader
um nichts anders als die Gulden waren, davon
ein jeder bei der Wahl des einen oder andern
mehr erhoffte. Da dachte er an seinen Priester
in dem Wald, wie der um Gottes und der
Seelen willen treulich diente, und entsandte
eiligst Boten, ihn zu holen. Als der nun mitten
in den seidenen Gewändern stand mit seiner
mageren Häßlichkeit, nicht ahnend, was man
von ihm wollte, und in verlegener Bescheiden-
heit schön war inmitten dieser gleißenden Ge-
sichter, hieß ihn der Kaiser, den er staunend
wiedererkannte, mitten vor sie treten und sagte:
„Weil ihr so eifrig seid in Sorge, was dem
Kapitel gut und besser sei, so mag uns dieser
die Sorge übernehmen, was für Gott geschehn
muß“; und machte den Priester aus der Wald-
kapelle so zum Erzbischof von Koeln.
RINNERUNG AN C. D. FRIEDRICH.
Nachfolgenden Abschnitt über C. D. Friedrich nehmen
wir aus den „Jugenderinnerungen eines alten Mannes“ von
Wilhelm von Kügelgen.* Es ist der Sohn des Malers, der
uns Goethes, Schillers, Wielands und Herders Bild malte.
Dieser Mann, der in einem ungewöhnlich beziehungsreichen
Kreise aufwuchs, gibt uns Erinnerungen an Ereignisse und
bedeutende Persönlichkeiten, die als Beiträge zur Zeit-
geschichte uns heute besonders fesseln, da durch die eben
in Berlin gezeigte Jahrhunderts-Ausstellung der Geist jener
Kultur uns aufs neue nahe gekommen ist.
„Konventionellen Umgang waren meine Eltern so glück-
lich, nicht zu kennen, und doch auch waren sie so wenig
als irgend jemand in der Lage, sich ihre Gesellschaft ganz
willkürlich zn wählen; was ihnen aber davon zufiel, war
meistens von der Art, dass sie Genuss daran hatten, den
zum grossen Teil sogar wir Kinder mitempfanden. Unter
den künstlerischen Freunden unseres Hauses aber stand
uns Kleinen jedenfalls der Landschaftsmaler Professor Frie-
drich obenan, vielleicht weil er sich am meisten mit uns
einliess und, was mich anbelangt, seine Eigentümlichkeit
mir schon damals nicht weniger als unverständlich war und
mich ganz besonders anzog.
Friedrich war ein sehr aparter Mensch. Mit seinem
ungeheuren Kosakenbarte und grossen düsteren Augen
hatte er ein treffliches Modell zu einem Bilde meines Vaters
abgegeben, das den König Saul darstellte, über den der
böse Geist vom Herrn kommt. Doch wohnte in ihm viel-
mehr ein Geist, der keine Fliege kränken, viel weniger
geneigt sein konnte, den frommen Harfenisten David zu
erlegen, ein sehr zarter, kindlicher Sinn, den Kinder und
kindliche Naturen leicht erkannten, mit denen er daher auch
gern und zutraulich verkehrte. Im allgemeinen war er
menschenscheu, zog sich auf sich selbst zurück und hatte
* Original-Ausgabe bei J. G. Cotta, Stuttgart und Berlin 1903.
sich der Einsamkeit ergeben, die je länger, je mehr seine
Vertraute ward, und deren Reize er in seinen Bildern zu
verherrlichen suchte.
Dergleichen Bilder waren früher nicht gewesen und
werden schwerlich wiederkommen, denn Friedrich war ein
Einundeinzigster in seiner Art, wie alle wirklichen Genies.
Es ist schade, dass man Kunstwerke nicht beschreiben
kann; man kann eben nur ihren Stoff andeuten, und es
war sonderbares Zeug, was Friedrich malte. Nicht para-
diesische Gegenden voll Reichtum und lachender Pracht,
wie Claude sie liebte, und alle diejenigen gerne sehen, die
nur Stoff und Machwerk ansehen. Sehr einfach, ärmlich,
ernst und schwermutsvoll, glichen Friedrichs Phantasien
vielmehr den Liedern jenes alten Keltensängers, deren Stoff
nichts ist als Nebel, Bergeshöhe und Heide. Ein Nebel-
meer, aus dem eine einsame Felsenkoppe ins Sonnenlicht
aufragt, ein öder Dünenstrand im Mondschein, die Trümmer
eines Grönlandfahrers im Polareise — so und ähnlich waren
die Gegenstände, die Friedrich malte, und denen er ein
eigentümliches Leben einzuhauchen wusste.
Mein besonderer Liebling unter diesen Bildern war ein
junges Kiefernbäumchen im wirbelnden Schneewetter. Dichter
Schnee lag oben drauf und fusshoch drum herum. Darunter
aber, im Schutz des Nadeldaches, war es sehr heimlich, da
war der Schnee nicht hingelangt, da schliefen die Kinder
des vergangenen Sommers, Heidekraut und welke Halme
und ein paar zusammengekrochene Schneckenhäuschen, im
tiefsten Frieden. Das war das ganze Bild.
Mit so einfachen Mitteln grosse Wirkungen zu machen,
vermag nicht jeder, und doch liegt es so nahe, Einfaches
und Bekanntes darzustellen, wenn man verstanden sein
will. Ein Kiefernbäumchen ist uns jedenfalls verständlicher
als ein Palmbaum, den wir nie gesehen. Inzwischen hatte
Friedrich doch immer nur ein kleines Publikum, weil er,
wennschon mittels bekannter Formen, dennoch etwas zur
Anschauung brachte, was die meisten Menschen fliehen,
nämlich die Einsamkeit. Hätte mein Vater die Fremden,
die seine Werkstatt besuchten, nicht regelmässig auf
Friedrich verwiesen und überall Lärm für ihn geschlagen,
so würde der bedeutendste Landschaftsmaler seiner Zeit
gehungert haben.
Dieser originelle Meister entstammte traditionell einem
alten Grafengeschlecht, das, evangelischen Bekenntnisses
wegen vorzeiten aus seinem Stammsitz Friedrichsdorf in
Schlesien ausgewiesen, sich nach Pommern gewandt und
dort der Seifensiederei ergeben hatte. Auch unser Friedrich
war der Sohn eines Greifswalder Seifensieders, und von
den Eigenschaften seiner Ahnen hatten sich nur die inneren
Werte tapferer Wahrheitsliebe, stolzen Freiheitssinnes und
einer hohen moralischen Selbständigkeit auf ihn vererbt.
Im übrigen war er so arm wie Keppler, von dem der
Dichter singt: „Er wusste nur die Geister zu vergnügen,
drum Hessen ihn die Leiber ohne Brot.“ Auch Friedrich
kam aus seiner bedrängten Lage nie heraus, weil er zu
menschenscheu und unbeholfen, vielleicht zu gut für diese
Welt war. Namentlich nach dem Tode meines Vaters
gestaltete sich sein Leben immer trüber, aber der Adel
seiner Seele blieb ungebrochen. Die Felsenkoppe, die aus
Nebeln nach der Sonne schaut, das war sein Bild.“ — —
'QNSERE MUSIKBEILAGE.
Die B-Moll-Gigue von Carl Heinrich Graun (1701
bis 1759) war schon von Fritz Koegel für die Musikbeilage
bestimmt. Es ist ein energisch bewegtes, nicht ganz
leichtes, aber dankbares Stück, schneidig und geistvoll.
Die knappen Motive des Themas (Takt 1 — 2 und 3—4)
werden glänzend durch die wechselnden Tonarten geführt,
ohne dass der Faden je abreisst, fast wie ein Perpetuum
mobile. Man beachte namentlich, wie sich im zweiten
Teile das F-Moll gegen wiederholte Angriffe behauptet und
sich schliesslich auf dem Orgelpunkte F triumph - trotzig
verschanzt; wie dann aber mit ein paar abgebrochenen,
äusserst temperamentvollen Bewegungen die Haupttonart
wieder auf die Beine kommt und nun doch den Sieg ge-
winnt. — Unser Abdruck geht auf den in E. Pauers Alten
Meistern (Breitkopf & Härtel) Bd. II zurück. G. K.
Herausgeber W. Schäfer, Verlag der Rheinlande (v. Fischer & Franke). Druck A. Bagel, Düsseldorf.