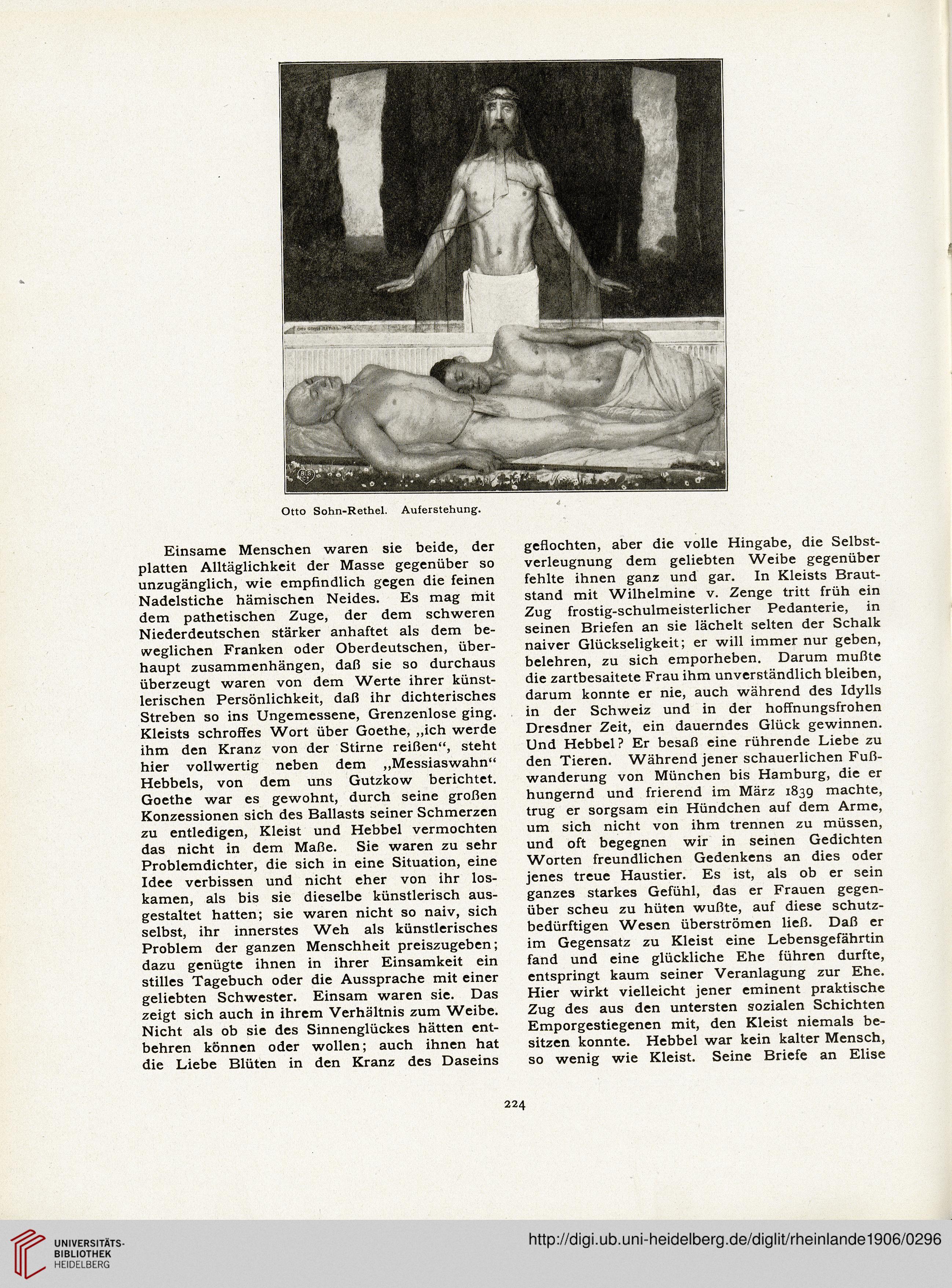Otto Sohn-Rethel. Auferstehung.
Einsame Menschen waren sie beide, der
platten Alltäglichkeit der Masse gegenüber so
unzugänglich, wie empfindlich gegen die feinen
Nadelstiche hämischen Neides. Es mag mit
dem pathetischen Zuge, der dem schweren
Niederdeutschen stärker anhaftet als dem be-
weglichen Franken oder Oberdeutschen, über-
haupt Zusammenhängen, daß sie so durchaus
überzeugt waren von dem Werte ihrer künst-
lerischen Persönlichkeit, daß ihr dichterisches
Streben so ins Ungemessene, Grenzenlose ging.
Kleists schroffes Wort über Goethe, „ich werde
ihm den Kranz von der Stirne reißen“, steht
hier vollwertig neben dem „Messiaswahn“
Hebbels, von dem uns Gutzkow berichtet.
Goethe war es gewohnt, durch seine großen
Konzessionen sich des Ballasts seiner Schmerzen
zu entledigen, Kleist und Hebbel vermochten
das nicht in dem Maße. Sie waren zu sehr
Problemdichter, die sich in eine Situation, eine
Idee verbissen und nicht eher von ihr los-
kamen, als bis sie dieselbe künstlerisch aus-
gestaltet hatten; sie waren nicht so naiv, sich
selbst, ihr innerstes Weh als künstlerisches
Problem der ganzen Menschheit preiszugeben;
dazu genügte ihnen in ihrer Einsamkeit ein
stilles Tagebuch oder die Aussprache mit einer
geliebten Schwester. Einsam waren sie. Das
zeigt sich auch in ihrem Verhältnis zum Weibe.
Nicht als ob sie des Sinnenglückes hätten ent-
behren können oder wollen; auch ihnen hat
die Liebe Blüten in den Kranz des Daseins
geflochten, aber die volle Hingabe, die Selbst-
verleugnung dem geliebten Weibe gegenüber
fehlte ihnen ganz und gar. In Kleists Braut-
stand mit Wilhelmine v. Zenge tritt früh ein
Zug frostig-schulmeisterlicher Pedanterie, in
seinen Briefen an sie lächelt selten der Schalk
naiver Glückseligkeit; er will immer nur geben,
belehren, zu sich emporheben. Darum mußte
die zartbesaitete Frau ihm unverständlich bleiben,
darum konnte er nie, auch während des Idylls
in der Schweiz und in der hoffnungsfrohen
Dresdner Zeit, ein dauerndes Glück gewinnen.
Und Hebbel? Er besaß eine rührende Liebe zu
den Tieren. Während jener schauerlichen Fuß-
wanderung von München bis Hamburg, die er
hungernd und frierend im März 1839 machte,
trug er sorgsam ein Hündchen auf dem Arme,
um sich nicht von ihm trennen zu müssen,
und oft begegnen wir in seinen Gedichten
Worten freundlichen Gedenkens an dies oder
jenes treue Haustier. Es ist, als ob er sein
ganzes starkes Gefühl, das er Frauen gegen-
über scheu zu hüten wußte, auf diese schutz-
bedürftigen Wesen überströmen ließ. Daß er
im Gegensatz zu Kleist eine Lebensgefährtin
fand und eine glückliche Ehe führen durfte,
entspringt kaum seiner Veranlagung zur Ehe.
Hier wirkt vielleicht jener eminent praktische
Zug des aus den untersten sozialen Schichten
Emporgestiegenen mit, den Kleist niemals be-
sitzen konnte. Hebbel war kein kalter Mensch,
so wenig wie Kleist. Seine Briefe an Elise
224
Einsame Menschen waren sie beide, der
platten Alltäglichkeit der Masse gegenüber so
unzugänglich, wie empfindlich gegen die feinen
Nadelstiche hämischen Neides. Es mag mit
dem pathetischen Zuge, der dem schweren
Niederdeutschen stärker anhaftet als dem be-
weglichen Franken oder Oberdeutschen, über-
haupt Zusammenhängen, daß sie so durchaus
überzeugt waren von dem Werte ihrer künst-
lerischen Persönlichkeit, daß ihr dichterisches
Streben so ins Ungemessene, Grenzenlose ging.
Kleists schroffes Wort über Goethe, „ich werde
ihm den Kranz von der Stirne reißen“, steht
hier vollwertig neben dem „Messiaswahn“
Hebbels, von dem uns Gutzkow berichtet.
Goethe war es gewohnt, durch seine großen
Konzessionen sich des Ballasts seiner Schmerzen
zu entledigen, Kleist und Hebbel vermochten
das nicht in dem Maße. Sie waren zu sehr
Problemdichter, die sich in eine Situation, eine
Idee verbissen und nicht eher von ihr los-
kamen, als bis sie dieselbe künstlerisch aus-
gestaltet hatten; sie waren nicht so naiv, sich
selbst, ihr innerstes Weh als künstlerisches
Problem der ganzen Menschheit preiszugeben;
dazu genügte ihnen in ihrer Einsamkeit ein
stilles Tagebuch oder die Aussprache mit einer
geliebten Schwester. Einsam waren sie. Das
zeigt sich auch in ihrem Verhältnis zum Weibe.
Nicht als ob sie des Sinnenglückes hätten ent-
behren können oder wollen; auch ihnen hat
die Liebe Blüten in den Kranz des Daseins
geflochten, aber die volle Hingabe, die Selbst-
verleugnung dem geliebten Weibe gegenüber
fehlte ihnen ganz und gar. In Kleists Braut-
stand mit Wilhelmine v. Zenge tritt früh ein
Zug frostig-schulmeisterlicher Pedanterie, in
seinen Briefen an sie lächelt selten der Schalk
naiver Glückseligkeit; er will immer nur geben,
belehren, zu sich emporheben. Darum mußte
die zartbesaitete Frau ihm unverständlich bleiben,
darum konnte er nie, auch während des Idylls
in der Schweiz und in der hoffnungsfrohen
Dresdner Zeit, ein dauerndes Glück gewinnen.
Und Hebbel? Er besaß eine rührende Liebe zu
den Tieren. Während jener schauerlichen Fuß-
wanderung von München bis Hamburg, die er
hungernd und frierend im März 1839 machte,
trug er sorgsam ein Hündchen auf dem Arme,
um sich nicht von ihm trennen zu müssen,
und oft begegnen wir in seinen Gedichten
Worten freundlichen Gedenkens an dies oder
jenes treue Haustier. Es ist, als ob er sein
ganzes starkes Gefühl, das er Frauen gegen-
über scheu zu hüten wußte, auf diese schutz-
bedürftigen Wesen überströmen ließ. Daß er
im Gegensatz zu Kleist eine Lebensgefährtin
fand und eine glückliche Ehe führen durfte,
entspringt kaum seiner Veranlagung zur Ehe.
Hier wirkt vielleicht jener eminent praktische
Zug des aus den untersten sozialen Schichten
Emporgestiegenen mit, den Kleist niemals be-
sitzen konnte. Hebbel war kein kalter Mensch,
so wenig wie Kleist. Seine Briefe an Elise
224