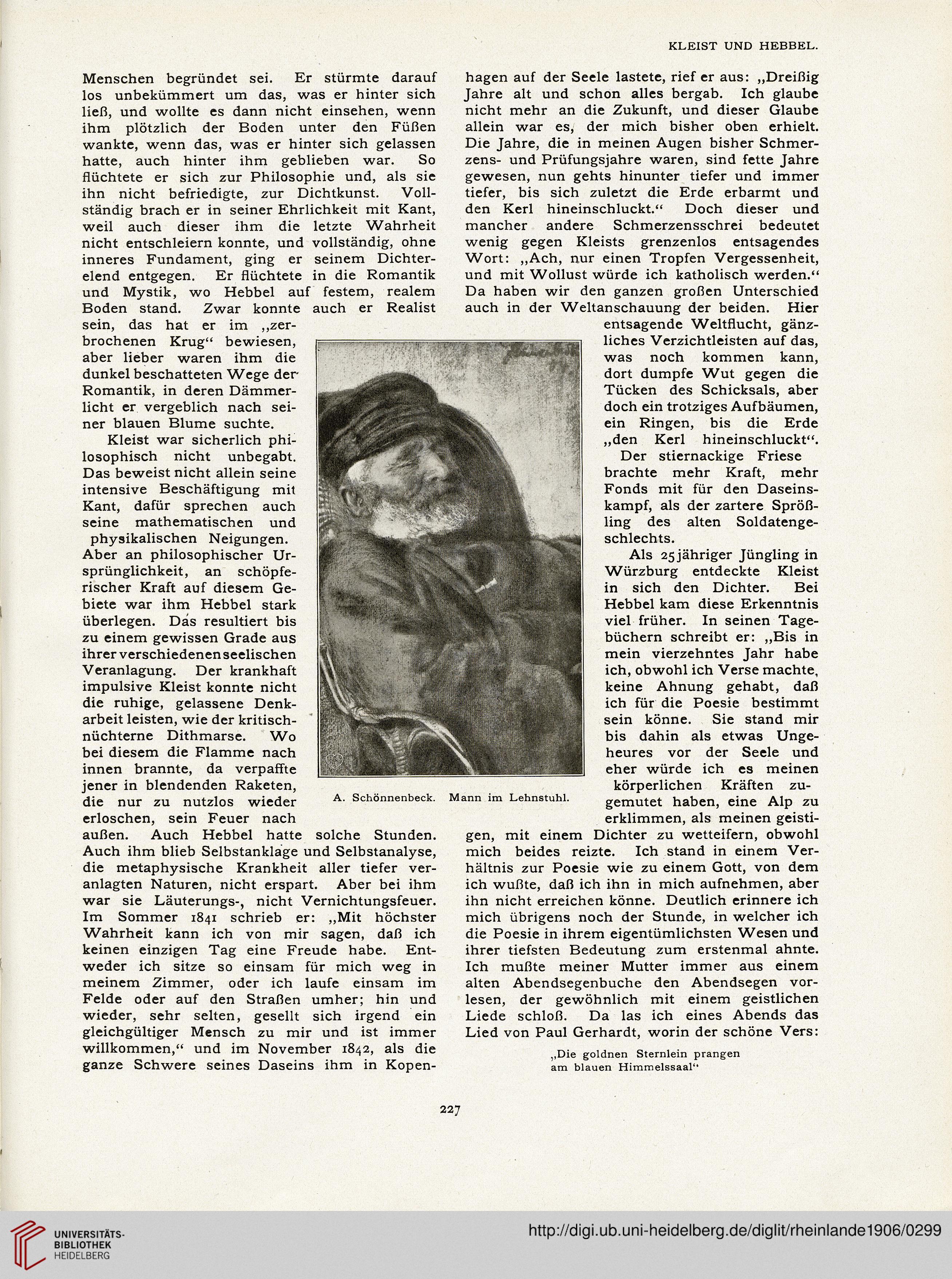KLEIST UND HEBBEL.
Menschen begründet sei. Er stürmte darauf
los unbekümmert um das, was er hinter sich
ließ, und wollte es dann nicht einsehen, wenn
ihm plötzlich der Boden unter den Füßen
wankte, wenn das, was er hinter sich gelassen
hatte, auch hinter ihm geblieben war. So
flüchtete er sich zur Philosophie und, als sie
ihn nicht befriedigte, zur Dichtkunst. Voll-
ständig brach er in seiner Ehrlichkeit mit Kant,
weil auch dieser ihm die letzte Wahrheit
nicht entschleiern konnte, und vollständig, ohne
inneres Fundament, ging er seinem Dichter-
elend entgegen. Er flüchtete in die Romantik
und Mystik, wo Hebbel auf festem, realem
Boden stand. Zwar konnte auch er Realist
sein, das hat er im „zer-
brochenen Krug“ bewiesen,
aber lieber waren ihm die
dunkel beschatteten Wege der
Romantik, in deren Dämmer-
licht er vergeblich nach sei-
ner blauen Blume suchte.
Kleist war sicherlich phi-
losophisch nicht unbegabt.
Das beweist nicht allein seine
intensive Beschäftigung mit
Kant, dafür sprechen auch
seine mathematischen und
physikalischen Neigungen.
Aber an philosophischer Ur-
sprünglichkeit, an schöpfe-
rischer Kraft auf diesem Ge-
biete war ihm Hebbel stark
überlegen. Das resultiert bis
zu einem gewissen Grade aus
ihrer verschiedenen seelischen
Veranlagung. Der krankhaft
impulsive Kleist konnte nicht
die ruhige, gelassene Denk-
arbeit leisten, wie der kritisch-
nüchterne Dithmarse. Wo
bei diesem die Flamme nach
innen brannte, da verpaffte
jener in blendenden Raketen,
die nur zu nutzlos wieder
erloschen, sein Feuer nach
außen. Auch Hebbel hatte solche Stunden.
Auch ihm blieb Selbstanklage und Selbstanalyse,
die metaphysische Krankheit aller tiefer ver-
anlagten Naturen, nicht erspart. Aber bei ihm
war sie Läuterungs-, nicht Vernichtungsfeuer.
Im Sommer 1841 schrieb er: „Mit höchster
Wahrheit kann ich von mir sagen, daß ich
keinen einzigen Tag eine Freude habe. Ent-
weder ich sitze so einsam für mich weg in
meinem Zimmer, oder ich laufe einsam im
Felde oder auf den Straßen umher; hin und
wieder, sehr selten, gesellt sich irgend ein
gleichgültiger Mensch zu mir und ist immer
willkommen,“ und im November 1842, als die
ganze Schwere seines Daseins ihm in Kopen-
hagen auf der Seele lastete, rief er aus: „Dreißig
Jahre alt und schon alles bergab. Ich glaube
nicht mehr an die Zukunft, und dieser Glaube
allein war es, der mich bisher oben erhielt.
Die Jahre, die in meinen Augen bisher Schmer-
zens- und Prüfungsjahre waren, sind fette Jahre
gewesen, nun gehts hinunter tiefer und immer
tiefer, bis sich zuletzt die Erde erbarmt und
den Kerl hineinschluckt.“ Doch dieser und
mancher andere Schmerzensschrei bedeutet
wenig gegen Kleists grenzenlos entsagendes
Wort: „Ach, nur einen Tropfen Vergessenheit,
und mit Wollust würde ich katholisch werden.“
Da haben wir den ganzen großen Unterschied
auch in der Weltanschauung der beiden. Hier
entsagende Weltflucht, gänz-
liches Verzichtleisten auf das,
was noch kommen kann,
dort dumpfe Wut gegen die
Tücken des Schicksals, aber
doch ein trotziges Aufbäumen,
ein Ringen, bis die Erde
„den Kerl hineinschluckt“.
Der stiernackige Friese
brachte mehr Kraft, mehr
Fonds mit für den Daseins-
kampf, als der zartere Spröß-
ling des alten Soldatenge-
schlechts.
Als 25jähriger Jüngling in
Würzburg entdeckte Kleist
in sich den Dichter. Bei
Hebbel kam diese Erkenntnis
viel früher. In seinen Tage-
büchern schreibt er: „Bis in
mein vierzehntes Jahr habe
ich, obwohl ich Verse machte,
keine Ahnung gehabt, daß
ich für die Poesie bestimmt
sein könne. Sie stand mir
bis dahin als etwas Unge-
heures vor der Seele und
eher würde ich es meinen
körperlichen Kräften zu-
gemutet haben, eine Alp zu
erklimmen, als meinen geisti-
gen, mit einem Dichter zu wetteifern, obwohl
mich beides reizte. Ich stand in einem Ver-
hältnis zur Poesie wie zu einem Gott, von dem
ich wußte, daß ich ihn in mich aufnehmen, aber
ihn nicht erreichen könne. Deutlich erinnere ich
mich übrigens noch der Stunde, in welcher ich
die Poesie in ihrem eigentümlichsten Wesen und
ihrer tiefsten Bedeutung zum erstenmal ahnte.
Ich mußte meiner Mutter immer aus einem
alten Abendsegenbuche den Abendsegen vor-
lesen, der gewöhnlich mit einem geistlichen
Liede schloß. Da las ich eines Abends das
Lied von Paul Gerhardt, worin der schöne Vers:
,,Die goldnen Sternlein prangen
am blauen Himmelssaal“
A. Schönnenbeck. Mann im Lehnstuhl.
227
Menschen begründet sei. Er stürmte darauf
los unbekümmert um das, was er hinter sich
ließ, und wollte es dann nicht einsehen, wenn
ihm plötzlich der Boden unter den Füßen
wankte, wenn das, was er hinter sich gelassen
hatte, auch hinter ihm geblieben war. So
flüchtete er sich zur Philosophie und, als sie
ihn nicht befriedigte, zur Dichtkunst. Voll-
ständig brach er in seiner Ehrlichkeit mit Kant,
weil auch dieser ihm die letzte Wahrheit
nicht entschleiern konnte, und vollständig, ohne
inneres Fundament, ging er seinem Dichter-
elend entgegen. Er flüchtete in die Romantik
und Mystik, wo Hebbel auf festem, realem
Boden stand. Zwar konnte auch er Realist
sein, das hat er im „zer-
brochenen Krug“ bewiesen,
aber lieber waren ihm die
dunkel beschatteten Wege der
Romantik, in deren Dämmer-
licht er vergeblich nach sei-
ner blauen Blume suchte.
Kleist war sicherlich phi-
losophisch nicht unbegabt.
Das beweist nicht allein seine
intensive Beschäftigung mit
Kant, dafür sprechen auch
seine mathematischen und
physikalischen Neigungen.
Aber an philosophischer Ur-
sprünglichkeit, an schöpfe-
rischer Kraft auf diesem Ge-
biete war ihm Hebbel stark
überlegen. Das resultiert bis
zu einem gewissen Grade aus
ihrer verschiedenen seelischen
Veranlagung. Der krankhaft
impulsive Kleist konnte nicht
die ruhige, gelassene Denk-
arbeit leisten, wie der kritisch-
nüchterne Dithmarse. Wo
bei diesem die Flamme nach
innen brannte, da verpaffte
jener in blendenden Raketen,
die nur zu nutzlos wieder
erloschen, sein Feuer nach
außen. Auch Hebbel hatte solche Stunden.
Auch ihm blieb Selbstanklage und Selbstanalyse,
die metaphysische Krankheit aller tiefer ver-
anlagten Naturen, nicht erspart. Aber bei ihm
war sie Läuterungs-, nicht Vernichtungsfeuer.
Im Sommer 1841 schrieb er: „Mit höchster
Wahrheit kann ich von mir sagen, daß ich
keinen einzigen Tag eine Freude habe. Ent-
weder ich sitze so einsam für mich weg in
meinem Zimmer, oder ich laufe einsam im
Felde oder auf den Straßen umher; hin und
wieder, sehr selten, gesellt sich irgend ein
gleichgültiger Mensch zu mir und ist immer
willkommen,“ und im November 1842, als die
ganze Schwere seines Daseins ihm in Kopen-
hagen auf der Seele lastete, rief er aus: „Dreißig
Jahre alt und schon alles bergab. Ich glaube
nicht mehr an die Zukunft, und dieser Glaube
allein war es, der mich bisher oben erhielt.
Die Jahre, die in meinen Augen bisher Schmer-
zens- und Prüfungsjahre waren, sind fette Jahre
gewesen, nun gehts hinunter tiefer und immer
tiefer, bis sich zuletzt die Erde erbarmt und
den Kerl hineinschluckt.“ Doch dieser und
mancher andere Schmerzensschrei bedeutet
wenig gegen Kleists grenzenlos entsagendes
Wort: „Ach, nur einen Tropfen Vergessenheit,
und mit Wollust würde ich katholisch werden.“
Da haben wir den ganzen großen Unterschied
auch in der Weltanschauung der beiden. Hier
entsagende Weltflucht, gänz-
liches Verzichtleisten auf das,
was noch kommen kann,
dort dumpfe Wut gegen die
Tücken des Schicksals, aber
doch ein trotziges Aufbäumen,
ein Ringen, bis die Erde
„den Kerl hineinschluckt“.
Der stiernackige Friese
brachte mehr Kraft, mehr
Fonds mit für den Daseins-
kampf, als der zartere Spröß-
ling des alten Soldatenge-
schlechts.
Als 25jähriger Jüngling in
Würzburg entdeckte Kleist
in sich den Dichter. Bei
Hebbel kam diese Erkenntnis
viel früher. In seinen Tage-
büchern schreibt er: „Bis in
mein vierzehntes Jahr habe
ich, obwohl ich Verse machte,
keine Ahnung gehabt, daß
ich für die Poesie bestimmt
sein könne. Sie stand mir
bis dahin als etwas Unge-
heures vor der Seele und
eher würde ich es meinen
körperlichen Kräften zu-
gemutet haben, eine Alp zu
erklimmen, als meinen geisti-
gen, mit einem Dichter zu wetteifern, obwohl
mich beides reizte. Ich stand in einem Ver-
hältnis zur Poesie wie zu einem Gott, von dem
ich wußte, daß ich ihn in mich aufnehmen, aber
ihn nicht erreichen könne. Deutlich erinnere ich
mich übrigens noch der Stunde, in welcher ich
die Poesie in ihrem eigentümlichsten Wesen und
ihrer tiefsten Bedeutung zum erstenmal ahnte.
Ich mußte meiner Mutter immer aus einem
alten Abendsegenbuche den Abendsegen vor-
lesen, der gewöhnlich mit einem geistlichen
Liede schloß. Da las ich eines Abends das
Lied von Paul Gerhardt, worin der schöne Vers:
,,Die goldnen Sternlein prangen
am blauen Himmelssaal“
A. Schönnenbeck. Mann im Lehnstuhl.
227