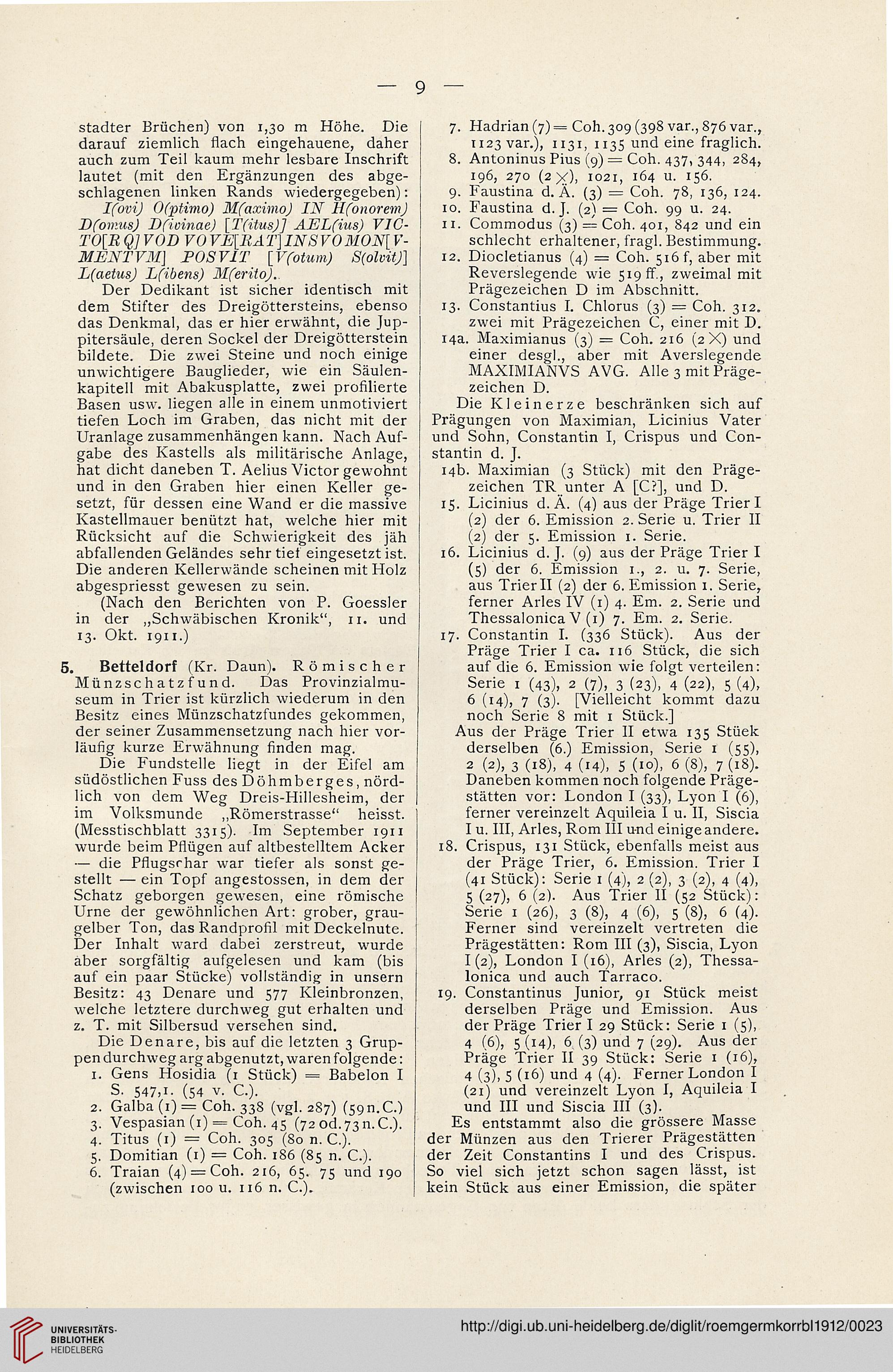9
stadter Brüchen) von 1,30 m Hôhe. Die
darauf ziemlich flach eingehauene, daher
auch zum Teil kaum mehr lesbare Inschrift
Iautet (mit den Ergânzungen des abge-
schlagenen linken Rands wiedergegeben) :
IfoviJ O(ptimo) MfaximoJ IN HfonoremJ
DfomusJ Dfioinae) [T(itus)] AELfius) VJC-
TO[R Q] VOD VO VE[RA T] INS VO MON[ V-
MENTVMJ POSVIT [Vfotum) S(olvit)]
L(aetus) Lfibens) Mferilo).
Der Dedikant ist sicher identisch mit
dem Stifter des Dreigôttersteins, ebenso
das Denkmal, das er hier erwâhnt, die Jup-
pitersäule, deren Sockel der Dreigôtterstein
bildete. Die zwei Steine und noch einige
unwichtigere Bauglieder, wie ein Sâulen-
kapitell mit Abakusplatte, zwei profilierte
Basen usw. liegen alle in einem unmotiviert
tiefen Loch im Graben, das nicht mit der
Uranlage zusammenhângen kann. Nach Auf-
gabe des Kastells als militârische Anlage,
hat dicht daneben T. Aelius Victor gewohnt
und in den Graben hier einen Keller ge-
setzt, für dessen eine Wand er die massive
Kastellmauer benützt hat, welche hier mit
Rücksicht auf die Schwierigkeit des jah
abfallenden Gelândes sehr tief eingesetzt ist.
Die anderen Kellerwande scheinen mit Holz
abgespriesst gewesen zu sein.
(Nach den Berichten von P. Goessler
in der „Schwäbischen Kronik“, 11. und
13. Okt. 1911.)
5. Betteldorf (Kr. Daun). Rômischer
Münzschatzfund. Das Provinzialmu-
seum in Trier ist kürzlich wiederum in den
Besitz eines Münzschatzfundes gekommen,
der seiner Zusammensetzung nach hier vor-
läufig kurze Erwâhnung finden mag.
Die Fundstelle liegt in der Eifel am
südöstlichen Fuss des Döhmberges, nôrd-
lich von dem Weg Dreis-Hillesheim, der
im Volksmunde „Römerstrasse“ heisst.
(Messtischblatt 3315). Im September 1911
wurde beim Pflügen auf altbestelltem Acker
— die Pflugsrhar war tiefer als sonst ge-
stellt — ein Topf angestossen, in dem der
Schatz geborgen gewesen, eine rômische
Urne der gewôhnlichen Art: grober, grau-
gelber Ton, das Randprofil mit Deckelnute.
Der Inhalt ward dabei zerstreut, wurde
àber sorgfâltig aufgelesen und kam (bis
auf ein paar Stücke) vollstândig in unsern
Besitz: 43 Denare und 577 Kleinbronzen,
welche letztere durchweg gut erhalten und
z. T. mit Silbersud versehen sind.
Die Denare, bis auf die letzten 3 Grup-
pen durchweg arg abgenutzt, waren folgende :
1. Gens Hosidia (1 Stück) = Babelon I
S. 547,i- (54 v. C.).
2. Galba (1) = Coh. 338 (vgl. 287) (59η.C.)
3. Vespasian (1) = Coh. 45 (72 od.73n.C.).
4. Titus (1) = Coh. 305 (80 n. C.).
5. Domitian (1) = Coh. 186 (85 n. C.).
6. Traian (4) = Coh. 216, 65. 75 und 190
(zwischen 100 u. 116 n. C.).
7. Hadrian (7) = Coh. 309 (398 var., 876 var.,
1123 var.), 1131, 1135 und eine fraglich.
8. Antoninus Pius (9) = Coh. 437, 344, 284,
196, 270 (2 ><r), 1021, 164 u. 156.
9. Faustina d. Ä. (3) = Coh. 78, 136, 124.
10. Faustina d. J. (2) = Coh. 99 u. 24.
11. Commodus (3) = Coh. 401, 842 und ein
schlecht erhaltener, fragl. Bestimmung.
12. Diocletianus (4) = Coh. 516 f, aber mit
Reverslegende wie 519 ff., zweimal mit
Prägezeichen D im Abschnitt.
13. Constantius I. Chlorus (3) = Coh. 312.
zwei mit Prägezeichen C, einer mit D.
14a. Maximianus (3) = Coh. 216 (2X) und
einer desgl., aber mit Averslegende
MAXIMIANVS AVG. Alle 3 mit Prâge-
zeichen D.
Die Kleinerze beschrânken sich auf
Prâgungen von Maximian, Licinius Vater
und Sohn, Constantin I, Crispus und Con-
stantin d. J.
14b. Maximian (3 Stück) mit den Prâge-
zeichen TR unter A [C?], und D.
15. Licinius d. Ä. (4) aus der Prâge Trierl
(2) der 6. Emission 2. Serie u. Trier II
(2) der 5. Emission 1. Serie.
16. Licinius d. J. (9) aus der Präge Trier I
(5) der 6. Emission 1., 2. u. 7. Serie,
aus Trierll (2) der 6. Emission 1. Serie,
ferner Arles IV (1) 4. Em. 2. Serie und
Thessalonica V (1) 7. Em. 2. Serie.
17. Constantin I. (336 Stück). Aus der
Präge Trier I ca. 116 Stück, die sich
auf die 6. Emission wie folgt verteilen:
Serie 1 (43), 2 (7), 3 (23), 4 (22), 5 (4),
6 (14), 7 (3)· [Vielleicht kommt dazu
noch Serie 8 mit 1 Stück.J
Aus der Präge Trier II etwa 135 Stüek
derselben (6.) Emission, Serie 1 (55),
2 (2), 3 (18), 4 (14), 5 (10), 6 (8), 7 (18).
Daneben kommen noch folgende Prage-
stätten vor: London I (33), Lyon I (6),
ferner vereinzelt Aquileia I u. II, Siscia
I u. III, Arles, Rom III und einigeandere.
18. Crispus, 131 Stück, ebenfalls meist aus
der Prâge Trier, 6. Emission. Trier I
(41 Stück) : Serie 1 (4), 2 (2), 3 (2), 4 (4),
5 (27), 6 (2). Aus Trier II (52 Stück) :
Serie 1 (26), 3 (8), 4 (6), 5 (8), 6 (4).
Ferner sind vereinzelt vertreten die
Prägestätten: Rom III (3), Siscia, Lyon
1(2), London I (16), Arles (2), Thessa-
lonica und auch Tarraco.
19. Constantinus Junior, 91 Stück meist
derselben Prâge und Emission. Aus
der Präge Trier I 29 Stiick: Serie 1 (5),
4 (6), 5(14), 6.(3) und 7 (29). Aus der
Präge Trier II 39 Stück: Serie 1 (16),
4 (3)1 5 (16) und 4 (4). FernerLondon I
(21) und vereinzelt Lyon I, Aquileia I
und III und Siscia III (3).
Es entstammt also die grôssere Masse
der Miinzen aus den Trierer Prägestätten
der Zeit Constantins I und des Crispus.
So viel sich jetzt schon sagen lâsst, ist
kein Stiick aus einer Emission, die spâter
stadter Brüchen) von 1,30 m Hôhe. Die
darauf ziemlich flach eingehauene, daher
auch zum Teil kaum mehr lesbare Inschrift
Iautet (mit den Ergânzungen des abge-
schlagenen linken Rands wiedergegeben) :
IfoviJ O(ptimo) MfaximoJ IN HfonoremJ
DfomusJ Dfioinae) [T(itus)] AELfius) VJC-
TO[R Q] VOD VO VE[RA T] INS VO MON[ V-
MENTVMJ POSVIT [Vfotum) S(olvit)]
L(aetus) Lfibens) Mferilo).
Der Dedikant ist sicher identisch mit
dem Stifter des Dreigôttersteins, ebenso
das Denkmal, das er hier erwâhnt, die Jup-
pitersäule, deren Sockel der Dreigôtterstein
bildete. Die zwei Steine und noch einige
unwichtigere Bauglieder, wie ein Sâulen-
kapitell mit Abakusplatte, zwei profilierte
Basen usw. liegen alle in einem unmotiviert
tiefen Loch im Graben, das nicht mit der
Uranlage zusammenhângen kann. Nach Auf-
gabe des Kastells als militârische Anlage,
hat dicht daneben T. Aelius Victor gewohnt
und in den Graben hier einen Keller ge-
setzt, für dessen eine Wand er die massive
Kastellmauer benützt hat, welche hier mit
Rücksicht auf die Schwierigkeit des jah
abfallenden Gelândes sehr tief eingesetzt ist.
Die anderen Kellerwande scheinen mit Holz
abgespriesst gewesen zu sein.
(Nach den Berichten von P. Goessler
in der „Schwäbischen Kronik“, 11. und
13. Okt. 1911.)
5. Betteldorf (Kr. Daun). Rômischer
Münzschatzfund. Das Provinzialmu-
seum in Trier ist kürzlich wiederum in den
Besitz eines Münzschatzfundes gekommen,
der seiner Zusammensetzung nach hier vor-
läufig kurze Erwâhnung finden mag.
Die Fundstelle liegt in der Eifel am
südöstlichen Fuss des Döhmberges, nôrd-
lich von dem Weg Dreis-Hillesheim, der
im Volksmunde „Römerstrasse“ heisst.
(Messtischblatt 3315). Im September 1911
wurde beim Pflügen auf altbestelltem Acker
— die Pflugsrhar war tiefer als sonst ge-
stellt — ein Topf angestossen, in dem der
Schatz geborgen gewesen, eine rômische
Urne der gewôhnlichen Art: grober, grau-
gelber Ton, das Randprofil mit Deckelnute.
Der Inhalt ward dabei zerstreut, wurde
àber sorgfâltig aufgelesen und kam (bis
auf ein paar Stücke) vollstândig in unsern
Besitz: 43 Denare und 577 Kleinbronzen,
welche letztere durchweg gut erhalten und
z. T. mit Silbersud versehen sind.
Die Denare, bis auf die letzten 3 Grup-
pen durchweg arg abgenutzt, waren folgende :
1. Gens Hosidia (1 Stück) = Babelon I
S. 547,i- (54 v. C.).
2. Galba (1) = Coh. 338 (vgl. 287) (59η.C.)
3. Vespasian (1) = Coh. 45 (72 od.73n.C.).
4. Titus (1) = Coh. 305 (80 n. C.).
5. Domitian (1) = Coh. 186 (85 n. C.).
6. Traian (4) = Coh. 216, 65. 75 und 190
(zwischen 100 u. 116 n. C.).
7. Hadrian (7) = Coh. 309 (398 var., 876 var.,
1123 var.), 1131, 1135 und eine fraglich.
8. Antoninus Pius (9) = Coh. 437, 344, 284,
196, 270 (2 ><r), 1021, 164 u. 156.
9. Faustina d. Ä. (3) = Coh. 78, 136, 124.
10. Faustina d. J. (2) = Coh. 99 u. 24.
11. Commodus (3) = Coh. 401, 842 und ein
schlecht erhaltener, fragl. Bestimmung.
12. Diocletianus (4) = Coh. 516 f, aber mit
Reverslegende wie 519 ff., zweimal mit
Prägezeichen D im Abschnitt.
13. Constantius I. Chlorus (3) = Coh. 312.
zwei mit Prägezeichen C, einer mit D.
14a. Maximianus (3) = Coh. 216 (2X) und
einer desgl., aber mit Averslegende
MAXIMIANVS AVG. Alle 3 mit Prâge-
zeichen D.
Die Kleinerze beschrânken sich auf
Prâgungen von Maximian, Licinius Vater
und Sohn, Constantin I, Crispus und Con-
stantin d. J.
14b. Maximian (3 Stück) mit den Prâge-
zeichen TR unter A [C?], und D.
15. Licinius d. Ä. (4) aus der Prâge Trierl
(2) der 6. Emission 2. Serie u. Trier II
(2) der 5. Emission 1. Serie.
16. Licinius d. J. (9) aus der Präge Trier I
(5) der 6. Emission 1., 2. u. 7. Serie,
aus Trierll (2) der 6. Emission 1. Serie,
ferner Arles IV (1) 4. Em. 2. Serie und
Thessalonica V (1) 7. Em. 2. Serie.
17. Constantin I. (336 Stück). Aus der
Präge Trier I ca. 116 Stück, die sich
auf die 6. Emission wie folgt verteilen:
Serie 1 (43), 2 (7), 3 (23), 4 (22), 5 (4),
6 (14), 7 (3)· [Vielleicht kommt dazu
noch Serie 8 mit 1 Stück.J
Aus der Präge Trier II etwa 135 Stüek
derselben (6.) Emission, Serie 1 (55),
2 (2), 3 (18), 4 (14), 5 (10), 6 (8), 7 (18).
Daneben kommen noch folgende Prage-
stätten vor: London I (33), Lyon I (6),
ferner vereinzelt Aquileia I u. II, Siscia
I u. III, Arles, Rom III und einigeandere.
18. Crispus, 131 Stück, ebenfalls meist aus
der Prâge Trier, 6. Emission. Trier I
(41 Stück) : Serie 1 (4), 2 (2), 3 (2), 4 (4),
5 (27), 6 (2). Aus Trier II (52 Stück) :
Serie 1 (26), 3 (8), 4 (6), 5 (8), 6 (4).
Ferner sind vereinzelt vertreten die
Prägestätten: Rom III (3), Siscia, Lyon
1(2), London I (16), Arles (2), Thessa-
lonica und auch Tarraco.
19. Constantinus Junior, 91 Stück meist
derselben Prâge und Emission. Aus
der Präge Trier I 29 Stiick: Serie 1 (5),
4 (6), 5(14), 6.(3) und 7 (29). Aus der
Präge Trier II 39 Stück: Serie 1 (16),
4 (3)1 5 (16) und 4 (4). FernerLondon I
(21) und vereinzelt Lyon I, Aquileia I
und III und Siscia III (3).
Es entstammt also die grôssere Masse
der Miinzen aus den Trierer Prägestätten
der Zeit Constantins I und des Crispus.
So viel sich jetzt schon sagen lâsst, ist
kein Stiick aus einer Emission, die spâter