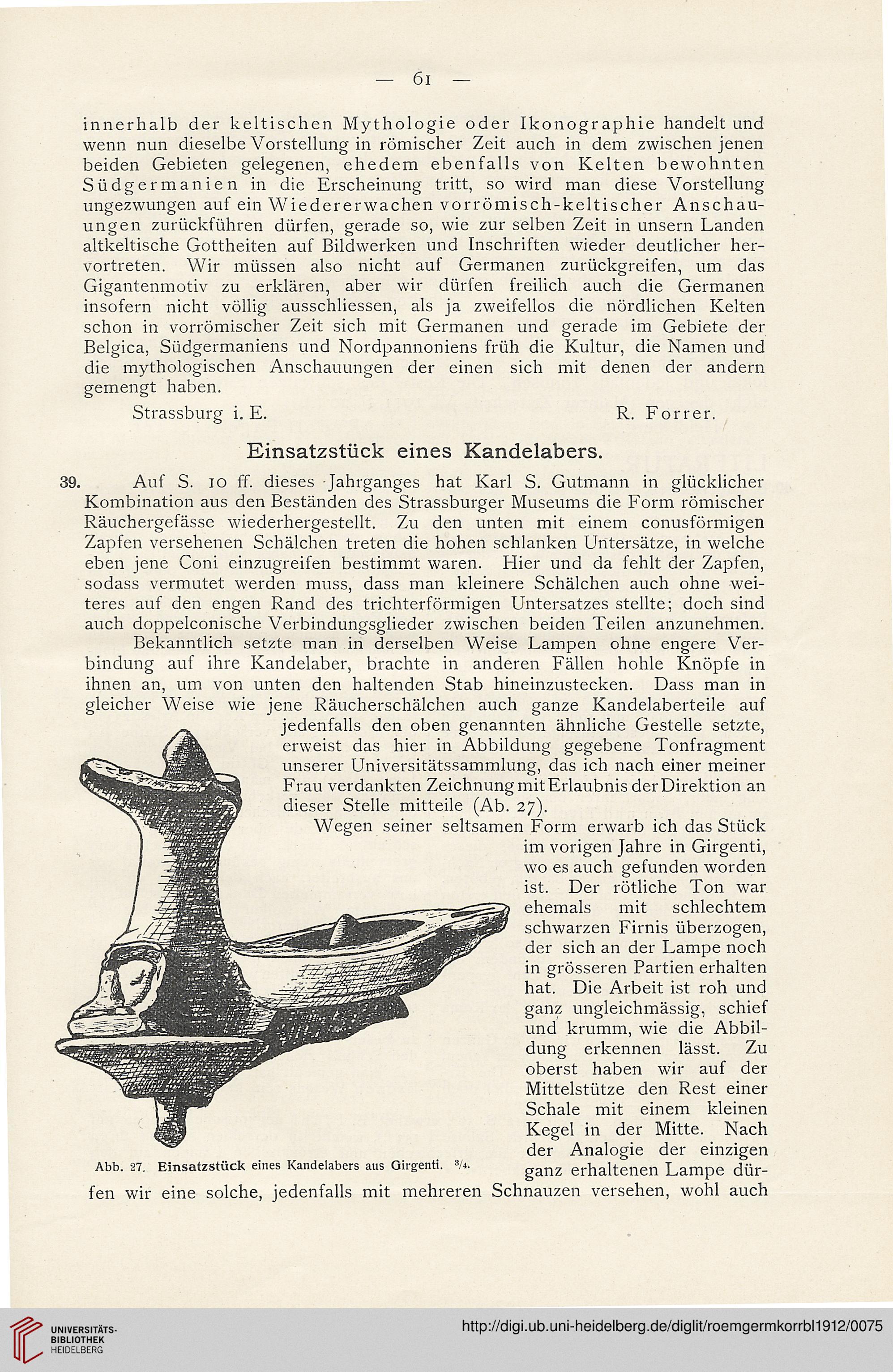innerhalb der keltischen Mythologie oder Ikonographie handelt und
wenn nun dieselbe Vorstellung in rômischer Zeit auch in dem zwischen jenen
beiden Gebieten gelegenen, ehedem ebenfalls von Kelten bewohnten
Südgermanien in die Erscheinung tritt, so wird man diese Vorstellung
ungezwungen auf ein Wiedererwachen vorrômisch-keltischer Anschau-
ungen zurückführen dürfen, gerade so, wie zur selben Zeit in unsern Landen
altkeltische Gottheiten auf Bildwerken und Inschriften wieder deutlicher her-
vortreten. Wir müssen also nicht auf Germanen zurückgreifen, um das
Gigantenmotiv zu erklâren, aber wir dürfen freilich auch die Germanen
insofern nicht völlig ausschliessen, als ja zweifellos die nôrdlichen Kelten
schon in vorrômischer Zeit sich mit Germanen und gerade im Gebiete der
Belgica, Siidgermaniens und Nordpannoniens früh die Kultur, die Namen und
die mythologischen Anschauungen der einen sich mit denen der andern
gemengt haben.
Strassburg i. E. R. Forrer.
Einsatzstück eines Kandelabers.
39. Auf S. io ff. dieses Jahrganges hat Karl S. Gutmann in glücklicher
Kombination aus den Beständen des Strassburger Museums die Form rômischer
Räuchergefässe wiederhergestellt. Zu den unten mit einem conusfôrmigen
Zapfen versehenen Schälchen treten die hohen schlanken Untersâtze, in welche
eben jene Coni einzugreifen bestimmt waren. Hier und da fehlt der Zapfen,
sodass vermutet werden muss, dass man kleinere Schâlchen auch ohne wei-
teres auf den engen Rand des trichterfôrmigen Untersatzes stellte; doch sind
auch doppelconische Verbindungsglieder zwischen beiden Teilen anzunehmen.
Bekanntlich setzte man in derselben Weise Lampen ohne engere Ver-
bindung auf ihre Kandelaber, brachte in anderen Fällen hohle Knôpfe in
ihnen an, um von unten den haltenden Stab hineinzustecken. Dass man in
gleicher Weise wie jene Räucherschälchen auch ganze Kandelaberteile auf
jedenfalls den oben genannten âhnliche Gestelle setzte,
erweist das hier in Abbildung gegebene Tonfragment
unserer Universitâtssammlung, das ich nach einer meiner
Frau verdankten ZeichnungmitErlaubnis derDirektion an
dieser Stelle mitteile (Ab. 27).
Wegen seiner seltsamen Form erwarb ich das Stück
im vorigen Jahre in Girgenti,
wo es auch gefunden worden
ist. Der rôtliche Ton war
ehemals mit schlechtem
schwarzen Firnis überzogen,
der sich an der Lampe noch
in grôsseren Partien erhalten
hat. Die Arbeit ist roh und
ganz ungleichmâssig, schief
und krumm, wie die Abbil-
dung erkennen lâsst. Zu
oberst haben wir auf der
Mittelstütze den Rest einer
Schale mit einem kleinen
Kegel in der Mitte. Nach
der Analogie der einzigen
Abb. 27. Einsatzstück eines Kandelabers aus Oirgenti. 3/â. ganz erhaltenen Lampe dür-
fen wir eine solche, jedenfalls mit mehreren Schnauzen versehen, wohl auch
wenn nun dieselbe Vorstellung in rômischer Zeit auch in dem zwischen jenen
beiden Gebieten gelegenen, ehedem ebenfalls von Kelten bewohnten
Südgermanien in die Erscheinung tritt, so wird man diese Vorstellung
ungezwungen auf ein Wiedererwachen vorrômisch-keltischer Anschau-
ungen zurückführen dürfen, gerade so, wie zur selben Zeit in unsern Landen
altkeltische Gottheiten auf Bildwerken und Inschriften wieder deutlicher her-
vortreten. Wir müssen also nicht auf Germanen zurückgreifen, um das
Gigantenmotiv zu erklâren, aber wir dürfen freilich auch die Germanen
insofern nicht völlig ausschliessen, als ja zweifellos die nôrdlichen Kelten
schon in vorrômischer Zeit sich mit Germanen und gerade im Gebiete der
Belgica, Siidgermaniens und Nordpannoniens früh die Kultur, die Namen und
die mythologischen Anschauungen der einen sich mit denen der andern
gemengt haben.
Strassburg i. E. R. Forrer.
Einsatzstück eines Kandelabers.
39. Auf S. io ff. dieses Jahrganges hat Karl S. Gutmann in glücklicher
Kombination aus den Beständen des Strassburger Museums die Form rômischer
Räuchergefässe wiederhergestellt. Zu den unten mit einem conusfôrmigen
Zapfen versehenen Schälchen treten die hohen schlanken Untersâtze, in welche
eben jene Coni einzugreifen bestimmt waren. Hier und da fehlt der Zapfen,
sodass vermutet werden muss, dass man kleinere Schâlchen auch ohne wei-
teres auf den engen Rand des trichterfôrmigen Untersatzes stellte; doch sind
auch doppelconische Verbindungsglieder zwischen beiden Teilen anzunehmen.
Bekanntlich setzte man in derselben Weise Lampen ohne engere Ver-
bindung auf ihre Kandelaber, brachte in anderen Fällen hohle Knôpfe in
ihnen an, um von unten den haltenden Stab hineinzustecken. Dass man in
gleicher Weise wie jene Räucherschälchen auch ganze Kandelaberteile auf
jedenfalls den oben genannten âhnliche Gestelle setzte,
erweist das hier in Abbildung gegebene Tonfragment
unserer Universitâtssammlung, das ich nach einer meiner
Frau verdankten ZeichnungmitErlaubnis derDirektion an
dieser Stelle mitteile (Ab. 27).
Wegen seiner seltsamen Form erwarb ich das Stück
im vorigen Jahre in Girgenti,
wo es auch gefunden worden
ist. Der rôtliche Ton war
ehemals mit schlechtem
schwarzen Firnis überzogen,
der sich an der Lampe noch
in grôsseren Partien erhalten
hat. Die Arbeit ist roh und
ganz ungleichmâssig, schief
und krumm, wie die Abbil-
dung erkennen lâsst. Zu
oberst haben wir auf der
Mittelstütze den Rest einer
Schale mit einem kleinen
Kegel in der Mitte. Nach
der Analogie der einzigen
Abb. 27. Einsatzstück eines Kandelabers aus Oirgenti. 3/â. ganz erhaltenen Lampe dür-
fen wir eine solche, jedenfalls mit mehreren Schnauzen versehen, wohl auch