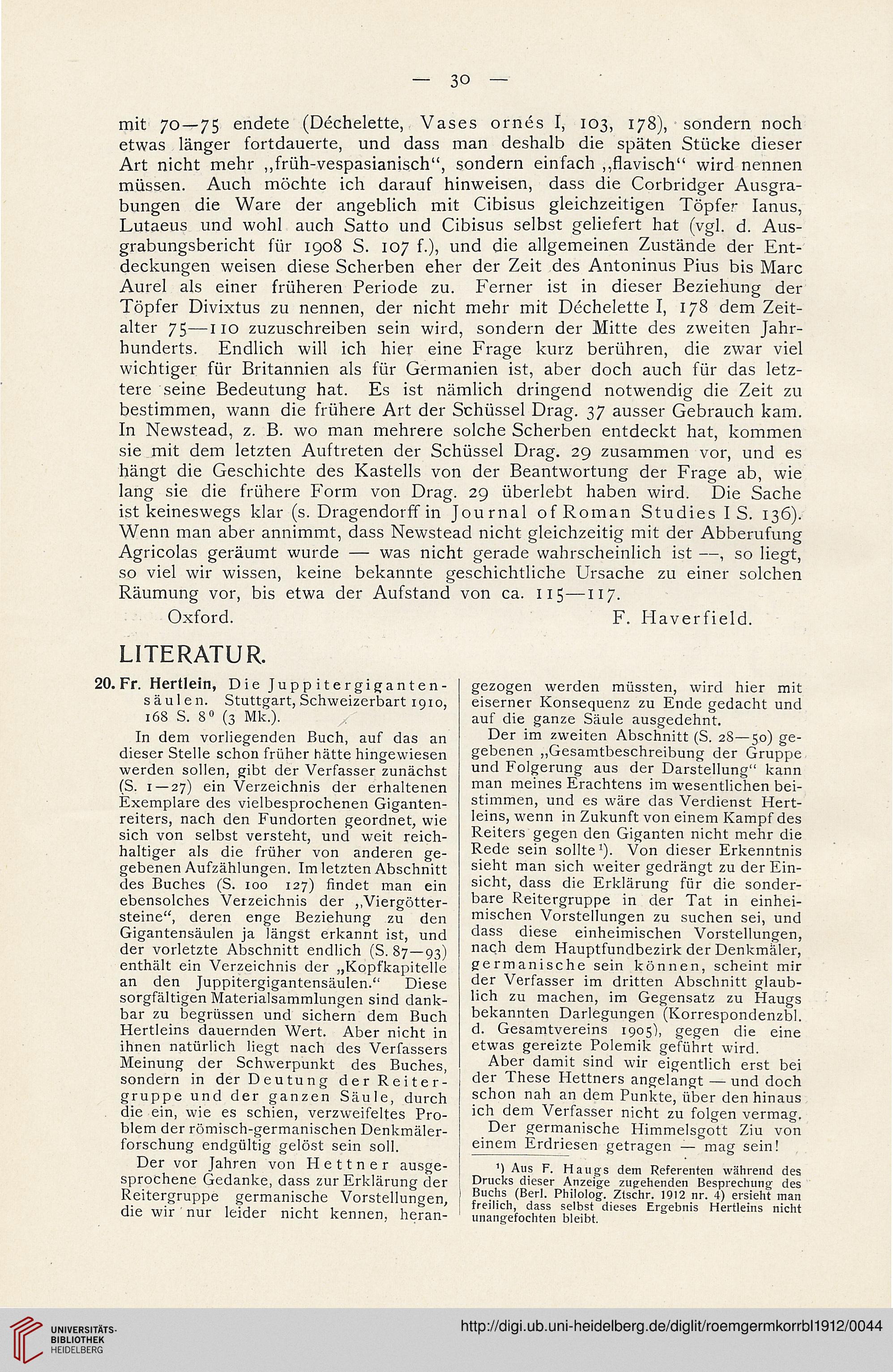30
mit 70 —75 endete (Déchelette, Vases ornés I, 103, 178), sondern noch
etwas länger fortdauerte, und dass man deshalb die spâten Stücke dieser
Art nicht mehr „früh-vespasianisch“, sondern einfach „flavisch“ wird nennen
müssen. Auch môchte ich darauf hinweisen, dass die Corbridger Ausgra-
bungen die Ware der angeblich mit Cibisus gleichzeitigen Tôpfer Ianus,
Lutaeus und wohl auch Satto und Cibisus selbst geliefert hat (vgl. d. Aus-
grabungsbericht für 1908 S. 107 f.), und die allgemeinen Zustânde der Ent-
deckungen weisen diese Scherben eher der Zeit des Antoninus Pius bis Marc
Aurel als einer früheren Periode zu. P'erner ist in dieser Beziehung der
Tôpfer Divixtus zu nennen, der nicht mehr mit Déchelette I, 178 dem Zeit-
alter 75—110 zuzuschreiben sein wird, sondern der Mitte des zweiten Jahr-
hunderts. Endlich will ich hier eine Frage kurz berühren, die zwar viel
wichtiger für Britannien als für Germanien ist, aber doch auch für das letz-
tere seine Bedeutung hat. Es ist nâmlich dringend notwendig die Zeit zu
bestimmen, wann die frühere Art der Schüssel Drag. 37 ausser Gebrauch kam.
In Newstead, z. B. wo man mehrere solche Scherben entdeckt hat, kommen
sie mit dem letzten Auftreten der Schüssel Drag. 29 zusammen vor, und es
hângt die Geschichte des Kastells von der Beantwortung der Frage ab, wie
lang sie die frühere F'orm von Drag. 29 überlebt haben wird. Die Sache
ist keineswegs klar (s. Dragendorff in Journal of Roman Studies I S. 136).
Wenn man aber annimmt, dass Newstead nicht gleichzeitig mit der Abberufung
Agricolas gerâumt wurde — was nicht gerade wahrscheinlich ist —, so liegt,
so viel wir wissen, keine bekannte geschichtliche Ursache zu einer solchen
Râumung vor, bis etwa der Aufstand von ca. 115—117.
Oxford. F. Haverfield.
LITERATUR.
20. Fr. Hertlein, Die Juppitergiganten-
sâulen. Stuttgart,Schweizerbart igio,
168 S. 8° (3 Mk.).
In dem vorliegenden Buch, auf das an
dieser Stelle schon früher hatte hingewiesen
werden sollen, gibt der Verfasser zunâchst
(S. i—27) ein Verzeichnis der erhaltenen
Exemplare des vielbesprochenen Giganten-
reiters, nach den Fundorten geordnet, wie
sich von selbst versteht, und weit reich-
haltiger als die früher von anderen ge-
gebenen Aufzâhlungen. Im letzten Abschnitt
des Buches (S. 100 127) findet man ein
ebensolches Verzeichnis der „Viergötter-
steine“, deren enge Beziehung zu den
Gigantensäulen ja lângst erkannt ist, und
der vorletzte Abschnitt endlich (S. 87—93)
enthält ein Verzeichnis der „Kopfkapitelle
an den Juppitergigantensäulen.“ Diese
sorgfâltigen Materialsammlungen sind dank-
bar zu begrüssen und sichern dem Buch
Hertleins dauernden Wert. Aber nicht in
ihnen natürlich liegt nach des Verfassers
Meinung der Schwerpunkt des Buches,
sondern in der Deutung der Reiter-
gruppe und der ganzen Saule, durch
die ein, wie es schien, verzweifeltes Pro-
blem der römisch-germanischen Denkmâler-
forschung endgültig gelôst sein soll.
Der vor Jahren von H e 11 n e r ausge-
sprochene Gedanke, dass zur Erklarung der
Reitergruppe germanische Vorstellungen,
die wir nur leider nicht kennen, heran-
gezogen werden müssten, wird hier mit
eiserner Konsequenz zu Ende gedacht und
auf die ganze Saule ausgedehnt.
Der im zweiten Abschnitt (S. 28—50) ge-
gebenen „Gesamtbeschreibung der Gruppe
und Folgerung aus der Darsteilung“ kann
man meines Erachtens im wesentlichen bei-
stimmen, und es wâre das Verdienst Hert-
leins, wenn in Zukunft von einem Kampf des
Reiters gegen den Giganten nicht mehr die
Rede sein sollte 1). Von dieser Erkenntnis
sieht man sich weiter gedrângt zu der Ein-
sicht, dass die Erklârung für die sonder-
bare Reitergruppe in der Tat in einhei-
mischen Vorstellungen zu suchen sei, und
dass diese einheimischen Vorstellungen,
nach dem Hauptfundbezirk der Denkmaler,
germanische sein kônnen, scheint mir
der Verfasser im dritten Abschnitt glaub-
lich zu machen, im Gegensatz zu Haugs
bekannten Darlegungen (Korrespondenzbl.
d. Gesamtvereins 1905), gegen die eine
eturas gereizte Polemik geführt wird.
Aber damit sind wir eigentüch erst bei
der These Hettners angelangt — und doch
schon nah an dem Punkte, über den hinaus
ich dem Verfasser nicht zu folgen vermag.
Der germanische Himmelsgott Ziu von
einem Erdriesen getragen — mag sein!
') Aus F. Haugs dera Referenten wâhrend des
Drucks dieser Anzeige zugehenden Besprechung des
j Buchs (Berl. Philolog. Ztschr. 1912 nr. 4) ersieht man
freilich, dass selbst dieses Ergebnis Hertleins nicht
unangefochten bleibt.
mit 70 —75 endete (Déchelette, Vases ornés I, 103, 178), sondern noch
etwas länger fortdauerte, und dass man deshalb die spâten Stücke dieser
Art nicht mehr „früh-vespasianisch“, sondern einfach „flavisch“ wird nennen
müssen. Auch môchte ich darauf hinweisen, dass die Corbridger Ausgra-
bungen die Ware der angeblich mit Cibisus gleichzeitigen Tôpfer Ianus,
Lutaeus und wohl auch Satto und Cibisus selbst geliefert hat (vgl. d. Aus-
grabungsbericht für 1908 S. 107 f.), und die allgemeinen Zustânde der Ent-
deckungen weisen diese Scherben eher der Zeit des Antoninus Pius bis Marc
Aurel als einer früheren Periode zu. P'erner ist in dieser Beziehung der
Tôpfer Divixtus zu nennen, der nicht mehr mit Déchelette I, 178 dem Zeit-
alter 75—110 zuzuschreiben sein wird, sondern der Mitte des zweiten Jahr-
hunderts. Endlich will ich hier eine Frage kurz berühren, die zwar viel
wichtiger für Britannien als für Germanien ist, aber doch auch für das letz-
tere seine Bedeutung hat. Es ist nâmlich dringend notwendig die Zeit zu
bestimmen, wann die frühere Art der Schüssel Drag. 37 ausser Gebrauch kam.
In Newstead, z. B. wo man mehrere solche Scherben entdeckt hat, kommen
sie mit dem letzten Auftreten der Schüssel Drag. 29 zusammen vor, und es
hângt die Geschichte des Kastells von der Beantwortung der Frage ab, wie
lang sie die frühere F'orm von Drag. 29 überlebt haben wird. Die Sache
ist keineswegs klar (s. Dragendorff in Journal of Roman Studies I S. 136).
Wenn man aber annimmt, dass Newstead nicht gleichzeitig mit der Abberufung
Agricolas gerâumt wurde — was nicht gerade wahrscheinlich ist —, so liegt,
so viel wir wissen, keine bekannte geschichtliche Ursache zu einer solchen
Râumung vor, bis etwa der Aufstand von ca. 115—117.
Oxford. F. Haverfield.
LITERATUR.
20. Fr. Hertlein, Die Juppitergiganten-
sâulen. Stuttgart,Schweizerbart igio,
168 S. 8° (3 Mk.).
In dem vorliegenden Buch, auf das an
dieser Stelle schon früher hatte hingewiesen
werden sollen, gibt der Verfasser zunâchst
(S. i—27) ein Verzeichnis der erhaltenen
Exemplare des vielbesprochenen Giganten-
reiters, nach den Fundorten geordnet, wie
sich von selbst versteht, und weit reich-
haltiger als die früher von anderen ge-
gebenen Aufzâhlungen. Im letzten Abschnitt
des Buches (S. 100 127) findet man ein
ebensolches Verzeichnis der „Viergötter-
steine“, deren enge Beziehung zu den
Gigantensäulen ja lângst erkannt ist, und
der vorletzte Abschnitt endlich (S. 87—93)
enthält ein Verzeichnis der „Kopfkapitelle
an den Juppitergigantensäulen.“ Diese
sorgfâltigen Materialsammlungen sind dank-
bar zu begrüssen und sichern dem Buch
Hertleins dauernden Wert. Aber nicht in
ihnen natürlich liegt nach des Verfassers
Meinung der Schwerpunkt des Buches,
sondern in der Deutung der Reiter-
gruppe und der ganzen Saule, durch
die ein, wie es schien, verzweifeltes Pro-
blem der römisch-germanischen Denkmâler-
forschung endgültig gelôst sein soll.
Der vor Jahren von H e 11 n e r ausge-
sprochene Gedanke, dass zur Erklarung der
Reitergruppe germanische Vorstellungen,
die wir nur leider nicht kennen, heran-
gezogen werden müssten, wird hier mit
eiserner Konsequenz zu Ende gedacht und
auf die ganze Saule ausgedehnt.
Der im zweiten Abschnitt (S. 28—50) ge-
gebenen „Gesamtbeschreibung der Gruppe
und Folgerung aus der Darsteilung“ kann
man meines Erachtens im wesentlichen bei-
stimmen, und es wâre das Verdienst Hert-
leins, wenn in Zukunft von einem Kampf des
Reiters gegen den Giganten nicht mehr die
Rede sein sollte 1). Von dieser Erkenntnis
sieht man sich weiter gedrângt zu der Ein-
sicht, dass die Erklârung für die sonder-
bare Reitergruppe in der Tat in einhei-
mischen Vorstellungen zu suchen sei, und
dass diese einheimischen Vorstellungen,
nach dem Hauptfundbezirk der Denkmaler,
germanische sein kônnen, scheint mir
der Verfasser im dritten Abschnitt glaub-
lich zu machen, im Gegensatz zu Haugs
bekannten Darlegungen (Korrespondenzbl.
d. Gesamtvereins 1905), gegen die eine
eturas gereizte Polemik geführt wird.
Aber damit sind wir eigentüch erst bei
der These Hettners angelangt — und doch
schon nah an dem Punkte, über den hinaus
ich dem Verfasser nicht zu folgen vermag.
Der germanische Himmelsgott Ziu von
einem Erdriesen getragen — mag sein!
') Aus F. Haugs dera Referenten wâhrend des
Drucks dieser Anzeige zugehenden Besprechung des
j Buchs (Berl. Philolog. Ztschr. 1912 nr. 4) ersieht man
freilich, dass selbst dieses Ergebnis Hertleins nicht
unangefochten bleibt.