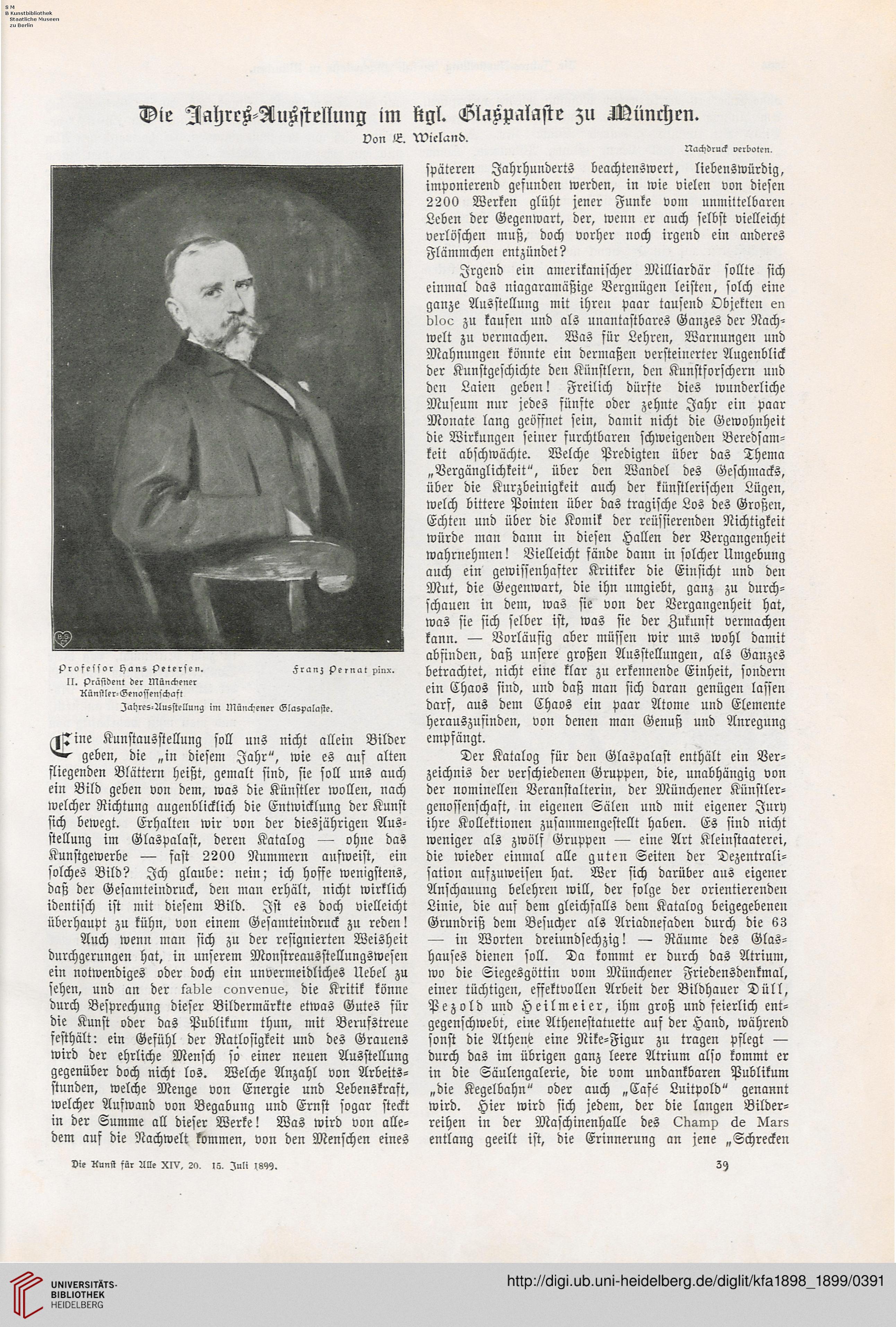Die MhrcB-Au^etlung im Kgl. Gläppalafle zu München.
von E. Wieland. N chd ck
Professor Hans pelersen. jranz perna! xiax.
Aünstler-Genossenschaft
Iahres-Ausstellung im Münchener Glaspalaste.
(«I?'ine Kunstausstellung soll uns nicht allein Bilder
geben, die „in diesem Jahr", wie es auf alten
fliegenden Blättern heißt, gemalt sind, sie soll uns auch
ein Bild geben von dem, was die Künstler wollen, nach
welcher Richtung augenblicklich die Entwicklung der Kunst
sich bewegt. Erhalten wir von der diesjährigen Aus-
stellung im Glaspalast, deren Katalog — ohne das
Kunstgewerbe — fast 2200 Nummern aufweist, ein
solches Bild? Ich glaube: nein; ich hoffe wenigstens,
daß der Gesamteindruck, den man erhält, nicht wirklich
identisch ist mit diesem Bild. Ist es doch vielleicht
überhaupt zu kühn, von einem Gesamteindruck zu reden!
Auch wenn man sich zu der resignierten Weisheit
durchgerungen hat, in unserem Monstreausstellungswesen
ein notwendiges oder doch ein unvermeidliches Uebel zu
sehen, und an der fable convenue, die Kritik könne
durch Besprechung dieser Bildermärkte etwas Gutes für
die Kunst oder das Publikum thun, mit Berufstreue
festhält: ein Gefühl der Ratlosigkeit und des Grauens
wird der ehrliche Mensch so einer neuen Ausstellung
gegenüber doch nicht los. Welche Anzahl von Arbeits-
stunden, welche Menge von Energie und Lebenskraft,
welcher Aufwand von Begabung und Ernst sogar steckt
in der Summe all dieser Werke! Was wird von alle-
dem auf die Nachwelt kommen, von den Menschen eines
späteren Jahrhunderts beachtenswert, liebenswürdig,
imponierend gefunden werden, in wie vielen von diesen
2200 Werken glüht jener Funke vom unmittelbaren
Leben der Gegenwart, der, wenn er auch selbst vielleicht
verlöschen muß, doch vorher noch irgend ein anderes
Flämmchen entzündet?
Irgend ein amerikanischer Milliardär sollte sich
einmal das niagaramäßige Vergnügen leisten, solch eine
ganze Ausstellung mit ihren Paar tausend Objekten en
bloc zu kaufen und als unantastbares Ganzes der Nach-
welt zu vermachen. Was für Lehren, Warnungen und
Mahnungen könnte ein dermaßen versteinerter Augenblick
der Kunstgeschichte den Künstlern, den Kunstforschern und
den Laien geben! Freilich dürfte dies wunderliche
Museum nur jedes fünfte oder zehnte Jahr ein paar
Monate lang geöffnet sein, damit nicht die Gewohnheit
die Wirkungen seiner furchtbaren schweigenden Beredsam-
keit abschwächte. Welche Predigten über das Thema
„Vergänglichkeit", über den Wandel des Geschmacks,
über die Kurzbeinigkeit auch der künstlerischen Lügen,
welch bittere Pointen über das tragische Los des Großen,
Echten und über die Komik der reüssierenden Nichtigkeit
würde man dann in diesen Hallen der Vergangenheit
wahrnehmen! Vielleicht fände dann in solcher Umgebung
auch ein gewissenhafter Kritiker die Einsicht und den
Mut, die Gegenwart, die ihn umgiebt, ganz zu durch-
schauen in dem, was sie von der Vergangenheit hat,
was sie sich selber ist, was sie der Zukunft vermachen
kann. — Vorläufig aber müssen wir uns wohl damit
abfinden, daß unsere großen Ausstellungen, als Ganzes
betrachtet, nicht eine klar zu erkennende Einheit, sondern
ein Chaos sind, und daß man sich daran genügen lassen
darf, aus dem Chaos ein Paar Atome und Elemente
herauszufinden, von denen man Genuß und Anregung
empfängt.
Der Katalog für den Glaspalast enthält ein Ver-
zeichnis der verschiedenen Gruppen, die, unabhängig von
der nominellen Veranstalterin, der Münchener Künstler-
genossenschaft, in eigenen Sälen und mit eigener Jury
ihre Kollektionen zusammengestellt haben. Es sind nicht
weniger als zwölf Gruppen — eine Art Kleinstaaterei,
die wieder einmal alle guten Seiten der Dezentrali-
sation aufzuweisen hat. Wer sich darüber aus eigener
Anschauung belehren will, der folge der orientierenden
Linie, die auf dem gleichfalls dem Katalog beigegebenen
Grundriß dem Besucher als Ariadnefaden durch die 63
— in Worten dreiundsechzig! — Räume des Glas-
hauses dienen soll. Da kommt er durch das Atrium,
wo die Siegesgöttin vom Münchener Friedensdenkmal,
einer tüchtigen, effektvollen Arbeit der Bildhauer Düll,
Pezold und Heilmeier, ihm groß und feierlich ent-
gegenschwebt, eine Athenestatuette auf der Hand, während
sonst die Athenb eine Nike-Figur zu tragen pflegt —
durch das im übrigen ganz leere Atrium also kommt er
in die Säulengalerie, die vom undankbaren Publikum
„die Kegelbahn" oder auch „Cafe Luitpold" genannt
wird. Hier wird sich jedem, der die langen Bilder-
reihen in der Maschinenhalle des Lkaiiip cle lAars
entlang geeilt ist, die Erinnerung an jene „Schrecken
Die UllnS für Alle XIV, 20. >5. Juli 1844.