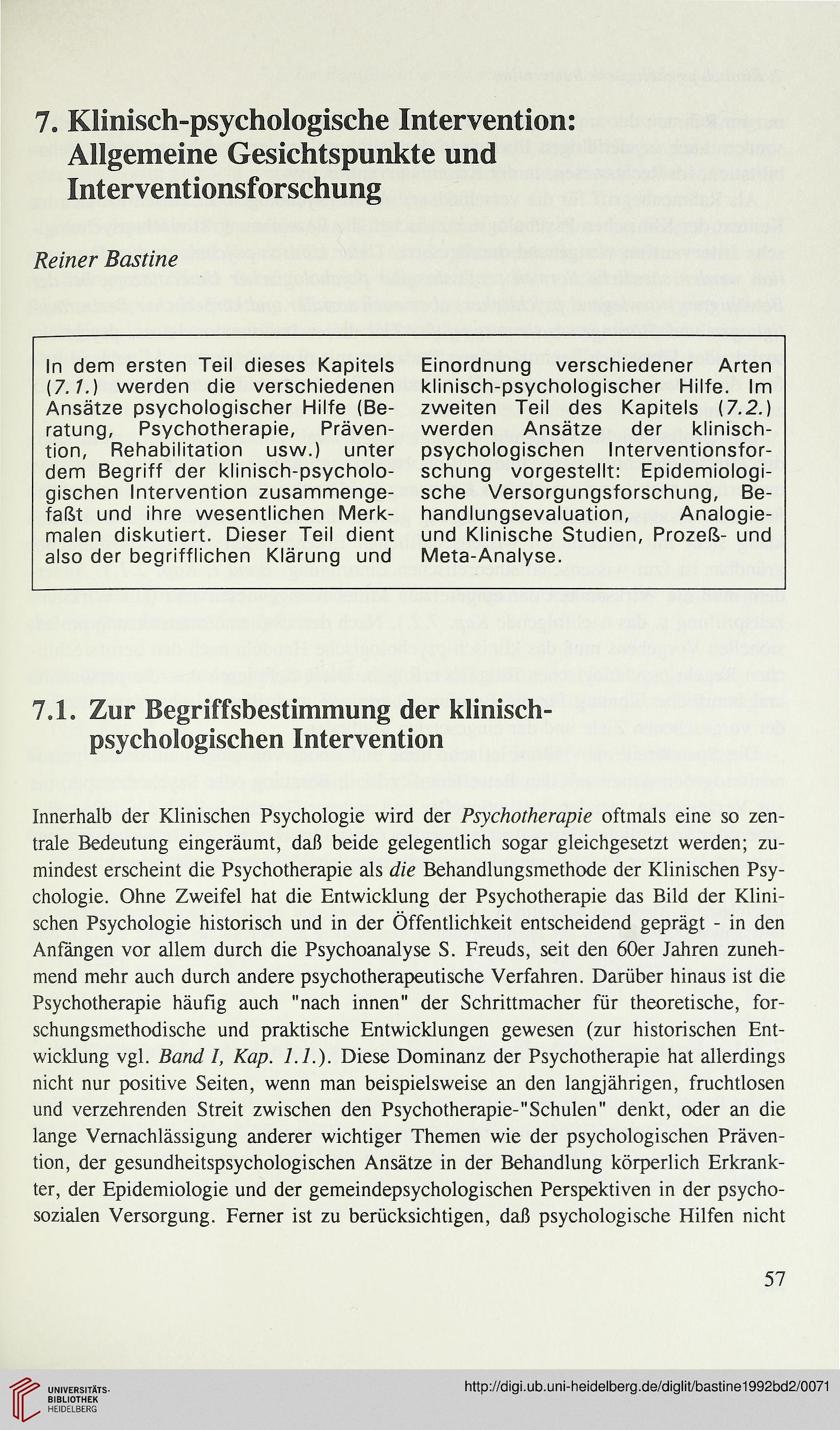7. Klinisch-psychologische Intervention:
Allgemeine Gesichtspunkte und
Interventionsforschung
Reiner Bastine
In dem ersten Teil dieses Kapitels
(7.7.) werden die verschiedenen
Ansätze psychologischer Hilfe (Be-
ratung, Psychotherapie, Präven-
tion, Rehabilitation usw.) unter
dem Begriff der klinisch-psycholo-
gischen Intervention zusammenge-
faßt und ihre wesentlichen Merk-
malen diskutiert. Dieser Teil dient
also der begrifflichen Klärung und
Einordnung verschiedener Arten
klinisch-psychologischer Hilfe. Im
zweiten Teil des Kapitels (7.2.)
werden Ansätze der klinisch-
psychologischen Interventionsfor-
schung vorgestellt: Epidemiologi-
sche Versorgungsforschung, Be-
handlungsevaluation, Analogie-
und Klinische Studien, Prozeß- und
Meta-Analyse.
7.1. Zur Begriffsbestimmung der klinisch-
psychologischen Intervention
Innerhalb der Klinischen Psychologie wird der Psychotherapie oftmals eine so zen-
trale Bedeutung eingeräumt, daß beide gelegentlich sogar gleichgesetzt werden; zu-
mindest erscheint die Psychotherapie als die Behandlungsmethode der Klinischen Psy-
chologie. Ohne Zweifel hat die Entwicklung der Psychotherapie das Bild der Klini-
schen Psychologie historisch und in der Öffentlichkeit entscheidend geprägt - in den
Anfängen vor allem durch die Psychoanalyse S. Freuds, seit den 60er Jahren zuneh-
mend mehr auch durch andere psychotherapeutische Verfahren. Darüber hinaus ist die
Psychotherapie häufig auch "nach innen" der Schrittmacher für theoretische, for-
schungsmethodische und praktische Entwicklungen gewesen (zur historischen Ent-
wicklung vgl. Band I, Kap. 7.7.). Diese Dominanz der Psychotherapie hat allerdings
nicht nur positive Seiten, wenn man beispielsweise an den langjährigen, fruchtlosen
und verzehrenden Streit zwischen den Psychotherapie-"Schulen" denkt, oder an die
lange Vernachlässigung anderer wichtiger Themen wie der psychologischen Präven-
tion, der gesundheitspsychologischen Ansätze in der Behandlung körperlich Erkrank-
ter, der Epidemiologie und der gemeindepsychologischen Perspektiven in der psycho-
sozialen Versorgung. Ferner ist zu berücksichtigen, daß psychologische Hilfen nicht
57
Allgemeine Gesichtspunkte und
Interventionsforschung
Reiner Bastine
In dem ersten Teil dieses Kapitels
(7.7.) werden die verschiedenen
Ansätze psychologischer Hilfe (Be-
ratung, Psychotherapie, Präven-
tion, Rehabilitation usw.) unter
dem Begriff der klinisch-psycholo-
gischen Intervention zusammenge-
faßt und ihre wesentlichen Merk-
malen diskutiert. Dieser Teil dient
also der begrifflichen Klärung und
Einordnung verschiedener Arten
klinisch-psychologischer Hilfe. Im
zweiten Teil des Kapitels (7.2.)
werden Ansätze der klinisch-
psychologischen Interventionsfor-
schung vorgestellt: Epidemiologi-
sche Versorgungsforschung, Be-
handlungsevaluation, Analogie-
und Klinische Studien, Prozeß- und
Meta-Analyse.
7.1. Zur Begriffsbestimmung der klinisch-
psychologischen Intervention
Innerhalb der Klinischen Psychologie wird der Psychotherapie oftmals eine so zen-
trale Bedeutung eingeräumt, daß beide gelegentlich sogar gleichgesetzt werden; zu-
mindest erscheint die Psychotherapie als die Behandlungsmethode der Klinischen Psy-
chologie. Ohne Zweifel hat die Entwicklung der Psychotherapie das Bild der Klini-
schen Psychologie historisch und in der Öffentlichkeit entscheidend geprägt - in den
Anfängen vor allem durch die Psychoanalyse S. Freuds, seit den 60er Jahren zuneh-
mend mehr auch durch andere psychotherapeutische Verfahren. Darüber hinaus ist die
Psychotherapie häufig auch "nach innen" der Schrittmacher für theoretische, for-
schungsmethodische und praktische Entwicklungen gewesen (zur historischen Ent-
wicklung vgl. Band I, Kap. 7.7.). Diese Dominanz der Psychotherapie hat allerdings
nicht nur positive Seiten, wenn man beispielsweise an den langjährigen, fruchtlosen
und verzehrenden Streit zwischen den Psychotherapie-"Schulen" denkt, oder an die
lange Vernachlässigung anderer wichtiger Themen wie der psychologischen Präven-
tion, der gesundheitspsychologischen Ansätze in der Behandlung körperlich Erkrank-
ter, der Epidemiologie und der gemeindepsychologischen Perspektiven in der psycho-
sozialen Versorgung. Ferner ist zu berücksichtigen, daß psychologische Hilfen nicht
57