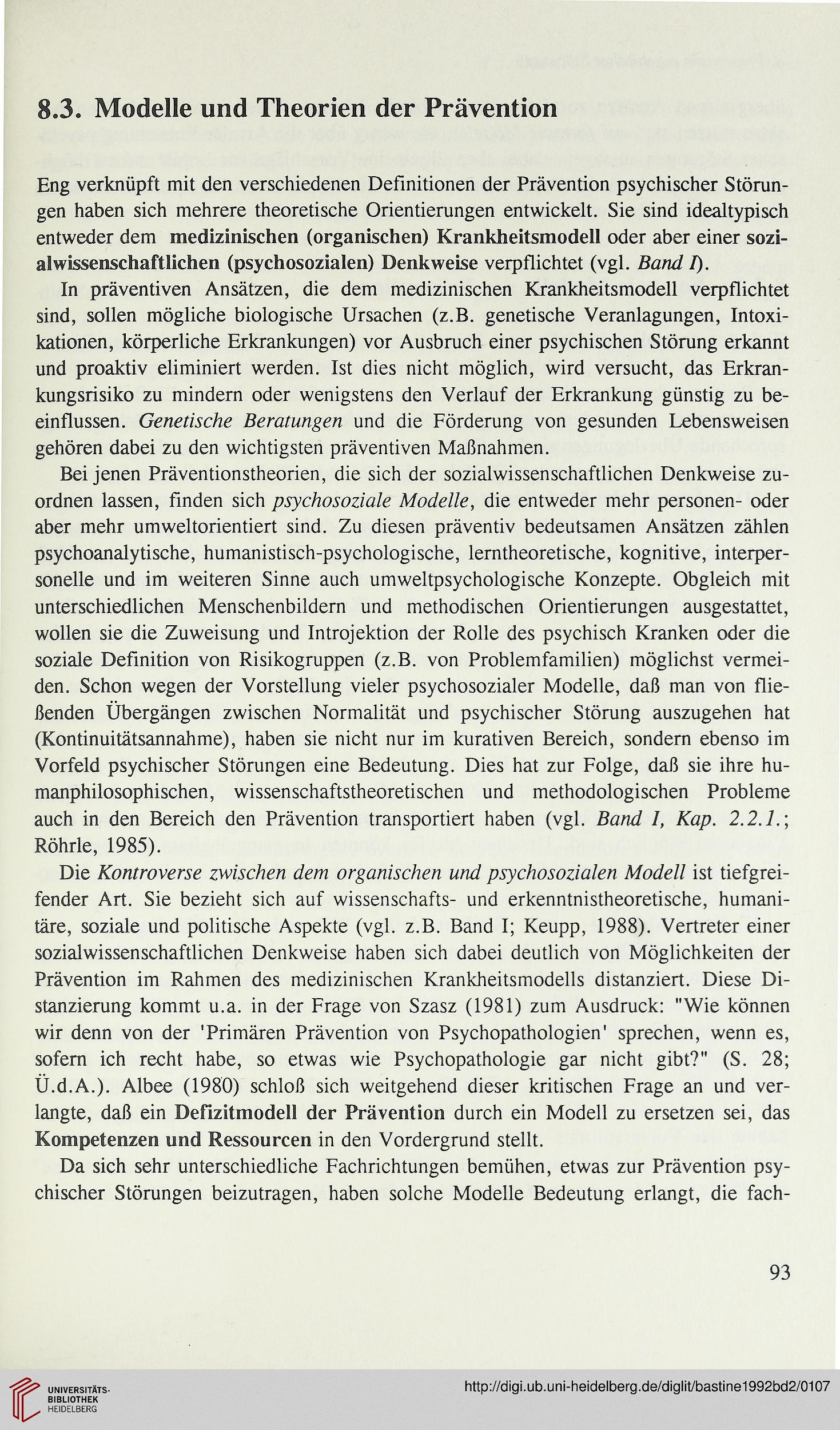8.3. Modelle und Theorien der Prävention
Eng verknüpft mit den verschiedenen Definitionen der Prävention psychischer Störun-
gen haben sich mehrere theoretische Orientierungen entwickelt. Sie sind idealtypisch
entweder dem medizinischen (organischen) Krankheitsmodell oder aber einer sozi-
alwissenschaftlichen (psychosozialen) Denkweise verpflichtet (vgl. Band I).
In präventiven Ansätzen, die dem medizinischen Krankheitsmodell verpflichtet
sind, sollen mögliche biologische Ursachen (z.B. genetische Veranlagungen, Intoxi-
kationen, körperliche Erkrankungen) vor Ausbruch einer psychischen Störung erkannt
und proaktiv eliminiert werden. Ist dies nicht möglich, wird versucht, das Erkran-
kungsrisiko zu mindern oder wenigstens den Verlauf der Erkrankung günstig zu be-
einflussen. Genetische Beratungen und die Förderung von gesunden Lebensweisen
gehören dabei zu den wichtigsten präventiven Maßnahmen.
Bei jenen Präventionstheorien, die sich der sozialwissenschaftlichen Denkweise zu-
ordnen lassen, finden sich psychosoziale Modelle, die entweder mehr personen- oder
aber mehr umweltorientiert sind. Zu diesen präventiv bedeutsamen Ansätzen zählen
psychoanalytische, humanistisch-psychologische, lerntheoretische, kognitive, interper-
sonelle und im weiteren Sinne auch umweltpsychologische Konzepte. Obgleich mit
unterschiedlichen Menschenbildern und methodischen Orientierungen ausgestattet,
wollen sie die Zuweisung und Introjektion der Rolle des psychisch Kranken oder die
soziale Definition von Risikogruppen (z.B. von Problemfamilien) möglichst vermei-
den. Schon wegen der Vorstellung vieler psychosozialer Modelle, daß man von flie-
ßenden Übergängen zwischen Normalität und psychischer Störung auszugehen hat
(Kontinuitätsannahme), haben sie nicht nur im kurativen Bereich, sondern ebenso im
Vorfeld psychischer Störungen eine Bedeutung. Dies hat zur Folge, daß sie ihre hu-
manphilosophischen, wissenschaftstheoretischen und methodologischen Probleme
auch in den Bereich den Prävention transportiert haben (vgl. Band I, Kap. 2.2.I.;
Röhrle, 1985).
Die Kontroverse zwischen dem organischen und psychosozialen Modell ist tiefgrei-
fender Art. Sie bezieht sich auf wissenschafts- und erkenntnistheoretische, humani-
täre, soziale und politische Aspekte (vgl. z.B. Band I; Keupp, 1988). Vertreter einer
sozialwissenschaftlichen Denkweise haben sich dabei deutlich von Möglichkeiten der
Prävention im Rahmen des medizinischen Krankheitsmodells distanziert. Diese Di-
stanzierung kommt u.a. in der Frage von Szasz (1981) zum Ausdruck: "Wie können
wir denn von der 'Primären Prävention von Psychopathologien' sprechen, wenn es,
sofern ich recht habe, so etwas wie Psychopathologie gar nicht gibt?" (S. 28;
Ü.d.A.). Albee (1980) schloß sich weitgehend dieser kritischen Frage an und ver-
langte, daß ein Defizitmodell der Prävention durch ein Modell zu ersetzen sei, das
Kompetenzen und Ressourcen in den Vordergrund stellt.
Da sich sehr unterschiedliche Fachrichtungen bemühen, etwas zur Prävention psy-
chischer Störungen beizutragen, haben solche Modelle Bedeutung erlangt, die fach-
93
Eng verknüpft mit den verschiedenen Definitionen der Prävention psychischer Störun-
gen haben sich mehrere theoretische Orientierungen entwickelt. Sie sind idealtypisch
entweder dem medizinischen (organischen) Krankheitsmodell oder aber einer sozi-
alwissenschaftlichen (psychosozialen) Denkweise verpflichtet (vgl. Band I).
In präventiven Ansätzen, die dem medizinischen Krankheitsmodell verpflichtet
sind, sollen mögliche biologische Ursachen (z.B. genetische Veranlagungen, Intoxi-
kationen, körperliche Erkrankungen) vor Ausbruch einer psychischen Störung erkannt
und proaktiv eliminiert werden. Ist dies nicht möglich, wird versucht, das Erkran-
kungsrisiko zu mindern oder wenigstens den Verlauf der Erkrankung günstig zu be-
einflussen. Genetische Beratungen und die Förderung von gesunden Lebensweisen
gehören dabei zu den wichtigsten präventiven Maßnahmen.
Bei jenen Präventionstheorien, die sich der sozialwissenschaftlichen Denkweise zu-
ordnen lassen, finden sich psychosoziale Modelle, die entweder mehr personen- oder
aber mehr umweltorientiert sind. Zu diesen präventiv bedeutsamen Ansätzen zählen
psychoanalytische, humanistisch-psychologische, lerntheoretische, kognitive, interper-
sonelle und im weiteren Sinne auch umweltpsychologische Konzepte. Obgleich mit
unterschiedlichen Menschenbildern und methodischen Orientierungen ausgestattet,
wollen sie die Zuweisung und Introjektion der Rolle des psychisch Kranken oder die
soziale Definition von Risikogruppen (z.B. von Problemfamilien) möglichst vermei-
den. Schon wegen der Vorstellung vieler psychosozialer Modelle, daß man von flie-
ßenden Übergängen zwischen Normalität und psychischer Störung auszugehen hat
(Kontinuitätsannahme), haben sie nicht nur im kurativen Bereich, sondern ebenso im
Vorfeld psychischer Störungen eine Bedeutung. Dies hat zur Folge, daß sie ihre hu-
manphilosophischen, wissenschaftstheoretischen und methodologischen Probleme
auch in den Bereich den Prävention transportiert haben (vgl. Band I, Kap. 2.2.I.;
Röhrle, 1985).
Die Kontroverse zwischen dem organischen und psychosozialen Modell ist tiefgrei-
fender Art. Sie bezieht sich auf wissenschafts- und erkenntnistheoretische, humani-
täre, soziale und politische Aspekte (vgl. z.B. Band I; Keupp, 1988). Vertreter einer
sozialwissenschaftlichen Denkweise haben sich dabei deutlich von Möglichkeiten der
Prävention im Rahmen des medizinischen Krankheitsmodells distanziert. Diese Di-
stanzierung kommt u.a. in der Frage von Szasz (1981) zum Ausdruck: "Wie können
wir denn von der 'Primären Prävention von Psychopathologien' sprechen, wenn es,
sofern ich recht habe, so etwas wie Psychopathologie gar nicht gibt?" (S. 28;
Ü.d.A.). Albee (1980) schloß sich weitgehend dieser kritischen Frage an und ver-
langte, daß ein Defizitmodell der Prävention durch ein Modell zu ersetzen sei, das
Kompetenzen und Ressourcen in den Vordergrund stellt.
Da sich sehr unterschiedliche Fachrichtungen bemühen, etwas zur Prävention psy-
chischer Störungen beizutragen, haben solche Modelle Bedeutung erlangt, die fach-
93