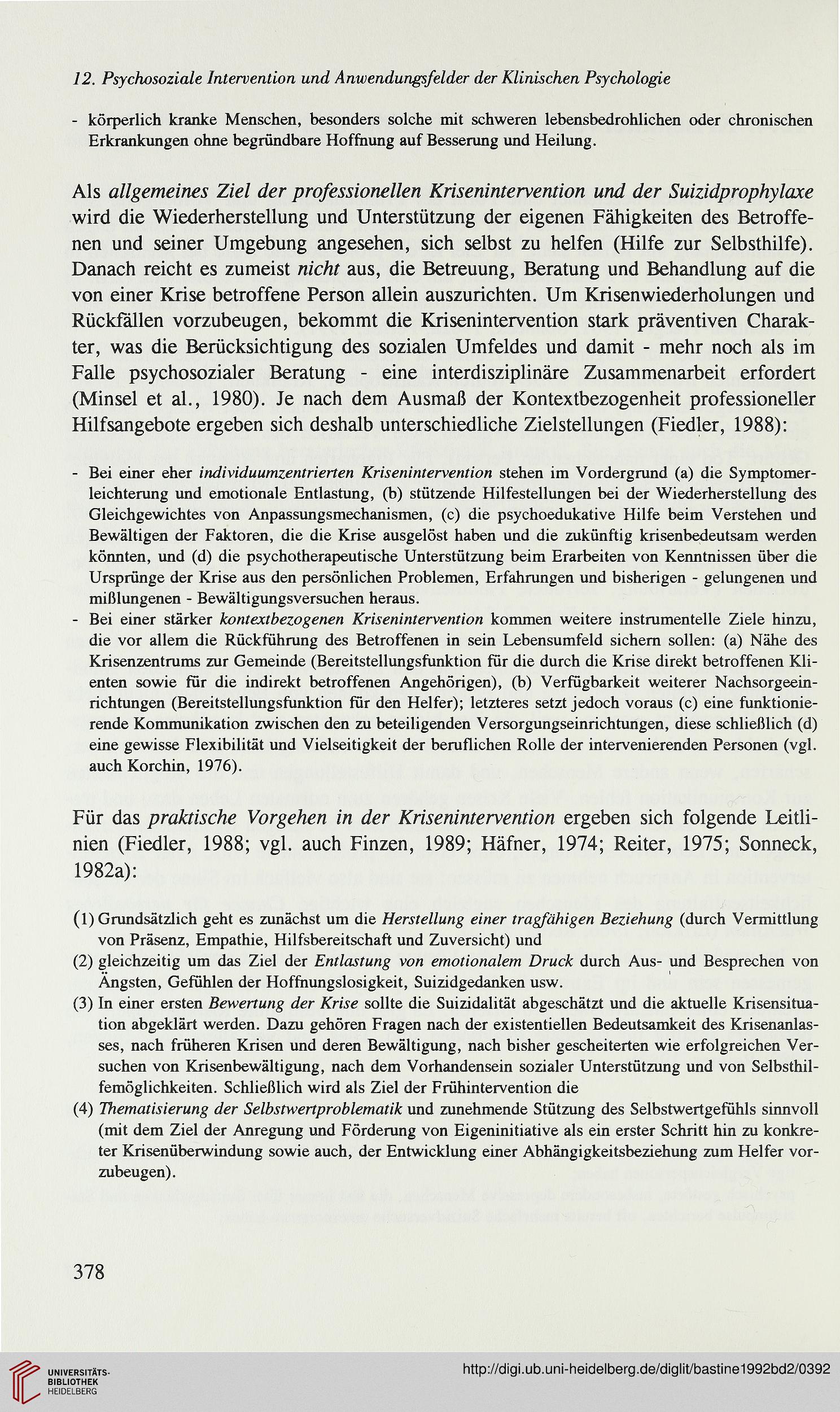12. Psychosoziale Intervention und Anwendungsfelder der Klinischen Psychologie
- körperlich kranke Menschen, besonders solche mit schweren lebensbedrohlichen oder chronischen
Erkrankungen ohne begründbare Hoffnung auf Besserung und Heilung.
Als allgemeines Ziel der professionellen Krisenintervention und der Suizidprophylaxe
wird die Wiederherstellung und Unterstützung der eigenen Fähigkeiten des Betroffe-
nen und seiner Umgebung angesehen, sich selbst zu helfen (Hilfe zur Selbsthilfe).
Danach reicht es zumeist nicht aus, die Betreuung, Beratung und Behandlung auf die
von einer Krise betroffene Person allein auszurichten. Um Krisenwiederholungen und
Rückfällen vorzubeugen, bekommt die Krisenintervention stark präventiven Charak-
ter, was die Berücksichtigung des sozialen Umfeldes und damit - mehr noch als im
Falle psychosozialer Beratung - eine interdisziplinäre Zusammenarbeit erfordert
(Minsel et al., 1980). Je nach dem Ausmaß der Kontextbezogenheit professioneller
Hilfsangebote ergeben sich deshalb unterschiedliche Zielstellungen (Fiedler, 1988):
- Bei einer eher individuumzentrierten Krisenintervention stehen im Vordergrund (a) die Symptomer-
leichterung und emotionale Entlastung, (b) stützende Hilfestellungen bei der Wiederherstellung des
Gleichgewichtes von Anpassungsmechanismen, (c) die psychoedukative Hilfe beim Verstehen und
Bewältigen der Faktoren, die die Krise ausgelöst haben und die zukünftig krisenbedeutsam werden
könnten, und (d) die psychotherapeutische Unterstützung beim Erarbeiten von Kenntnissen über die
Ursprünge der Krise aus den persönlichen Problemen, Erfahrungen und bisherigen - gelungenen und
mißlungenen - Bewältigungsversuchen heraus.
- Bei einer stärker kontextbezogenen Krisenintervention kommen weitere instrumentelle Ziele hinzu,
die vor allem die Rückführung des Betroffenen in sein Lebensumfeld sichern sollen: (a) Nähe des
Krisenzentrums zur Gemeinde (Bereitstellungsfunktion für die durch die Krise direkt betroffenen Kli-
enten sowie für die indirekt betroffenen Angehörigen), (b) Verfügbarkeit weiterer Nachsorgeein-
richtungen (Bereitstellungsfunktion für den Helfer); letzteres setzt jedoch voraus (c) eine funktionie-
rende Kommunikation zwischen den zu beteiligenden Versorgungseinrichtungen, diese schließlich (d)
eine gewisse Flexibilität und Vielseitigkeit der beruflichen Rolle der intervenierenden Personen (vgl.
auch Korchin, 1976).
Für das praktische Vorgehen in der Krisenintervention ergeben sich folgende Leitli-
nien (Fiedler, 1988; vgl. auch Finzen, 1989; Häfner, 1974; Reiter, 1975; Sonneck,
1982a):
(1) Grundsätzlich geht es zunächst um die Herstellung einer tragfähigen Beziehung (durch Vermittlung
von Präsenz, Empathie, Hilfsbereitschaft und Zuversicht) und
(2) gleichzeitig um das Ziel der Entlastung von emotionalem Druck durch Aus- und Besprechen von
Ängsten, Gefühlen der Hoffnungslosigkeit, Suizidgedanken usw.
(3) In einer ersten Bewertung der Krise sollte die Suizidalität abgeschätzt und die aktuelle Krisensitua-
tion abgeklärt werden. Dazu gehören Fragen nach der existentiellen Bedeutsamkeit des Krisenanlas-
ses, nach früheren Krisen und deren Bewältigung, nach bisher gescheiterten wie erfolgreichen Ver-
suchen von Krisenbewältigung, nach dem Vorhandensein sozialer Unterstützung und von Selbsthil-
femöglichkeiten. Schließlich wird als Ziel der Frühintervention die
(4) Thematisierung der Selbstwertproblematik und zunehmende Stützung des Selbstwertgefühls sinnvoll
(mit dem Ziel der Anregung und Förderung von Eigeninitiative als ein erster Schritt hin zu konkre-
ter Krisenüberwindung sowie auch, der Entwicklung einer Abhängigkeitsbeziehung zum Helfer vor-
zubeugen).
378
- körperlich kranke Menschen, besonders solche mit schweren lebensbedrohlichen oder chronischen
Erkrankungen ohne begründbare Hoffnung auf Besserung und Heilung.
Als allgemeines Ziel der professionellen Krisenintervention und der Suizidprophylaxe
wird die Wiederherstellung und Unterstützung der eigenen Fähigkeiten des Betroffe-
nen und seiner Umgebung angesehen, sich selbst zu helfen (Hilfe zur Selbsthilfe).
Danach reicht es zumeist nicht aus, die Betreuung, Beratung und Behandlung auf die
von einer Krise betroffene Person allein auszurichten. Um Krisenwiederholungen und
Rückfällen vorzubeugen, bekommt die Krisenintervention stark präventiven Charak-
ter, was die Berücksichtigung des sozialen Umfeldes und damit - mehr noch als im
Falle psychosozialer Beratung - eine interdisziplinäre Zusammenarbeit erfordert
(Minsel et al., 1980). Je nach dem Ausmaß der Kontextbezogenheit professioneller
Hilfsangebote ergeben sich deshalb unterschiedliche Zielstellungen (Fiedler, 1988):
- Bei einer eher individuumzentrierten Krisenintervention stehen im Vordergrund (a) die Symptomer-
leichterung und emotionale Entlastung, (b) stützende Hilfestellungen bei der Wiederherstellung des
Gleichgewichtes von Anpassungsmechanismen, (c) die psychoedukative Hilfe beim Verstehen und
Bewältigen der Faktoren, die die Krise ausgelöst haben und die zukünftig krisenbedeutsam werden
könnten, und (d) die psychotherapeutische Unterstützung beim Erarbeiten von Kenntnissen über die
Ursprünge der Krise aus den persönlichen Problemen, Erfahrungen und bisherigen - gelungenen und
mißlungenen - Bewältigungsversuchen heraus.
- Bei einer stärker kontextbezogenen Krisenintervention kommen weitere instrumentelle Ziele hinzu,
die vor allem die Rückführung des Betroffenen in sein Lebensumfeld sichern sollen: (a) Nähe des
Krisenzentrums zur Gemeinde (Bereitstellungsfunktion für die durch die Krise direkt betroffenen Kli-
enten sowie für die indirekt betroffenen Angehörigen), (b) Verfügbarkeit weiterer Nachsorgeein-
richtungen (Bereitstellungsfunktion für den Helfer); letzteres setzt jedoch voraus (c) eine funktionie-
rende Kommunikation zwischen den zu beteiligenden Versorgungseinrichtungen, diese schließlich (d)
eine gewisse Flexibilität und Vielseitigkeit der beruflichen Rolle der intervenierenden Personen (vgl.
auch Korchin, 1976).
Für das praktische Vorgehen in der Krisenintervention ergeben sich folgende Leitli-
nien (Fiedler, 1988; vgl. auch Finzen, 1989; Häfner, 1974; Reiter, 1975; Sonneck,
1982a):
(1) Grundsätzlich geht es zunächst um die Herstellung einer tragfähigen Beziehung (durch Vermittlung
von Präsenz, Empathie, Hilfsbereitschaft und Zuversicht) und
(2) gleichzeitig um das Ziel der Entlastung von emotionalem Druck durch Aus- und Besprechen von
Ängsten, Gefühlen der Hoffnungslosigkeit, Suizidgedanken usw.
(3) In einer ersten Bewertung der Krise sollte die Suizidalität abgeschätzt und die aktuelle Krisensitua-
tion abgeklärt werden. Dazu gehören Fragen nach der existentiellen Bedeutsamkeit des Krisenanlas-
ses, nach früheren Krisen und deren Bewältigung, nach bisher gescheiterten wie erfolgreichen Ver-
suchen von Krisenbewältigung, nach dem Vorhandensein sozialer Unterstützung und von Selbsthil-
femöglichkeiten. Schließlich wird als Ziel der Frühintervention die
(4) Thematisierung der Selbstwertproblematik und zunehmende Stützung des Selbstwertgefühls sinnvoll
(mit dem Ziel der Anregung und Förderung von Eigeninitiative als ein erster Schritt hin zu konkre-
ter Krisenüberwindung sowie auch, der Entwicklung einer Abhängigkeitsbeziehung zum Helfer vor-
zubeugen).
378