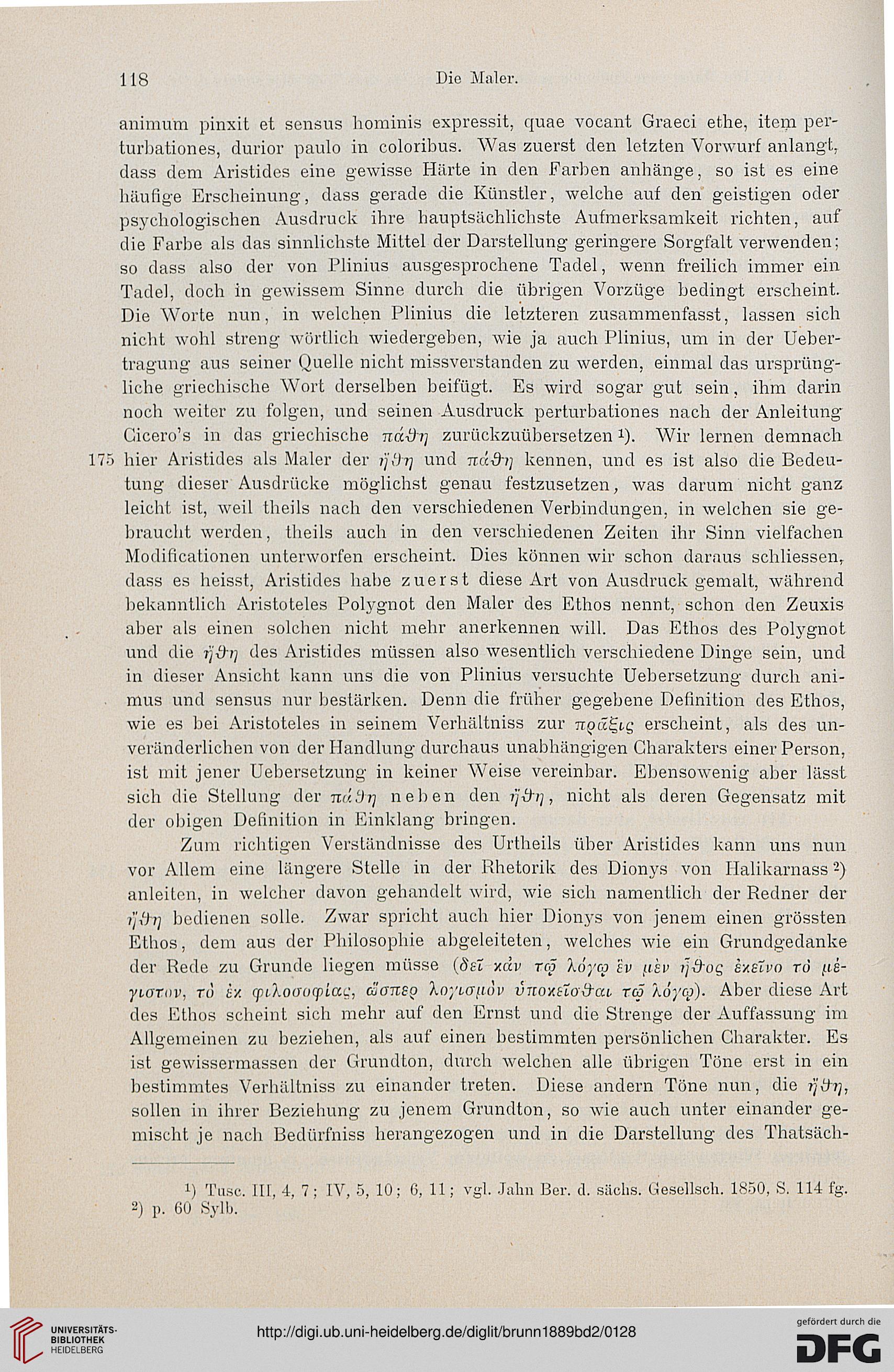118
Die Miller.
animum pinxit et sensus hominis expressit, quae vocant Graeci ethe, item per-
turbationes, durior paulo in coloribus. Was zuerst den letzten Vorwurf anlangt,
dass dem Aristides eine gewisse Härte in den Farben anhänge, so ist es eine
häufige Erscheinung, dass gerade die Künstler, welche auf den' geistigen oder
psychologischen Ausdruck ihre hauptsächlichste Aufmerksamkeit richten, auf
die Farbe als das sinnlichste Mittel der Darstellung geringere Sorgfalt verwenden;
so dass also der von Plinius ausgesprochene Tadel, wenn freilich immer ein
Tadel, doch in gewissem Sinne durch die übrigen Vorzüge bedingt erscheint.
Die Worte nun, in welchen Plinius die letzteren zusammenfasst, lassen sich
nicht wohl streng wörtlich wiedergeben, wie ja auch Plinius, um in der Ueber-
tragung aus seiner Quelle nicht missverstanden zu werden, einmal das ursprüng-
liche griechische Wort derselben beifügt. Es wird sogar gut sein. ihm darin
noch weiter zu folgen, und seinen Ausdruck perturbationes nach der Anleitung
Cicero's in das griechische nädi] zurückzuübersetzen J). Wir lernen demnach
175 hier Aristides als Maler der rjth) und ndß-i] kennen, und es ist also die Bedeu-
tung dieser Ausdrücke möglichst genau festzusetzen, was darum nicht ganz
leicht, ist, weil theils nach den verschiedenen Verbindungen, in welchen sie ge-
braucht werden, theils auch in den verschiedenen Zeiten ihr Sinn vielfachen
Modifikationen unterworfen erscheint. Dies können wir schon daraus schliessen,
dass es heisst, Aristides habe zuerst diese Art von Ausdruck gemalt, während
bekanntlich Aristoteles Polygnot den Maler des Ethos nennt, schon den Zeuxis
aber als einen solchen nicht mehr anerkennen will. Das Ethos des Polygnot
und die rj&rj des Aristides müssen also wesentlich verschiedene Dinge sein, und
in dieser Ansicht kann uns die von Plinius versuchte Uebersetzung durch ani-
mus und sensus nur bestärken. Denn die früher gegebene Definition des Ethos,
wie es bei Aristoteles in seinem Verhältniss zur npügtg erscheint, als des un-
veränderlichen von der Handlung durchaus unabhängigen Charakters einer Person,
ist mit jener Uebersetzung in keiner Weise vereinbar. Ebensowenig aber lässt
sich die Stellung der m/.Hrj neben den rjd-i], nicht als deren Gegensatz mit
der obigen Definition in Einklang bringen.
Zum richtigen Verständnisse des Urtheils über Aristides kann uns nun
vor Allem eine längere Stelle in der Rhetorik des Dionys von Halikarnass2)
anleiten, in welcher davon gehandelt wird, wie sich namentlich der Redner der
?)'rhj bedienen solle. Zwar spricht auch hier Dionys von jenem einen grössten
Ethos, dem aus der Philosophie abgeleiteten, welches wie ein Grundgedanke
der Rede zu Grunde liegen müsse (deX xdv reg Xöycg ev fisv l'jd-og hv.eXvo rö fie-
yiarnv, rö iv. cpt-Xocrufiac, cijansg Xoyi<7[iuv viioy.tXod'ai- reo höycg). Aber diese Art
des Ethos scheint sich mehr auf den Ernst und die Strenge der Auffassung im
Allgemeinen zu beziehen, als auf einen bestimmten persönlichen Charakter. Es
ist gewissermassen der Grundton, durch welchen alle übrigen Töne erst in ein
bestimmtes Verhältniss zu einander treten. Diese andern Töne nun, die i'j&i],
sollen in ihrer Beziehung zu jenem Grundton, so wie auch unter einander ge-
mischt je nach Bedürfniss herangezogen und in die Darstellung des Thatsäch-
!) Tusc. llt, 4, 7; IV, 5, 10; 6, 11; vgl. Jahn Ber. d. siiehs. (Jesellsch. 1850, S. 114 fg.
2) p. 60 Sylb.
Die Miller.
animum pinxit et sensus hominis expressit, quae vocant Graeci ethe, item per-
turbationes, durior paulo in coloribus. Was zuerst den letzten Vorwurf anlangt,
dass dem Aristides eine gewisse Härte in den Farben anhänge, so ist es eine
häufige Erscheinung, dass gerade die Künstler, welche auf den' geistigen oder
psychologischen Ausdruck ihre hauptsächlichste Aufmerksamkeit richten, auf
die Farbe als das sinnlichste Mittel der Darstellung geringere Sorgfalt verwenden;
so dass also der von Plinius ausgesprochene Tadel, wenn freilich immer ein
Tadel, doch in gewissem Sinne durch die übrigen Vorzüge bedingt erscheint.
Die Worte nun, in welchen Plinius die letzteren zusammenfasst, lassen sich
nicht wohl streng wörtlich wiedergeben, wie ja auch Plinius, um in der Ueber-
tragung aus seiner Quelle nicht missverstanden zu werden, einmal das ursprüng-
liche griechische Wort derselben beifügt. Es wird sogar gut sein. ihm darin
noch weiter zu folgen, und seinen Ausdruck perturbationes nach der Anleitung
Cicero's in das griechische nädi] zurückzuübersetzen J). Wir lernen demnach
175 hier Aristides als Maler der rjth) und ndß-i] kennen, und es ist also die Bedeu-
tung dieser Ausdrücke möglichst genau festzusetzen, was darum nicht ganz
leicht, ist, weil theils nach den verschiedenen Verbindungen, in welchen sie ge-
braucht werden, theils auch in den verschiedenen Zeiten ihr Sinn vielfachen
Modifikationen unterworfen erscheint. Dies können wir schon daraus schliessen,
dass es heisst, Aristides habe zuerst diese Art von Ausdruck gemalt, während
bekanntlich Aristoteles Polygnot den Maler des Ethos nennt, schon den Zeuxis
aber als einen solchen nicht mehr anerkennen will. Das Ethos des Polygnot
und die rj&rj des Aristides müssen also wesentlich verschiedene Dinge sein, und
in dieser Ansicht kann uns die von Plinius versuchte Uebersetzung durch ani-
mus und sensus nur bestärken. Denn die früher gegebene Definition des Ethos,
wie es bei Aristoteles in seinem Verhältniss zur npügtg erscheint, als des un-
veränderlichen von der Handlung durchaus unabhängigen Charakters einer Person,
ist mit jener Uebersetzung in keiner Weise vereinbar. Ebensowenig aber lässt
sich die Stellung der m/.Hrj neben den rjd-i], nicht als deren Gegensatz mit
der obigen Definition in Einklang bringen.
Zum richtigen Verständnisse des Urtheils über Aristides kann uns nun
vor Allem eine längere Stelle in der Rhetorik des Dionys von Halikarnass2)
anleiten, in welcher davon gehandelt wird, wie sich namentlich der Redner der
?)'rhj bedienen solle. Zwar spricht auch hier Dionys von jenem einen grössten
Ethos, dem aus der Philosophie abgeleiteten, welches wie ein Grundgedanke
der Rede zu Grunde liegen müsse (deX xdv reg Xöycg ev fisv l'jd-og hv.eXvo rö fie-
yiarnv, rö iv. cpt-Xocrufiac, cijansg Xoyi<7[iuv viioy.tXod'ai- reo höycg). Aber diese Art
des Ethos scheint sich mehr auf den Ernst und die Strenge der Auffassung im
Allgemeinen zu beziehen, als auf einen bestimmten persönlichen Charakter. Es
ist gewissermassen der Grundton, durch welchen alle übrigen Töne erst in ein
bestimmtes Verhältniss zu einander treten. Diese andern Töne nun, die i'j&i],
sollen in ihrer Beziehung zu jenem Grundton, so wie auch unter einander ge-
mischt je nach Bedürfniss herangezogen und in die Darstellung des Thatsäch-
!) Tusc. llt, 4, 7; IV, 5, 10; 6, 11; vgl. Jahn Ber. d. siiehs. (Jesellsch. 1850, S. 114 fg.
2) p. 60 Sylb.