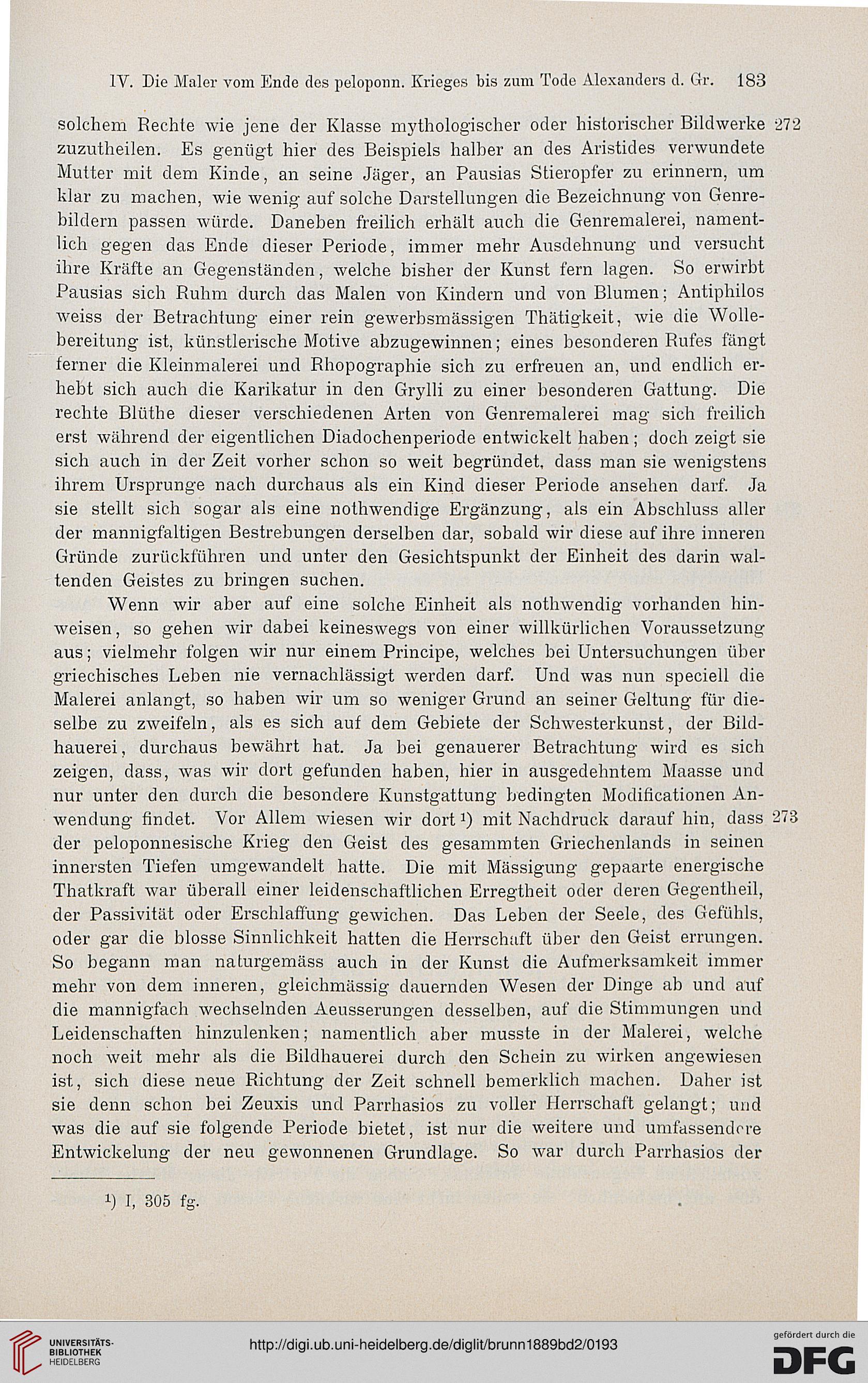IV. Die Maler vom Ende dos peloponn. Krieges bis zum Tode Alexanders d. Gr. 183
solchem Rechte wie jene der Klasse mythologischer oder historischer Bildwerke
zuzutheilen. Es genügt hier des Beispiels halber an des Aristides verwundete
Mutter mit dem Kinde, an seine Jäger, an Pausias Stieropfer zu erinnern, um
klar zu machen, wie wenig auf solche Darstellungen die Bezeichnung von Genre-
bildern passen würde. Daneben freilich erhält auch die Genremalerei, nament-
lich gegen das Ende dieser Periode, immer mehr Ausdehnung und versucht
ihre Kräfte an Gegenständen, welche bisher der Kunst fern lagen. So erwirbt
Pausias sich Ruhm durch das Malen von Kindern und von Blumen; Antiphilos
weiss der Betrachtung einer rein gewerbsmässigen Thätigkeit, wie die Wolle-
bereitung ist, künstlerische Motive abzugewinnen; eines besonderen Rufes fängt
ferner die Kleinmalerei und Rhopographie sich zu erfreuen an, und endlich er-
hebt sich auch die Karikatur in den Grylli zu einer besonderen Gattung. Die
rechte Blüthe dieser verschiedenen Arten von Genremalerei mag sich freilich
erst während der eigentlichen Diadochenperiode entwickelt haben; doch zeigt sie
sich auch in der Zeit vorher schon so weit begründet, dass man sie wenigstens
ihrem Ursprünge nach durchaus als ein Kind dieser Periode ansehen darf. Ja
sie stellt sich sogar als eine nothwendige Ergänzung, als ein Abschluss aller
der mannigfaltigen Bestrebungen derselben dar, sobald wir diese auf ihre inneren
Gründe zurückführen und unter den Gesichtspunkt der Einheit des darin wal-
tenden Geistes zu bringen suchen.
Wenn wir aber auf eine solche Einheit als nothwendig vorhanden hin-
weisen, so gehen wir dabei keineswegs von einer willkürlichen Voraussetzung
aus; vielmehr folgen wir nur einem Principe, welches bei Untersuchungen über
griechisches Leben nie vernachlässigt werden darf. Und was nun speciell die
Malerei anlangt, so haben wir um so weniger Grund an seiner Geltung für die-
selbe zu zweifeln, als es sich auf dem Gebiete der Schwesterkunst, der Bild-
hauerei , durchaus bewährt hat. Ja bei genauerer Betrachtung wird es sich
zeigen, dass, was wir dort gefunden haben, hier in ausgedehntem Maasse und
nur unter den durch die besondere Kunstgattung bedingten Modificationen An-
wendung findet. Vor Allem wiesen wir dort!) mit Nachdruck darauf hin, dass
der peloponnesische Krieg den Geist des gesammten Griechenlands in seinen
innersten Tiefen umgewandelt hatte. Die mit Mässigung gepaarte energische
Thatkraft war überall einer leidenschaftlichen Erregtheit oder deren Gegentheil,
der Passivität oder Erschlaffung gewichen. Das Leben der Seele, des Gefühls,
oder gar die blosse Sinnlichkeit hatten die Herrschaft über den Geist errungen.
So begann man naturgemäss auch in der Kunst die Aufmerksamkeit immer
mehr von dem inneren, gleichmässig dauernden Wesen der Dinge ab und auf
die mannigfach wechselnden Aeusserungen desselben, auf die Stimmungen und
Leidenschaften hinzulenken; namentlich aber musste in der Malerei, welche
noch weit mehr als die Bildhauerei durch den Schein zu wirken angewiesen
ist, sich diese neue Richtung der Zeit schnell bemerklich machen. Daher ist
sie denn schon bei Zeuxis und Parrhasios zu voller Herrschaft gelangt; und
was die auf sie folgende Periode bietet, ist nur die weitere und umfassendere
Entwickelung der neu gewonnenen Grundlage. So war durch Parrhasios der
!) I, 305 fg.
solchem Rechte wie jene der Klasse mythologischer oder historischer Bildwerke
zuzutheilen. Es genügt hier des Beispiels halber an des Aristides verwundete
Mutter mit dem Kinde, an seine Jäger, an Pausias Stieropfer zu erinnern, um
klar zu machen, wie wenig auf solche Darstellungen die Bezeichnung von Genre-
bildern passen würde. Daneben freilich erhält auch die Genremalerei, nament-
lich gegen das Ende dieser Periode, immer mehr Ausdehnung und versucht
ihre Kräfte an Gegenständen, welche bisher der Kunst fern lagen. So erwirbt
Pausias sich Ruhm durch das Malen von Kindern und von Blumen; Antiphilos
weiss der Betrachtung einer rein gewerbsmässigen Thätigkeit, wie die Wolle-
bereitung ist, künstlerische Motive abzugewinnen; eines besonderen Rufes fängt
ferner die Kleinmalerei und Rhopographie sich zu erfreuen an, und endlich er-
hebt sich auch die Karikatur in den Grylli zu einer besonderen Gattung. Die
rechte Blüthe dieser verschiedenen Arten von Genremalerei mag sich freilich
erst während der eigentlichen Diadochenperiode entwickelt haben; doch zeigt sie
sich auch in der Zeit vorher schon so weit begründet, dass man sie wenigstens
ihrem Ursprünge nach durchaus als ein Kind dieser Periode ansehen darf. Ja
sie stellt sich sogar als eine nothwendige Ergänzung, als ein Abschluss aller
der mannigfaltigen Bestrebungen derselben dar, sobald wir diese auf ihre inneren
Gründe zurückführen und unter den Gesichtspunkt der Einheit des darin wal-
tenden Geistes zu bringen suchen.
Wenn wir aber auf eine solche Einheit als nothwendig vorhanden hin-
weisen, so gehen wir dabei keineswegs von einer willkürlichen Voraussetzung
aus; vielmehr folgen wir nur einem Principe, welches bei Untersuchungen über
griechisches Leben nie vernachlässigt werden darf. Und was nun speciell die
Malerei anlangt, so haben wir um so weniger Grund an seiner Geltung für die-
selbe zu zweifeln, als es sich auf dem Gebiete der Schwesterkunst, der Bild-
hauerei , durchaus bewährt hat. Ja bei genauerer Betrachtung wird es sich
zeigen, dass, was wir dort gefunden haben, hier in ausgedehntem Maasse und
nur unter den durch die besondere Kunstgattung bedingten Modificationen An-
wendung findet. Vor Allem wiesen wir dort!) mit Nachdruck darauf hin, dass
der peloponnesische Krieg den Geist des gesammten Griechenlands in seinen
innersten Tiefen umgewandelt hatte. Die mit Mässigung gepaarte energische
Thatkraft war überall einer leidenschaftlichen Erregtheit oder deren Gegentheil,
der Passivität oder Erschlaffung gewichen. Das Leben der Seele, des Gefühls,
oder gar die blosse Sinnlichkeit hatten die Herrschaft über den Geist errungen.
So begann man naturgemäss auch in der Kunst die Aufmerksamkeit immer
mehr von dem inneren, gleichmässig dauernden Wesen der Dinge ab und auf
die mannigfach wechselnden Aeusserungen desselben, auf die Stimmungen und
Leidenschaften hinzulenken; namentlich aber musste in der Malerei, welche
noch weit mehr als die Bildhauerei durch den Schein zu wirken angewiesen
ist, sich diese neue Richtung der Zeit schnell bemerklich machen. Daher ist
sie denn schon bei Zeuxis und Parrhasios zu voller Herrschaft gelangt; und
was die auf sie folgende Periode bietet, ist nur die weitere und umfassendere
Entwickelung der neu gewonnenen Grundlage. So war durch Parrhasios der
!) I, 305 fg.