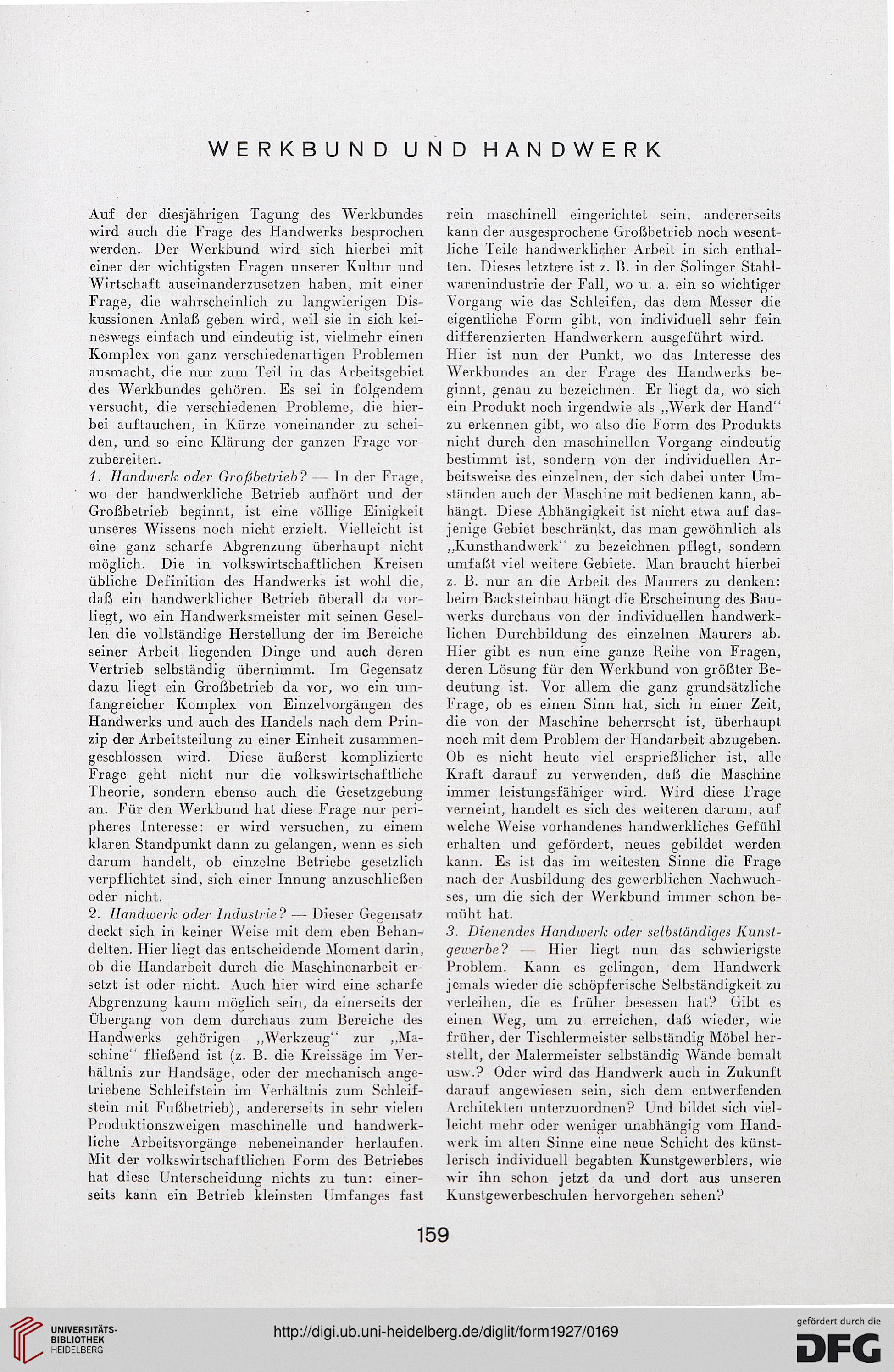WERKBUND UND HANDWERK
Auf der diesjährigen Tagung des Werkbundes
wird auch die Frage des Handwerks besprochen
werden. Der Werkbund wird sich hierbei mit
einer der wichtigsten Fragen unserer Kultur und
Wirtschaft auseinanderzusetzen haben, mit einer
Frage, die wahrscheinlich zu langwierigen Dis-
kussionen Anlaß geben wird, weil sie in sich kei-
neswegs einfach und eindeutig ist, vielmehr einen
Komplex von ganz verschiedenartigen Problemen
ausmacht, die nur zum Teil in das Arbeitsgebiet
des Werkbundes gehören. Es sei in folgendem
versucht, die verschiedenen Probleme, die hier-
bei auftauchen, in Kürze voneinander zu schei-
den, und so eine Klärung der ganzen Frage vor-
zubereiten.
1. Handwerk oder Großbetrieb? — In der Frage,
wo der handwerkliche Betrieb aufhört und der
Großbetrieb beginnt, ist eine völlige Einigkeit
unseres Wissens noch nicht erzielt. Vielleicht ist
eine ganz scharfe Abgrenzung überhaupt nicht
möglich. Die in volkswirtschaftlichen Kreisen
übliche Definition des Handwerks ist wohl die,
daß ein handwerklicher Betrieb überall da vor-
liegt, wo ein Handwerksmeister mit seinen Gesel-
len die vollständige Herstellung der im Bereiche
seiner Arbeit liegenden Dinge und auch deren
Vertrieb selbständig übernimmt. Im Gegensalz
dazu liegt ein Großbetrieb da vor, wo ein um-
fangreicher Komplex von Einzelvorgängen des
Handwerks und auch des Handels nach dem Prin-
zip der Arbeitsteilung zu einer Einheit zusammen-
geschlossen wird. Diese äußerst komplizierte
Frage geht nicht nur die volkswirtschaftliche
Theorie, sondern ebenso auch die Gesetzgebung
an. Für den Werkbund hat diese Frage nur peri-
pheres Interesse: er wird versuchen, zu einem
klaren Standpunkt dann zu gelangen, wenn es sich
darum handelt, ob einzelne Betriebe gesetzlich
verpflichtet sind, sich einer Innung anzuschließen
oder nicht.
2. Handwerk oder Industrie ? — Dieser Gegensalz
deckt sich in keiner Weise mit dem eben Behan-
delten. Iiier liegt das entscheidende Moment darin,
ob die Handarbeit durch die Maschinenarbeit er-
setzt ist oder nicht. Auch hier wird eine scharfe
Abgrenzung kaum möglich sein, da einerseits der
Übergang von dem durchaus zum Bereiche des
Handwerks gehörigen „Werkzeug" zur „Ma-
schine" fließend ist (z. B. die Kreissäge im Ver-
hältnis zur Handsäge, oder der mechanisch ange-
triebene Schleifstein im Verhältnis zum Schleif-
stein mit Fußbetrieb), andererseits in sehr vielen
Produktionszweigen maschinelle und handwerk-
liche Arbeitsvorgänge nebeneinander herlaufen.
Mit der volkswirtschaftlichen Form des Betriebes
hat diese Unterscheidung nichts zu tun: einer-
seits kann ein Betrieb kleinsten Umfanges fast
rein maschinell eingerichtet sein, andererseits
kann der ausgesprochene Großbetrieb noch wesent-
liche Teile handwerklicher Arbeit in sich enthal-
ten. Dieses letzlere ist z. B. in der Solinger Stahl-
wareninduslrie der Fall, wo u. a. ein so wichtiger
Vorgang wie das Schleifen, das dem Messer die
eigentliche Form gibt, von individuell sehr fein
differenzierten Handwerkern ausgeführt wird.
Hier ist nun der Punkt, wo das Interesse des
Werkbundes an der Frage des Handwerks be-
ginnt, genau zu bezeichnen. Er liegt da, wo sich
ein Produkt noch irgendwie als „Werk der Hand"
zu erkennen gibt, wo also die Form des Produkts
nicht durch den maschinellen Vorgang eindeutig
bestimmt ist, sondern von der individuellen Ar-
beitsweise des einzelnen, der sich dabei unter Um-
ständen auch der Maschine mit bedienen kann, ab-
hängt. Diese Abhängigkeit ist nicht etwa auf das-
jenige Gebiet beschränkt, das man gewöhnlich als
„Kunsthandwerk" zu bezeichnen pflegt, sondern
umfaßt viel weitere Gebiete. Man braucht hierbei
z. B. nur an die Arbeit des Maurers zu denken:
beim Backsleinbau hängt die Erscheinung des Bau-
werks durchaus von der individuellen handwerk-
lichen Durchbildung des einzelnen Maurers ab.
Hier gibt es nun eine ganze Reihe von Fragen,
deren Lösung für den Werkbund von größter Be-
deutung ist. Vor allem die ganz grundsätzliche
Frage, ob es einen Sinn hat, sich in einer Zeit,
die von der Maschine beherrscht ist, überhaupt
noch mit dem Problem der Handarbeit abzugeben,
üb es nicht heute viel ersprießlicher ist, alle
Kraft darauf zu verwenden, daß die Maschine
immer leistungsfähiger wird. Wird diese Frage
verneint, handelt es sich des weiteren darum, auf
welche Weise vorhandenes handwerkliches Gefühl
erhalten und gefördert, neues gebildet werden
kann. Es ist das im weitesten Sinne die Frage
nach der Ausbildung des gewerblichen Nachwuch-
ses, um die sich der Werkbund immer schon be-
müht hat.
3. Dienendes Handwerli oder selbständiges Kunst-
gewerbe? - Hier liegt nun das schwierigste
Problem. Kann es gelingen, dem Handwerk
jemals wieder die schöpferische Selbständigkeit zu
verleihen, die es früher besessen hat? Gibt es
einen Weg, um zu erreichen, daß wieder, wie
früher, der Tischlermeister selbständig Möbel her-
stellt, der Malermeister selbständig Wände bemall
usw.? Oder wird das Handwerk auch in Zukunft
darauf angewiesen sein, sich dem entwerfenden
Architekten unterzuordnen? Und bildet sich viel-
leicht mehr oder weniger unabhängig vom Hand-
werk im allen Sinne eine neue Schicht des künst-
lerisch individuell begabten Kunstgewerbes, wie
wir ihn schon jetzt da und dort aus unseren
Kunstgewerbeschulen hervorgehen sehen?
159
Auf der diesjährigen Tagung des Werkbundes
wird auch die Frage des Handwerks besprochen
werden. Der Werkbund wird sich hierbei mit
einer der wichtigsten Fragen unserer Kultur und
Wirtschaft auseinanderzusetzen haben, mit einer
Frage, die wahrscheinlich zu langwierigen Dis-
kussionen Anlaß geben wird, weil sie in sich kei-
neswegs einfach und eindeutig ist, vielmehr einen
Komplex von ganz verschiedenartigen Problemen
ausmacht, die nur zum Teil in das Arbeitsgebiet
des Werkbundes gehören. Es sei in folgendem
versucht, die verschiedenen Probleme, die hier-
bei auftauchen, in Kürze voneinander zu schei-
den, und so eine Klärung der ganzen Frage vor-
zubereiten.
1. Handwerk oder Großbetrieb? — In der Frage,
wo der handwerkliche Betrieb aufhört und der
Großbetrieb beginnt, ist eine völlige Einigkeit
unseres Wissens noch nicht erzielt. Vielleicht ist
eine ganz scharfe Abgrenzung überhaupt nicht
möglich. Die in volkswirtschaftlichen Kreisen
übliche Definition des Handwerks ist wohl die,
daß ein handwerklicher Betrieb überall da vor-
liegt, wo ein Handwerksmeister mit seinen Gesel-
len die vollständige Herstellung der im Bereiche
seiner Arbeit liegenden Dinge und auch deren
Vertrieb selbständig übernimmt. Im Gegensalz
dazu liegt ein Großbetrieb da vor, wo ein um-
fangreicher Komplex von Einzelvorgängen des
Handwerks und auch des Handels nach dem Prin-
zip der Arbeitsteilung zu einer Einheit zusammen-
geschlossen wird. Diese äußerst komplizierte
Frage geht nicht nur die volkswirtschaftliche
Theorie, sondern ebenso auch die Gesetzgebung
an. Für den Werkbund hat diese Frage nur peri-
pheres Interesse: er wird versuchen, zu einem
klaren Standpunkt dann zu gelangen, wenn es sich
darum handelt, ob einzelne Betriebe gesetzlich
verpflichtet sind, sich einer Innung anzuschließen
oder nicht.
2. Handwerk oder Industrie ? — Dieser Gegensalz
deckt sich in keiner Weise mit dem eben Behan-
delten. Iiier liegt das entscheidende Moment darin,
ob die Handarbeit durch die Maschinenarbeit er-
setzt ist oder nicht. Auch hier wird eine scharfe
Abgrenzung kaum möglich sein, da einerseits der
Übergang von dem durchaus zum Bereiche des
Handwerks gehörigen „Werkzeug" zur „Ma-
schine" fließend ist (z. B. die Kreissäge im Ver-
hältnis zur Handsäge, oder der mechanisch ange-
triebene Schleifstein im Verhältnis zum Schleif-
stein mit Fußbetrieb), andererseits in sehr vielen
Produktionszweigen maschinelle und handwerk-
liche Arbeitsvorgänge nebeneinander herlaufen.
Mit der volkswirtschaftlichen Form des Betriebes
hat diese Unterscheidung nichts zu tun: einer-
seits kann ein Betrieb kleinsten Umfanges fast
rein maschinell eingerichtet sein, andererseits
kann der ausgesprochene Großbetrieb noch wesent-
liche Teile handwerklicher Arbeit in sich enthal-
ten. Dieses letzlere ist z. B. in der Solinger Stahl-
wareninduslrie der Fall, wo u. a. ein so wichtiger
Vorgang wie das Schleifen, das dem Messer die
eigentliche Form gibt, von individuell sehr fein
differenzierten Handwerkern ausgeführt wird.
Hier ist nun der Punkt, wo das Interesse des
Werkbundes an der Frage des Handwerks be-
ginnt, genau zu bezeichnen. Er liegt da, wo sich
ein Produkt noch irgendwie als „Werk der Hand"
zu erkennen gibt, wo also die Form des Produkts
nicht durch den maschinellen Vorgang eindeutig
bestimmt ist, sondern von der individuellen Ar-
beitsweise des einzelnen, der sich dabei unter Um-
ständen auch der Maschine mit bedienen kann, ab-
hängt. Diese Abhängigkeit ist nicht etwa auf das-
jenige Gebiet beschränkt, das man gewöhnlich als
„Kunsthandwerk" zu bezeichnen pflegt, sondern
umfaßt viel weitere Gebiete. Man braucht hierbei
z. B. nur an die Arbeit des Maurers zu denken:
beim Backsleinbau hängt die Erscheinung des Bau-
werks durchaus von der individuellen handwerk-
lichen Durchbildung des einzelnen Maurers ab.
Hier gibt es nun eine ganze Reihe von Fragen,
deren Lösung für den Werkbund von größter Be-
deutung ist. Vor allem die ganz grundsätzliche
Frage, ob es einen Sinn hat, sich in einer Zeit,
die von der Maschine beherrscht ist, überhaupt
noch mit dem Problem der Handarbeit abzugeben,
üb es nicht heute viel ersprießlicher ist, alle
Kraft darauf zu verwenden, daß die Maschine
immer leistungsfähiger wird. Wird diese Frage
verneint, handelt es sich des weiteren darum, auf
welche Weise vorhandenes handwerkliches Gefühl
erhalten und gefördert, neues gebildet werden
kann. Es ist das im weitesten Sinne die Frage
nach der Ausbildung des gewerblichen Nachwuch-
ses, um die sich der Werkbund immer schon be-
müht hat.
3. Dienendes Handwerli oder selbständiges Kunst-
gewerbe? - Hier liegt nun das schwierigste
Problem. Kann es gelingen, dem Handwerk
jemals wieder die schöpferische Selbständigkeit zu
verleihen, die es früher besessen hat? Gibt es
einen Weg, um zu erreichen, daß wieder, wie
früher, der Tischlermeister selbständig Möbel her-
stellt, der Malermeister selbständig Wände bemall
usw.? Oder wird das Handwerk auch in Zukunft
darauf angewiesen sein, sich dem entwerfenden
Architekten unterzuordnen? Und bildet sich viel-
leicht mehr oder weniger unabhängig vom Hand-
werk im allen Sinne eine neue Schicht des künst-
lerisch individuell begabten Kunstgewerbes, wie
wir ihn schon jetzt da und dort aus unseren
Kunstgewerbeschulen hervorgehen sehen?
159