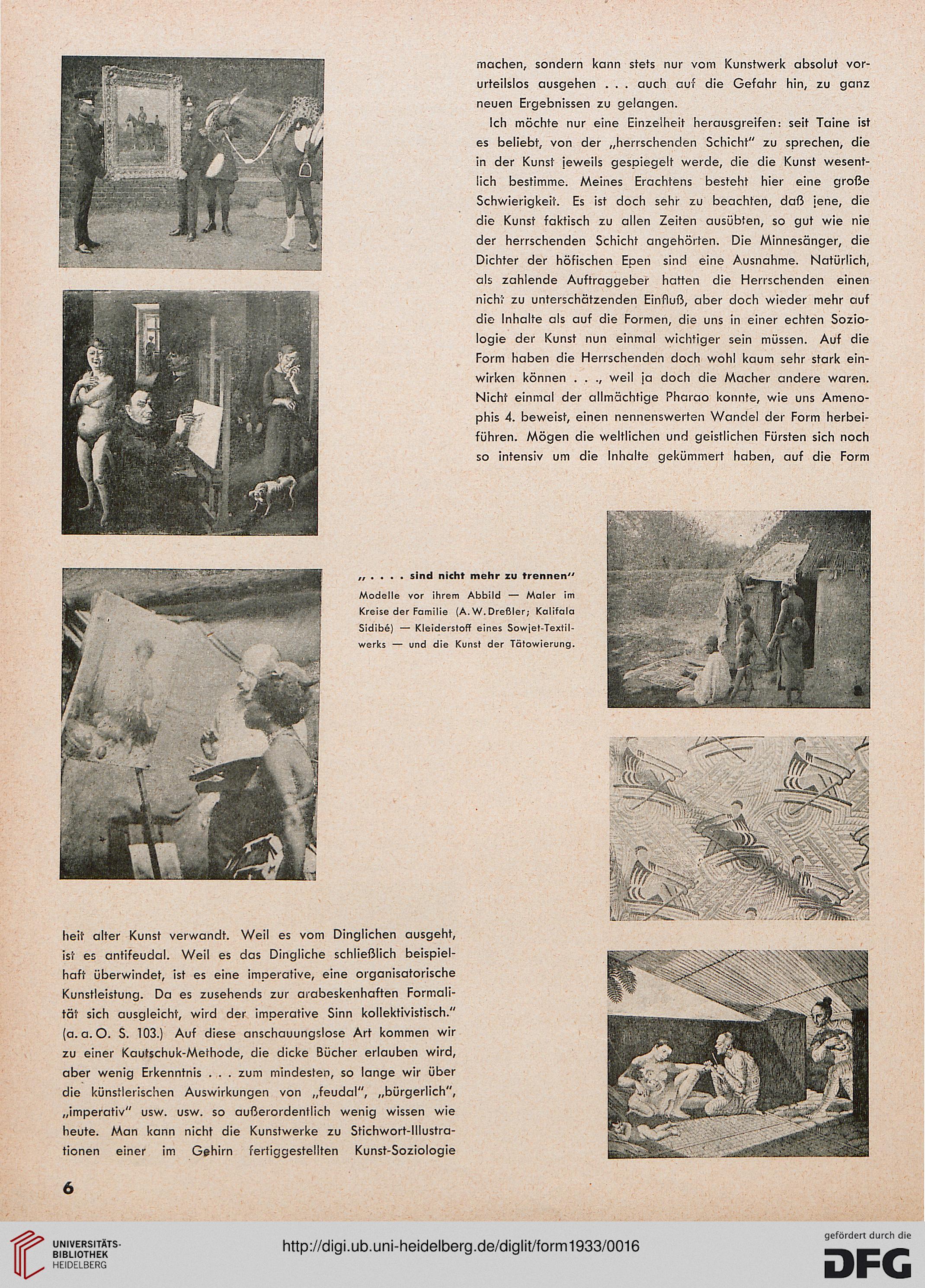Die Form: Zeitschrift für gestaltende Arbeit — 8.1933
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.13209#0016
DOI Artikel:
Behne, Adolf: Ist eine Soziologie der Kunst möglich?
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.13209#0016
heit alter Kunst verwandt. Weil es vom Dinglichen ausgeht,
ist es antifeudal. Weil es das Dingliche schließlich beispiel-
haft überwindet, ist es eine imperative, eine organisatorische
Kunstleistung. Da es zusehends zur arabeskenhaften Formali-
tät sich ausgleicht, wird der imperative Sinn kollektivistisch."
(a.a.O. S. 103.) Auf diese anschauungslose Art kommen wir
zu einer Kautschuk-Methode, die dicke Bücher erlauben wird,
aber wenig Erkenntnis . . . zum mindesten, so lange wir über
die künstlerischen Auswirkungen von „feudal", „bürgerlich",
„imperativ" usw. usw. so außerordentlich wenig wissen wie
heute. Man kann nicht die Kunstwerke zu Stichwort-Illustra-
tionen einer im Gehirn fertiggestellten Kunst-Soziologie
machen, sondern kann stets nur vom Kunstwerk absolut vor-
urteilslos ausgehen . . . auch auf die Gefahr hin, zu ganz
neuen Ergebnissen zu gelangen.
Ich möchte nur eine Einzelheit herausgreifen: seit Taine ist
es beliebt, von der „herrschenden Schicht" zu sprechen, die
in der Kunst jeweils gespiegelt werde, die die Kunst wesent-
lich bestimme. Meines Erachtens besteht hier eine große
Schwierigkeit. Es ist doch sehr zu beachten, daß jene, die
die Kunst faktisch zu allen Zeiten ausübten, so gut wie nie
der herrschenden Schicht angehörten. Die Minnesänger, die
Dichter der höfischen Epen sind eine Ausnahme. Natürlich,
als zahlende Auftraggeber hatten die Herrschenden einen
nicht zu unterschätzenden Einfluß, aber doch wieder mehr auf
die Inhalte als auf die Formen, die uns in einer echten Sozio-
logie der Kunst nun einmal wichtiger sein müssen. Auf die
Form haben die Herrschenden doch wohl kaum sehr stark ein-
wirken können . . ., weil ja doch die Macher andere waren.
Nicht einmal der allmächtige Pharao konnte, wie uns Ameno-
phis 4. beweist, einen nennenswerten Wandel der Form herbei-
führen. Mögen die weltlichen und geistlichen Fürsten sich noch
so intensiv um die Inhalte gekümmert haben, auf die Form
6
ist es antifeudal. Weil es das Dingliche schließlich beispiel-
haft überwindet, ist es eine imperative, eine organisatorische
Kunstleistung. Da es zusehends zur arabeskenhaften Formali-
tät sich ausgleicht, wird der imperative Sinn kollektivistisch."
(a.a.O. S. 103.) Auf diese anschauungslose Art kommen wir
zu einer Kautschuk-Methode, die dicke Bücher erlauben wird,
aber wenig Erkenntnis . . . zum mindesten, so lange wir über
die künstlerischen Auswirkungen von „feudal", „bürgerlich",
„imperativ" usw. usw. so außerordentlich wenig wissen wie
heute. Man kann nicht die Kunstwerke zu Stichwort-Illustra-
tionen einer im Gehirn fertiggestellten Kunst-Soziologie
machen, sondern kann stets nur vom Kunstwerk absolut vor-
urteilslos ausgehen . . . auch auf die Gefahr hin, zu ganz
neuen Ergebnissen zu gelangen.
Ich möchte nur eine Einzelheit herausgreifen: seit Taine ist
es beliebt, von der „herrschenden Schicht" zu sprechen, die
in der Kunst jeweils gespiegelt werde, die die Kunst wesent-
lich bestimme. Meines Erachtens besteht hier eine große
Schwierigkeit. Es ist doch sehr zu beachten, daß jene, die
die Kunst faktisch zu allen Zeiten ausübten, so gut wie nie
der herrschenden Schicht angehörten. Die Minnesänger, die
Dichter der höfischen Epen sind eine Ausnahme. Natürlich,
als zahlende Auftraggeber hatten die Herrschenden einen
nicht zu unterschätzenden Einfluß, aber doch wieder mehr auf
die Inhalte als auf die Formen, die uns in einer echten Sozio-
logie der Kunst nun einmal wichtiger sein müssen. Auf die
Form haben die Herrschenden doch wohl kaum sehr stark ein-
wirken können . . ., weil ja doch die Macher andere waren.
Nicht einmal der allmächtige Pharao konnte, wie uns Ameno-
phis 4. beweist, einen nennenswerten Wandel der Form herbei-
führen. Mögen die weltlichen und geistlichen Fürsten sich noch
so intensiv um die Inhalte gekümmert haben, auf die Form
6