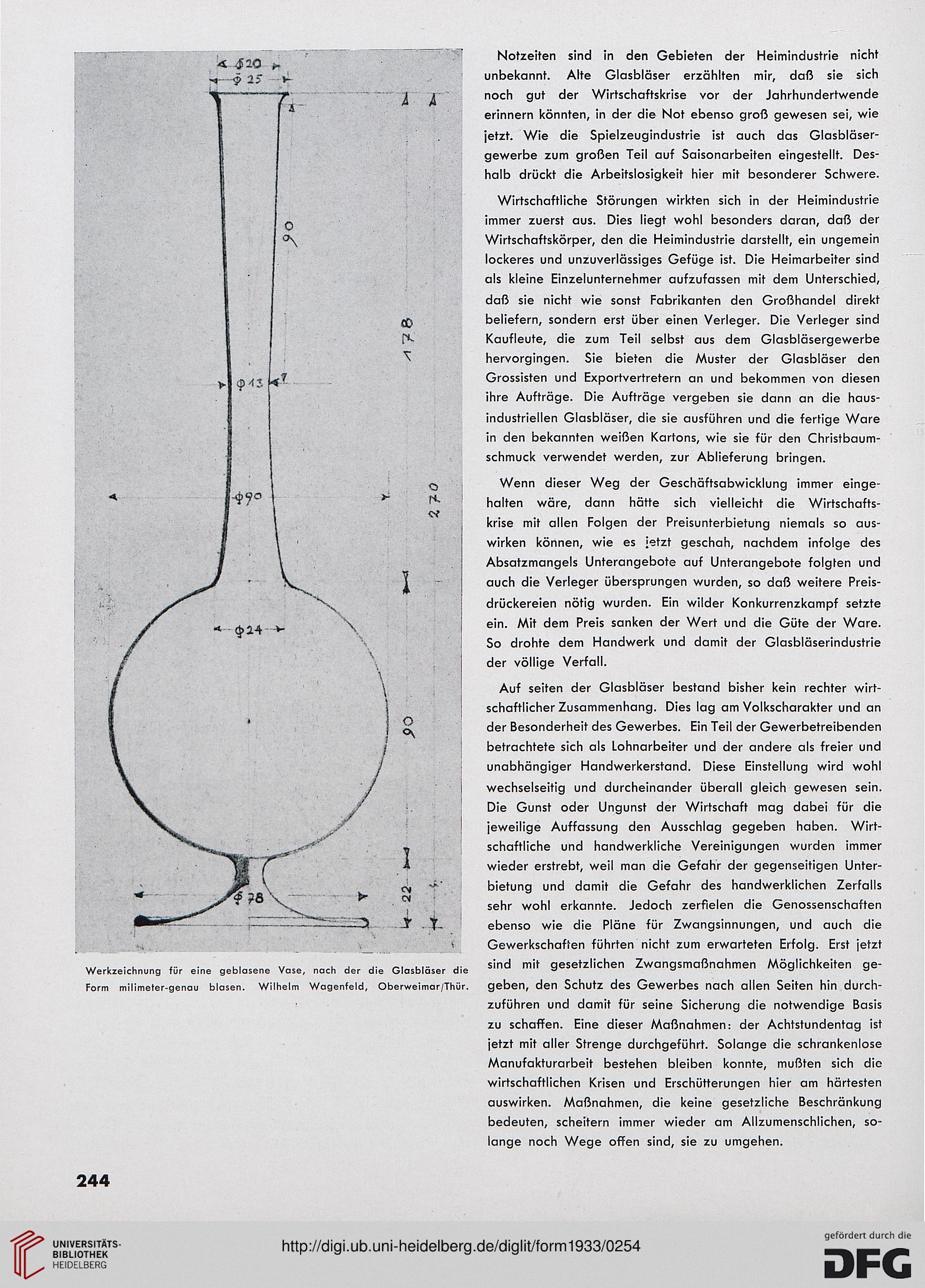Werkzeichnung für eine geblasene Vase, nach der die Glasbläser die
Form milimeter-genau blasen. Wilhelm Wagenfeld, Oberweimar/Thür.
Notzeiten sind in den Gebieten der Heimindustrie nicht
unbekannt. Alte Glasbläser erzählten mir, daß sie sich
noch gut der Wirtschaftskrise vor der Jahrhundertwende
erinnern könnten, in der die Not ebenso groß gewesen sei, wie
jetzt. Wie die Spielzeugindustrie ist auch das Glasbläser-
gewerbe zum großen Teil auf Saisonarbeiten eingestellt. Des-
halb drückt die Arbeitslosigkeit hier mit besonderer Schwere.
Wirtschaftliche Störungen wirkten sich in der Heimindustrie
immer zuerst aus. Dies liegt wohl besonders daran, daß der
Wirtschaftskörper, den die Heimindustrie darstellt, ein ungemein
lockeres und unzuverlässiges Gefüge ist. Die Heimarbeiter sind
als kleine Einzelunternehmer aufzufassen mit dem Unterschied,
daß sie nicht wie sonst Fabrikanten den Großhandel direkt
beliefern, sondern erst über einen Verleger. Die Verleger sind
Kaufleute, die zum Teil selbst aus dem Glasbläsergewerbe
hervorgingen. Sie bieten die Muster der Glasbläser den
Grossisten und Exportvertretern an und bekommen von diesen
ihre Aufträge. Die Aufträge vergeben sie dann an die haus-
industriellen Glasbläser, die sie ausführen und die fertige Ware
in den bekannten weißen Kartons, wie sie für den Christbaum-
schmuck verwendet werden, zur Ablieferung bringen.
Wenn dieser Weg der Geschäftsabwicklung immer einge-
halten wäre, dann hätte sich vielleicht die Wirtschafts-
krise mit allen Folgen der Preisunterbietung niemals so aus-
wirken können, wie es jetzt geschah, nachdem infolge des
Absatzmangels Unterangebote auf Unterangebote folgten und
auch die Verleger übersprungen wurden, so daß weitere Preis-
drückereien nötig wurden. Ein wilder Konkurrenzkampf setzte
ein. Mit dem Preis sanken der Wert und die Güte der Ware.
So drohte dem Handwerk und damit der Glasbläserindustrie
der völlige Verfall.
Auf Seiten der Glasbläser bestand bisher kein rechter wirt-
schaftlicher Zusammenhang. Dies lag am Volkscharakter und an
der Besonderheit des Gewerbes. Ein Teil der Gewerbetreibenden
betrachtete sich als Lohnarbeiter und der andere als freier und
unabhängiger Handwerkerstand. Diese Einstellung wird wohl
wechselseitig und durcheinander überall gleich gewesen sein.
Die Gunst oder Ungunst der Wirtschaft mag dabei für die
jeweilige Auffassung den Ausschlag gegeben haben. Wirt-
schaftliche und handwerkliche Vereinigungen wurden immer
wieder erstrebt, weil man die Gefahr der gegenseitigen Unter-
bietung und damit die Gefahr des handwerklichen Zerfalls
sehr wohl erkannte. Jedoch zerfielen die Genossenschaften
ebenso wie die Pläne für Zwangsinnungen, und auch die
Gewerkschaften führten nicht zum erwarteten Erfolg. Erst jetzt
sind mit gesetzlichen Zwangsmaßnahmen Möglichkeiten ge-
geben, den Schutz des Gewerbes nach allen Seiten hin durch-
zuführen und damit für seine Sicherung die notwendige Basis
zu schaffen. Eine dieser Maßnahmen: der Achtstundentag ist
jetzt mit aller Strenge durchgeführt. Solange die schrankenlose
Manufakturarbeit bestehen bleiben konnte, mußten sich die
wirtschaftlichen Krisen und Erschütterungen hier am härtesten
auswirken. Maßnahmen, die keine gesetzliche Beschränkung
bedeuten, scheitern immer wieder am Allzumenschlichen, so-
lange noch Wege offen sind, sie zu umgehen.
244
Form milimeter-genau blasen. Wilhelm Wagenfeld, Oberweimar/Thür.
Notzeiten sind in den Gebieten der Heimindustrie nicht
unbekannt. Alte Glasbläser erzählten mir, daß sie sich
noch gut der Wirtschaftskrise vor der Jahrhundertwende
erinnern könnten, in der die Not ebenso groß gewesen sei, wie
jetzt. Wie die Spielzeugindustrie ist auch das Glasbläser-
gewerbe zum großen Teil auf Saisonarbeiten eingestellt. Des-
halb drückt die Arbeitslosigkeit hier mit besonderer Schwere.
Wirtschaftliche Störungen wirkten sich in der Heimindustrie
immer zuerst aus. Dies liegt wohl besonders daran, daß der
Wirtschaftskörper, den die Heimindustrie darstellt, ein ungemein
lockeres und unzuverlässiges Gefüge ist. Die Heimarbeiter sind
als kleine Einzelunternehmer aufzufassen mit dem Unterschied,
daß sie nicht wie sonst Fabrikanten den Großhandel direkt
beliefern, sondern erst über einen Verleger. Die Verleger sind
Kaufleute, die zum Teil selbst aus dem Glasbläsergewerbe
hervorgingen. Sie bieten die Muster der Glasbläser den
Grossisten und Exportvertretern an und bekommen von diesen
ihre Aufträge. Die Aufträge vergeben sie dann an die haus-
industriellen Glasbläser, die sie ausführen und die fertige Ware
in den bekannten weißen Kartons, wie sie für den Christbaum-
schmuck verwendet werden, zur Ablieferung bringen.
Wenn dieser Weg der Geschäftsabwicklung immer einge-
halten wäre, dann hätte sich vielleicht die Wirtschafts-
krise mit allen Folgen der Preisunterbietung niemals so aus-
wirken können, wie es jetzt geschah, nachdem infolge des
Absatzmangels Unterangebote auf Unterangebote folgten und
auch die Verleger übersprungen wurden, so daß weitere Preis-
drückereien nötig wurden. Ein wilder Konkurrenzkampf setzte
ein. Mit dem Preis sanken der Wert und die Güte der Ware.
So drohte dem Handwerk und damit der Glasbläserindustrie
der völlige Verfall.
Auf Seiten der Glasbläser bestand bisher kein rechter wirt-
schaftlicher Zusammenhang. Dies lag am Volkscharakter und an
der Besonderheit des Gewerbes. Ein Teil der Gewerbetreibenden
betrachtete sich als Lohnarbeiter und der andere als freier und
unabhängiger Handwerkerstand. Diese Einstellung wird wohl
wechselseitig und durcheinander überall gleich gewesen sein.
Die Gunst oder Ungunst der Wirtschaft mag dabei für die
jeweilige Auffassung den Ausschlag gegeben haben. Wirt-
schaftliche und handwerkliche Vereinigungen wurden immer
wieder erstrebt, weil man die Gefahr der gegenseitigen Unter-
bietung und damit die Gefahr des handwerklichen Zerfalls
sehr wohl erkannte. Jedoch zerfielen die Genossenschaften
ebenso wie die Pläne für Zwangsinnungen, und auch die
Gewerkschaften führten nicht zum erwarteten Erfolg. Erst jetzt
sind mit gesetzlichen Zwangsmaßnahmen Möglichkeiten ge-
geben, den Schutz des Gewerbes nach allen Seiten hin durch-
zuführen und damit für seine Sicherung die notwendige Basis
zu schaffen. Eine dieser Maßnahmen: der Achtstundentag ist
jetzt mit aller Strenge durchgeführt. Solange die schrankenlose
Manufakturarbeit bestehen bleiben konnte, mußten sich die
wirtschaftlichen Krisen und Erschütterungen hier am härtesten
auswirken. Maßnahmen, die keine gesetzliche Beschränkung
bedeuten, scheitern immer wieder am Allzumenschlichen, so-
lange noch Wege offen sind, sie zu umgehen.
244