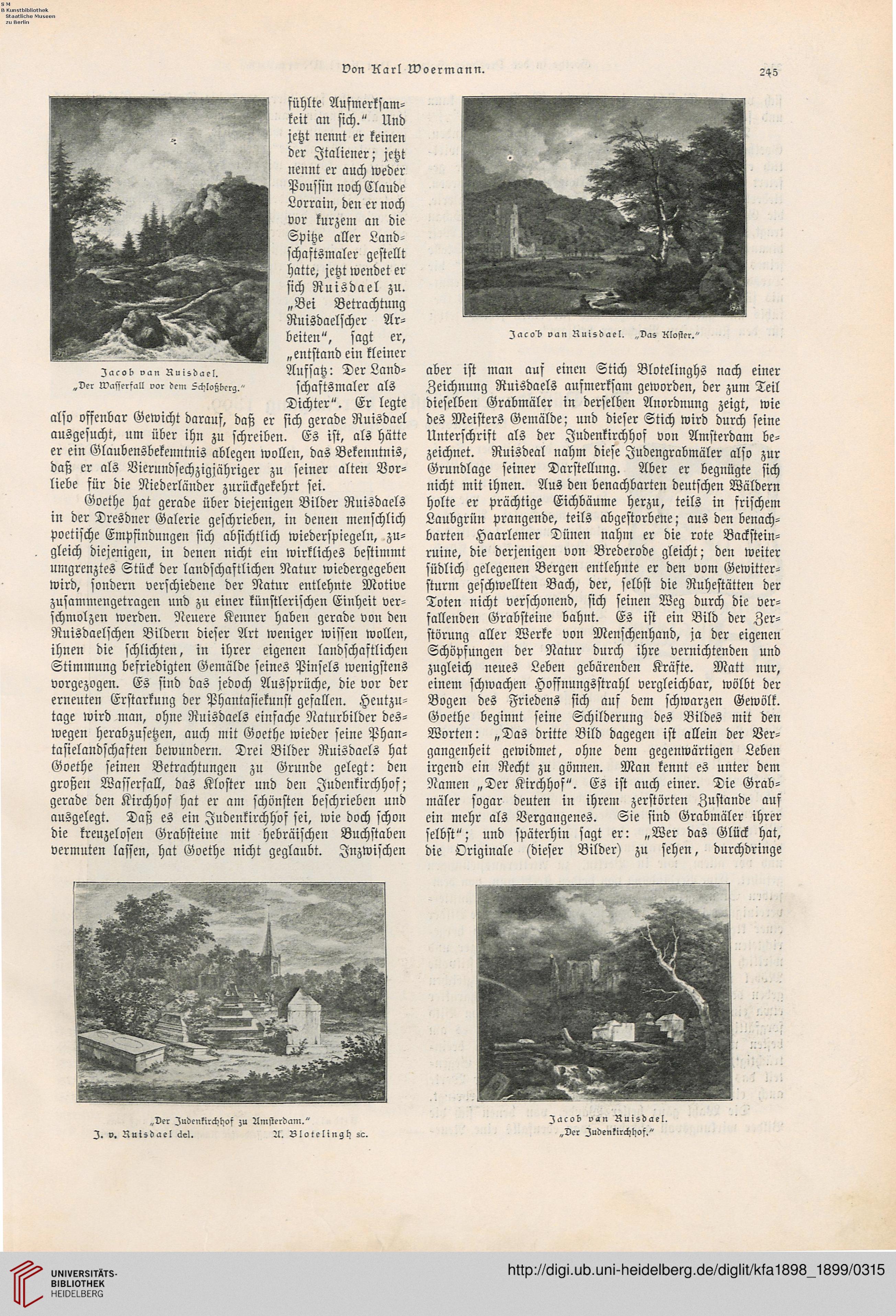von Aarl Woermann.
24s
fühlte Aufmerksam-
keit an sich." Und
jetzt nennt er keinen
der Italiener; jetzt
nennt er auch weder
Poussin noch Claude
Lorrain, den er noch
vor kurzem an die
Spitze aller Land-
schaftsmaler gestellt
hatte, jetzt wendet er
sich Ruisdael zu.
„Bei Betrachtung
Ruisdaelscher Ar-
beiten", sagt er,
„entstand ein kleiner
Aufsatz: Der Land-
schaftsmaler als
Dichter". Er legte
also offenbar Gewicht darauf, daß er sich gerade Ruisdael
ausgesucht, um über ihn zu schreiben. Es ist, als hätte
er ein Glaubensbekenntnis oblegen wollen, das Bekenntnis,
daß er als Vierundsechzigjähriger zu seiner alten Vor-
liebe für die Niederländer zurückgekehrt sei.
Goethe hat gerade über diejenigen Bilder Ruisdaels
in der Dresdner Galerie geschrieben, in denen menschlich
poetische Empfindungen sich absichtlich wiederspiegeln, zu-
gleich diejenigen, in denen nicht ein wirkliches bestimmt
umgrenztes Stück der landschaftlichen Natur wiedergegeben
wird, sondern verschiedene der Natur entlehnte Motive
zusammengetragen und zu einer künstlerischen Einheit ver-
schmolzen werden. Neuere Kenner haben gerade von den
Ruisdaelschen Bildern dieser Art weniger wissen wollen,
ihnen die schlichten, in ihrer eigenen landschaftlichen
Stimmung befriedigten Gemälde seines Pinsels wenigstens
vorgezogen. Es sind das jedoch Aussprüche, die vor der
erneuten Erstarkung der Phantasiekunst gefallen. Heutzu-
tage wird man, ohne Ruisdaels einfache Naturbilder des-
wegen herabzusetzen, auch mit Goethe wieder seine Phan-
tasielandschaften bewundern. Drei Bilder Ruisdaels hat
Goethe seinen Betrachtungen zu Grunde gelegt: den
großen Wasserfall, das Kloster und den Judenkirchhof;
gerade den Kirchhof hat er am schönsten beschrieben und
ausgelegt. Daß es ein Judenkirchh'of sei, wie doch schon
die kreuzelosen Grabsteine mit hebräischen Buchstaben
vermuten lassen, hat Goethe nicht geglaubt. Inzwischen
„Der Iudenkirchhof zu Amsterdam."
v. Ruisdael 6e1. A. Blotelingh sc.
aber ist man auf einen Stich Blotelinghs nach einer
Zeichnung Ruisdaels aufmerksam geworden, der zum Teil
dieselben Grabmäler in derselben Anordnung zeigt, wie
des Meisters Gemälde; und dieser Stich wird durch seine
Unterschrift als der Judenkirchhof von Amsterdam be-
zeichnet. Ruisdeal nahm diese Judengrabmäler also zur
Grundlage seiner Darstellung. Aber er begnügte sich
nicht mit ihnen. Aus den benachbarten deutschen Wäldern
holte er Prächtige Eichbäume herzu, teils in frischem
Laubgrün prangende, teils abgestorbene; aus den benach-
barten Haarlemer Dünen nahm er die rote Backstein-
ruine, die derjenigen von Brederode gleicht; den weiter
südlich gelegenen Bergen entlehnte er den vom Gewitter-
sturm geschwellten Bach, der, selbst die Ruhestätten der
Toten nicht verschonend, sich seinen Weg durch die ver-
fallenden Grabsteine bahnt. Es ist ein Bild der Zer-
störung aller Werke von Menschenhand, ja der eigenen
Schöpfungen der Natur durch ihre vernichtenden und
zugleich neues Leben gebärenden Kräfte. Matt nur,
einem schwachen Hoffnungsstrahl vergleichbar, wölbt der
Bogen des Friedens sich auf dem schwarzen Gewölk.
Goethe beginnt seine Schilderung des Bildes mit den
Worten: „Das dritte Bild dagegen ist allein der Ver-
gangenheit gewidmet, ohne dem gegenwärtigen Leben
irgend ein Recht zu gönnen. Man kennt es unter dem
Namen „Der Kirchhof". Es ist auch einer. Die Grab-
mäler sogar deuten in ihrem zerstörten Zustande auf
ein mehr als Vergangenes. Sie sind Grabmäler ihrer
selbst"; und späterhin sagt er: „Wer das Glück hat,
die Originale (dieser Bilder) zu sehen, durchdringe
24s
fühlte Aufmerksam-
keit an sich." Und
jetzt nennt er keinen
der Italiener; jetzt
nennt er auch weder
Poussin noch Claude
Lorrain, den er noch
vor kurzem an die
Spitze aller Land-
schaftsmaler gestellt
hatte, jetzt wendet er
sich Ruisdael zu.
„Bei Betrachtung
Ruisdaelscher Ar-
beiten", sagt er,
„entstand ein kleiner
Aufsatz: Der Land-
schaftsmaler als
Dichter". Er legte
also offenbar Gewicht darauf, daß er sich gerade Ruisdael
ausgesucht, um über ihn zu schreiben. Es ist, als hätte
er ein Glaubensbekenntnis oblegen wollen, das Bekenntnis,
daß er als Vierundsechzigjähriger zu seiner alten Vor-
liebe für die Niederländer zurückgekehrt sei.
Goethe hat gerade über diejenigen Bilder Ruisdaels
in der Dresdner Galerie geschrieben, in denen menschlich
poetische Empfindungen sich absichtlich wiederspiegeln, zu-
gleich diejenigen, in denen nicht ein wirkliches bestimmt
umgrenztes Stück der landschaftlichen Natur wiedergegeben
wird, sondern verschiedene der Natur entlehnte Motive
zusammengetragen und zu einer künstlerischen Einheit ver-
schmolzen werden. Neuere Kenner haben gerade von den
Ruisdaelschen Bildern dieser Art weniger wissen wollen,
ihnen die schlichten, in ihrer eigenen landschaftlichen
Stimmung befriedigten Gemälde seines Pinsels wenigstens
vorgezogen. Es sind das jedoch Aussprüche, die vor der
erneuten Erstarkung der Phantasiekunst gefallen. Heutzu-
tage wird man, ohne Ruisdaels einfache Naturbilder des-
wegen herabzusetzen, auch mit Goethe wieder seine Phan-
tasielandschaften bewundern. Drei Bilder Ruisdaels hat
Goethe seinen Betrachtungen zu Grunde gelegt: den
großen Wasserfall, das Kloster und den Judenkirchhof;
gerade den Kirchhof hat er am schönsten beschrieben und
ausgelegt. Daß es ein Judenkirchh'of sei, wie doch schon
die kreuzelosen Grabsteine mit hebräischen Buchstaben
vermuten lassen, hat Goethe nicht geglaubt. Inzwischen
„Der Iudenkirchhof zu Amsterdam."
v. Ruisdael 6e1. A. Blotelingh sc.
aber ist man auf einen Stich Blotelinghs nach einer
Zeichnung Ruisdaels aufmerksam geworden, der zum Teil
dieselben Grabmäler in derselben Anordnung zeigt, wie
des Meisters Gemälde; und dieser Stich wird durch seine
Unterschrift als der Judenkirchhof von Amsterdam be-
zeichnet. Ruisdeal nahm diese Judengrabmäler also zur
Grundlage seiner Darstellung. Aber er begnügte sich
nicht mit ihnen. Aus den benachbarten deutschen Wäldern
holte er Prächtige Eichbäume herzu, teils in frischem
Laubgrün prangende, teils abgestorbene; aus den benach-
barten Haarlemer Dünen nahm er die rote Backstein-
ruine, die derjenigen von Brederode gleicht; den weiter
südlich gelegenen Bergen entlehnte er den vom Gewitter-
sturm geschwellten Bach, der, selbst die Ruhestätten der
Toten nicht verschonend, sich seinen Weg durch die ver-
fallenden Grabsteine bahnt. Es ist ein Bild der Zer-
störung aller Werke von Menschenhand, ja der eigenen
Schöpfungen der Natur durch ihre vernichtenden und
zugleich neues Leben gebärenden Kräfte. Matt nur,
einem schwachen Hoffnungsstrahl vergleichbar, wölbt der
Bogen des Friedens sich auf dem schwarzen Gewölk.
Goethe beginnt seine Schilderung des Bildes mit den
Worten: „Das dritte Bild dagegen ist allein der Ver-
gangenheit gewidmet, ohne dem gegenwärtigen Leben
irgend ein Recht zu gönnen. Man kennt es unter dem
Namen „Der Kirchhof". Es ist auch einer. Die Grab-
mäler sogar deuten in ihrem zerstörten Zustande auf
ein mehr als Vergangenes. Sie sind Grabmäler ihrer
selbst"; und späterhin sagt er: „Wer das Glück hat,
die Originale (dieser Bilder) zu sehen, durchdringe