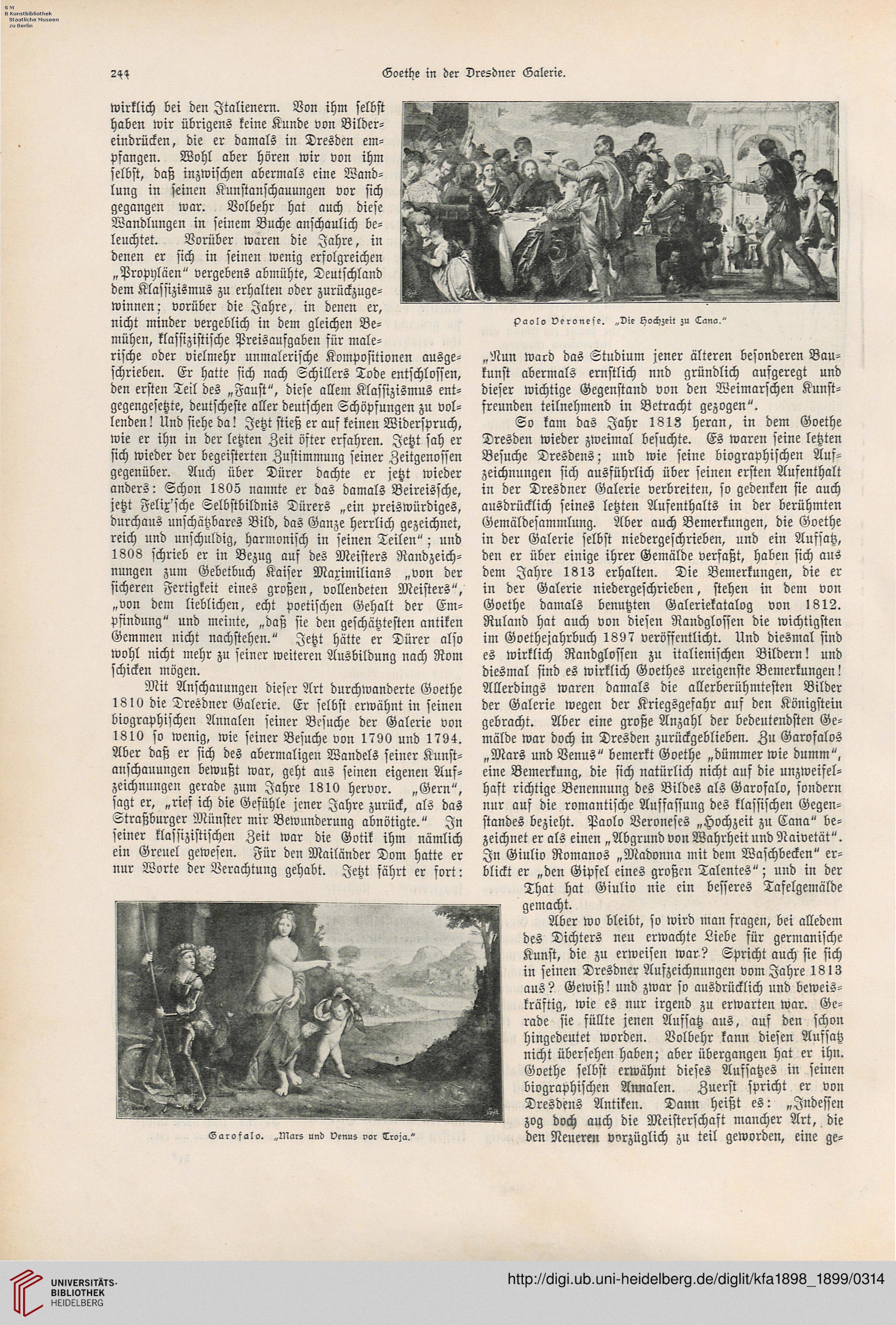Goethe in der Dresdner Galerie.
2,4
wirklich bei den Italienern. Von ihm selbst
haben wir übrigens keine Kunde von Bilder-
eindrücken, die er damals in Dresden em-
pfangen. Wohl aber hören wir von ihm
selbst, daß inzwischen abermals eine Wand-
lung in seinen Kunstanschauungen vor sich
gegangen war. Volbehr hat auch diese
Wandlungen in seinem Buche anschaulich be-
leuchtet. Vorüber waren die Jahre, in
denen er sich in seinen wenig erfolgreichen
„Propyläen" vergebens abmühte, Deutschland
dem Klassizismus zu erhalten oder zurückzuge-
winnen; vorüber die Jahre, in denen er,
nicht minder vergeblich in dem gleichen Be-
mühen, klassizistische Preisaufgaben für male-
rische oder vielmehr unmalerische Kompositionen ausge-
schrieben. Er hatte sich nach Schillers Tode entschlossen,
den ersten Teil des „Faust", diese allem Klassizismus ent-
gegengesetzte, deutscheste aller deutschen Schöpfungen zu vol-
lenden ! Und siehe da! Jetzt stieß er auf keinen Widerspruch,
wie er ihn in der letzten Zeit öfter erfahren. Jetzt sah er
sich wieder der begeisterten Zustimmung seiner Zeitgenossen
gegenüber. Auch über Dürer dachte er jetzt wieder
anders: Schon 1805 nannte er das damals Beireissche,
jetzt Felix'sche Selbstbildnis Dürers „ein preiswürdiges,
durchaus unschätzbares Bild, das Ganze herrlich gezeichnet,
reich und unschuldig, harmonisch in seinen Teilen"; und
1808 schrieb er in Bezug auf des Meisters Randzeich-
nungen zum Gebetbuch Kaiser Maximilians „von der
sicheren Fertigkeit eines großen, vollendeten Meisters",
„von dem lieblichen, echt poetischen Gehalt der Em-
pfindung" und meinte, „daß sie den geschätztesten antiken
Gemmen nicht nachstehen." Jetzt hätte er Dürer also
wohl nicht mehr zu seiner weiteren Ausbildung nach Rom
schicken mögen.
Mit Anschauungen dieser Art durchwanderte Goethe
1810 die Dresdner Galerie. Er selbst erwähnt in seinen
biographischen Annalen seiner Besuche der Galerie von
1810 so wenig, wie seiner Besuche von 1790 und 1794.
Aber daß er sich des abermaligen Wandels seiner Kunst-
anschauungen bewußt war, geht aus seinen eigenen Auf-
zeichnungen gerade zum Jahre 1810 hervor. „Gern",
sagt er, „rief ich die Gefühle jener Jahre zurück, als das
Straßburger Münster mir Bewunderung abnötigte." In
seiner klassizistischen Zeit war die Gotik ihm nämlich
ein Greuel gewesen. Für den Mailänder Dom hatte er
nur Worte der Verachtung gehabt. Jetzt fährt er fort:
„Nun ward das Studium jener älteren besonderen Bau-
kunst abermals ernstlich nnd gründlich aufgeregt und
dieser wichtige Gegenstand von den Weimarschen Kunst-
freunden teilnehmend in Betracht gezogen".
So kam das Jahr 1813 heran, in dem Goethe
Dresden wieder zweimal besuchte. Es waren seine letzten
Besuche Dresdens; und wie seine biographischen Auf-
zeichnungen sich ausführlich über seinen ersten Aufenthalt
in der Dresdner Galerie verbreiten, so gedenken sie auch
ausdrücklich seines letzten Aufenthalts in der berühmten
Gemäldesammlung. Aber auch Bemerkungen, die Goethe
in der Galerie selbst niedergeschrieben, und ein Aufsatz,
den er über einige ihrer Gemälde verfaßt, haben sich aus
dem Jahre 1813 erhalten. Die Bemerkungen, die er
in der Galerie niedergeschrieben, stehen in dem von
Goethe damals benutzten Galeriekatalog von 1812.
Ruland hat auch von diesen Randglossen die wichtigsten
im Goethejahrbuch 1897 veröffentlicht. Und diesmal sind
es wirklich Randglossen zu italienischen Bildern! und
diesmal sind es wirklich Goethes ureigenste Bemerkungen!
Allerdings waren damals die allerberühmtesten Bilder
der Galerie wegen der Kriegsgefahr auf den Königstein
gebracht. Aber eine große Anzahl der bedeutendsten Ge-
mälde war doch in Dresden zurückgeblieben. Zu Garofalos
„Mars und Venus" bemerkt Goethe „dümmer wie dumm",
eine Bemerkung, die sich natürlich nicht auf die unzweifel-
haft richtige Benennung des Bildes als Garofalo, sondern
nur auf die romantische Auffassung des klassischen Gegen-
standes bezieht. Paolo Veroneses „Hochzeit zu Cana" be-
zeichnet er als einen „Abgrund von Wahrheit und Naivetät".
In Giulio Romanos „Madonna mit dem Waschbecken" er-
blickt er „den Gipfel eines großen Talentes"; und in der
That hat Giulio nie ein besseres Tafelgemälde
gemacht.
Aber wo bleibt, so wird man fragen, bei alledem
des Dichters neu erwachte Liebe für germanische
Kunst, die zu erweisen war ? Spricht auch sie sich
in seinen Dresdner Aufzeichnungen vom Jahre 1813
aus? Gewiß! und zwar so ausdrücklich und beweis-
kräftig, wie es nur irgend zu erwarten war. Ge-
rade sie füllte jenen Aufsatz aus, auf den schon
hingedeutet worden. Volbehr kann diesen Aussatz
nicht übersehen haben; aber übergangen hat er ihn.
Goethe selbst erwähnt dieses Aufsatzes in seinen
biographischen Annalen. Zuerst spricht er von
Dresdens Antiken. Dann heißt es: „Indessen
zog doch auch die Meisterschaft mancher Art, die
den Neueren vorzüglich zu teil geworden, eine ge-
2,4
wirklich bei den Italienern. Von ihm selbst
haben wir übrigens keine Kunde von Bilder-
eindrücken, die er damals in Dresden em-
pfangen. Wohl aber hören wir von ihm
selbst, daß inzwischen abermals eine Wand-
lung in seinen Kunstanschauungen vor sich
gegangen war. Volbehr hat auch diese
Wandlungen in seinem Buche anschaulich be-
leuchtet. Vorüber waren die Jahre, in
denen er sich in seinen wenig erfolgreichen
„Propyläen" vergebens abmühte, Deutschland
dem Klassizismus zu erhalten oder zurückzuge-
winnen; vorüber die Jahre, in denen er,
nicht minder vergeblich in dem gleichen Be-
mühen, klassizistische Preisaufgaben für male-
rische oder vielmehr unmalerische Kompositionen ausge-
schrieben. Er hatte sich nach Schillers Tode entschlossen,
den ersten Teil des „Faust", diese allem Klassizismus ent-
gegengesetzte, deutscheste aller deutschen Schöpfungen zu vol-
lenden ! Und siehe da! Jetzt stieß er auf keinen Widerspruch,
wie er ihn in der letzten Zeit öfter erfahren. Jetzt sah er
sich wieder der begeisterten Zustimmung seiner Zeitgenossen
gegenüber. Auch über Dürer dachte er jetzt wieder
anders: Schon 1805 nannte er das damals Beireissche,
jetzt Felix'sche Selbstbildnis Dürers „ein preiswürdiges,
durchaus unschätzbares Bild, das Ganze herrlich gezeichnet,
reich und unschuldig, harmonisch in seinen Teilen"; und
1808 schrieb er in Bezug auf des Meisters Randzeich-
nungen zum Gebetbuch Kaiser Maximilians „von der
sicheren Fertigkeit eines großen, vollendeten Meisters",
„von dem lieblichen, echt poetischen Gehalt der Em-
pfindung" und meinte, „daß sie den geschätztesten antiken
Gemmen nicht nachstehen." Jetzt hätte er Dürer also
wohl nicht mehr zu seiner weiteren Ausbildung nach Rom
schicken mögen.
Mit Anschauungen dieser Art durchwanderte Goethe
1810 die Dresdner Galerie. Er selbst erwähnt in seinen
biographischen Annalen seiner Besuche der Galerie von
1810 so wenig, wie seiner Besuche von 1790 und 1794.
Aber daß er sich des abermaligen Wandels seiner Kunst-
anschauungen bewußt war, geht aus seinen eigenen Auf-
zeichnungen gerade zum Jahre 1810 hervor. „Gern",
sagt er, „rief ich die Gefühle jener Jahre zurück, als das
Straßburger Münster mir Bewunderung abnötigte." In
seiner klassizistischen Zeit war die Gotik ihm nämlich
ein Greuel gewesen. Für den Mailänder Dom hatte er
nur Worte der Verachtung gehabt. Jetzt fährt er fort:
„Nun ward das Studium jener älteren besonderen Bau-
kunst abermals ernstlich nnd gründlich aufgeregt und
dieser wichtige Gegenstand von den Weimarschen Kunst-
freunden teilnehmend in Betracht gezogen".
So kam das Jahr 1813 heran, in dem Goethe
Dresden wieder zweimal besuchte. Es waren seine letzten
Besuche Dresdens; und wie seine biographischen Auf-
zeichnungen sich ausführlich über seinen ersten Aufenthalt
in der Dresdner Galerie verbreiten, so gedenken sie auch
ausdrücklich seines letzten Aufenthalts in der berühmten
Gemäldesammlung. Aber auch Bemerkungen, die Goethe
in der Galerie selbst niedergeschrieben, und ein Aufsatz,
den er über einige ihrer Gemälde verfaßt, haben sich aus
dem Jahre 1813 erhalten. Die Bemerkungen, die er
in der Galerie niedergeschrieben, stehen in dem von
Goethe damals benutzten Galeriekatalog von 1812.
Ruland hat auch von diesen Randglossen die wichtigsten
im Goethejahrbuch 1897 veröffentlicht. Und diesmal sind
es wirklich Randglossen zu italienischen Bildern! und
diesmal sind es wirklich Goethes ureigenste Bemerkungen!
Allerdings waren damals die allerberühmtesten Bilder
der Galerie wegen der Kriegsgefahr auf den Königstein
gebracht. Aber eine große Anzahl der bedeutendsten Ge-
mälde war doch in Dresden zurückgeblieben. Zu Garofalos
„Mars und Venus" bemerkt Goethe „dümmer wie dumm",
eine Bemerkung, die sich natürlich nicht auf die unzweifel-
haft richtige Benennung des Bildes als Garofalo, sondern
nur auf die romantische Auffassung des klassischen Gegen-
standes bezieht. Paolo Veroneses „Hochzeit zu Cana" be-
zeichnet er als einen „Abgrund von Wahrheit und Naivetät".
In Giulio Romanos „Madonna mit dem Waschbecken" er-
blickt er „den Gipfel eines großen Talentes"; und in der
That hat Giulio nie ein besseres Tafelgemälde
gemacht.
Aber wo bleibt, so wird man fragen, bei alledem
des Dichters neu erwachte Liebe für germanische
Kunst, die zu erweisen war ? Spricht auch sie sich
in seinen Dresdner Aufzeichnungen vom Jahre 1813
aus? Gewiß! und zwar so ausdrücklich und beweis-
kräftig, wie es nur irgend zu erwarten war. Ge-
rade sie füllte jenen Aufsatz aus, auf den schon
hingedeutet worden. Volbehr kann diesen Aussatz
nicht übersehen haben; aber übergangen hat er ihn.
Goethe selbst erwähnt dieses Aufsatzes in seinen
biographischen Annalen. Zuerst spricht er von
Dresdens Antiken. Dann heißt es: „Indessen
zog doch auch die Meisterschaft mancher Art, die
den Neueren vorzüglich zu teil geworden, eine ge-