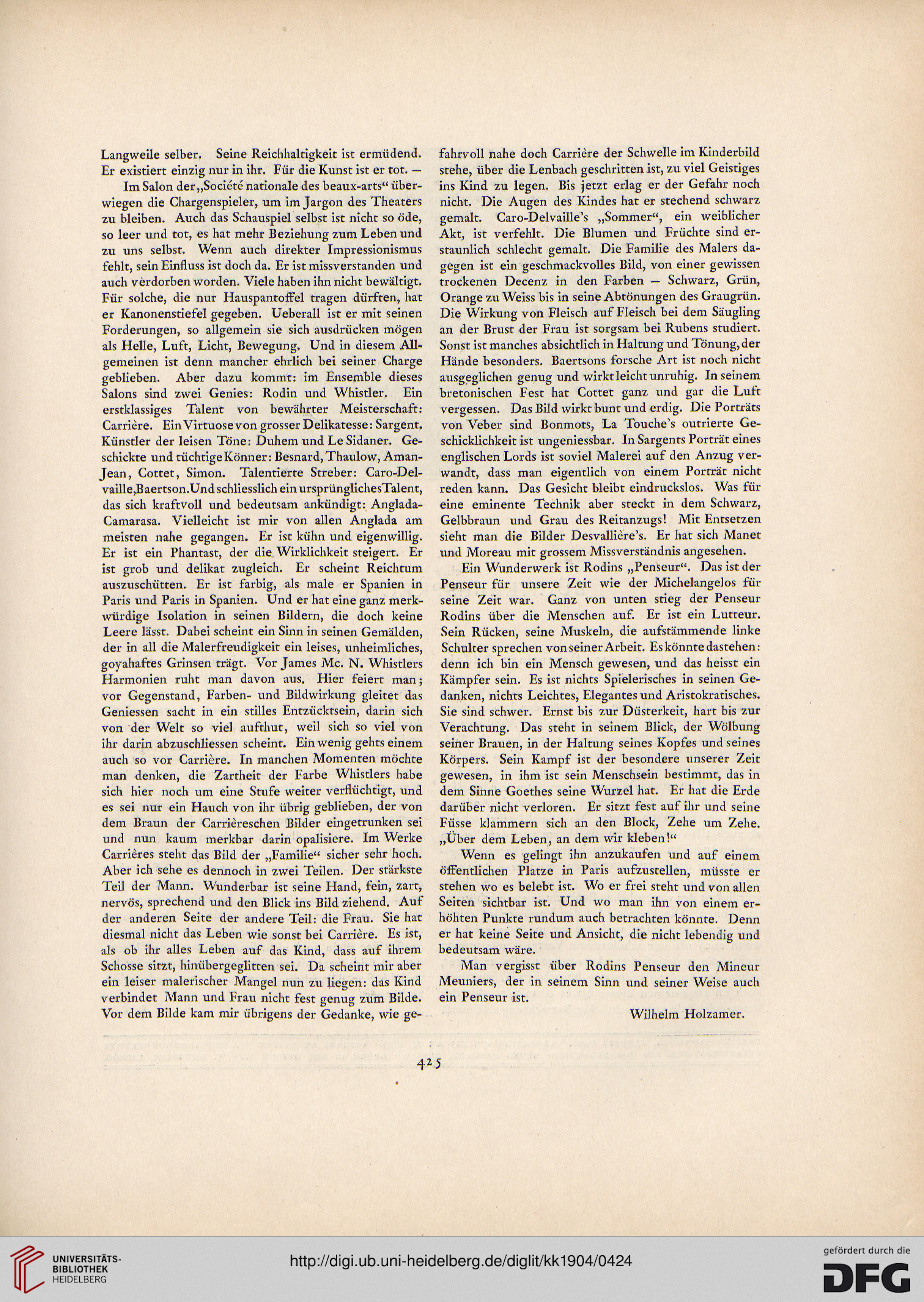Langweile selber. Seine Reichhaltigkeit ist ermüdend.
Er existiert einzig nur in ihr. Für die Kunst ist er tot. —
Im Salon der„Societe nationale des beaux-arts" über-
wiegen die Chargenspieler, um im Jargon des Theaters
zu bleiben. Auch das Schauspiel selbst ist nicht so öde,
so leer und tot, es hat mehr Beziehung zum Leben und
zu uns selbst. Wenn auch direkter Impressionismus
fehlt, sein Einfluss ist doch da. Er ist missverstanden und
auch verdorben worden. Viele haben ihn nicht bewältigt.
Für solche, die nur HauspantofFel tragen dürften, hat
er Kanonenstiefel gegeben. Ueberall ist er mit seinen
Forderungen, so allgemein sie sich ausdrücken mögen
als Helle, Luft, Licht, Bewegung. Und in diesem All-
gemeinen ist denn mancher ehrlich bei seiner Charge
geblieben. Aber dazu kommt: im Ensemble dieses
Salons sind zwei Genies: Rodin und Whistler. Ein
erstklassiges Talent von bewährter Meisterschaft:
Carriere. Ein Virtuose von grosser Delikatesse: Sargent.
Künstler der leisen Töne: Duhem und Le Sidaner. Ge-
schickte und tüchtige Könner: Besnard,Thaulow, Aman-
Jean, Cottet, Simon. Talentierte Streber: Caro-Del-
vaille,Baertson.Und schliesslich einursprünglichesTalent,
das sich kraftvoll und bedeutsam ankündigt: Anglada-
Camarasa. Vielleicht ist mir von allen Anglada am
meisten nahe gegangen. Er ist kühn und eigenwillig.
Er ist ein Phantast, der die Wirklichkeit steigert. Er
ist grob und delikat zugleich. Er scheint Reichtum
auszuschütten. Er ist farbig, als male er Spanien in
Paris und Paris in Spanien. Und er hat eine ganz merk-
würdige Isolation in seinen Bildern, die doch keine
Leere lässt. Dabei scheint ein Sinn in seinen Gemälden,
der in all die Malerfreudigkeit ein leises, unheimliches,
goyahaftes Grinsen trägt. Vor James Mc. N. Whistlers
Harmonien ruht man davon aus. Hier feiert man;
vor Gegenstand, Farben- und Bildwirkung gleitet das
Geniessen sacht in ein stilles Entzücktsein, darin sich
von der Welt so viel aufthut, weil sich so viel von
ihr darin abzuschliessen scheint. Ein wenig gehts einem
auch so vor Carri&re. In manchen Momenten möchte
man denken, die Zartheit der Farbe Whistlers habe
sich hier noch um eine Stufe weiter verflüchtigt, und
es sei nur ein Hauch von ihr übrig geblieben, der von
dem Braun der Carriereschen Bilder eingetrunken sei
und nun kaum merkbar darin opalisiere. Im Werke
Carrieres steht das Bild der „Familie" sicher sehr hoch.
Aber ich sehe es dennoch in zwei Teilen. Der stärkste
Teil der Mann. Wunderbar ist seine Hand, fein, zart,
nervös, sprechend und den Blick ins Bild ziehend. Auf
der anderen Seite der andere Teil: die Frau. Sie hat
diesmal nicht das Leben wie sonst bei Carriere. Es ist,
als ob ihr alles Leben auf das Kind, dass auf ihrem
Schosse sitzt, hinübergeglitten sei. Da scheint mir aber
ein leiser malerischer Mangel nun zu liegen: das Kind
verbindet Mann und Frau nicht fest genug zum Bilde.
Vor dem Bilde kam mir übrigens der Gedanke, wie ge-
fahrvoll nahe doch Carriere der Schwelle im Kinderbild
stehe, über die Lenbach geschritten ist, zu viel Geistiges
ins Kind zu legen. Bis jetzt erlag er der Gefahr noch
nicht. Die Augen des Kindes hat er stechend schwarz
gemalt. Caro-Delvaille's „Sommer", ein weiblicher
Akt, ist verfehlt. Die Blumen und Früchte sind er-
staunlich schlecht gemalt. Die Familie des Malers da-
gegen ist ein geschmackvolles Bild, von einer gewissen
trockenen Decenz in den Farben — Schwarz, Grün,
Orange zu Weiss bis in seine Abtönungen des Graugrün.
Die Wirkung von Fleisch auf Fleisch bei dem Säugling
an der Brust der Frau ist sorgsam bei Rubens studiert.
Sonst ist manches absichtlich in Haltung und Tönung, der
Hände besonders. Baertsons forsche Art ist noch nicht
ausgeglichen genug und wirkt leicht unruhig. In seinem
bretonischen Fest hat Cottet ganz und gar die Luft
vergessen. Das Bild wirkt bunt und erdig. Die Porträts
von Veber sind Bonmots, La Touche's outrierte Ge-
schicklichkeit ist ungeniessbar. In Sargents Porträt eines
englischen Lords ist soviel Malerei auf den Anzug ver-
wandt, dass man eigentlich von einem Porträt nicht
reden kann. Das Gesicht bleibt eindruckslos. Was für
eine eminente Technik aber steckt in dem Schwarz,
Gelbbraun und Grau des Reitanzugs! Mit Entsetzen
sieht man die Bilder Desvalliere's. Er hat sich Manet
und Moreau mit grossem Missverständnis angesehen.
Ein Wunderwerk ist Rodins „Penseur". Das ist der
Penseur für unsere Zeit wie der Michelangelos für
seine Zeit war. Ganz von unten stieg der Penseur
Rodins über die Menschen auf. Er ist ein Lutteur.
Sein Rücken, seine Muskeln, die aufstämmende linke
Schulter sprechen von seiner Arbeit. Es könnte dastehen:
denn ich bin ein Mensch gewesen, und das heisst ein
Kämpfer sein. Es ist nichts Spielerisches in seinen Ge-
danken, nichts Leichtes, Elegantes und Aristokratisches.
Sie sind schwer. Ernst bis zur Düsterkeit, hart bis zur
Verachtung. Das steht in seinem Blick, der Wölbung
seiner Brauen, in der Haltung seines Kopfes und seines
Körpers. Sein Kampf ist der besondere unserer Zeit
gewesen, in ihm ist sein Menschsein bestimmt, das in
dem Sinne Goethes seine Wurzel hat. Er hat die Erde
darüber nicht verloren. Er sitzt fest auf ihr und seine
Füsse klammern sich an den Block, Zehe um Zehe.
„Über dem Leben, an dem wir kleben!"
Wenn es gelingt ihn anzukaufen und auf einem
öffentlichen Platze in Paris aufzustellen, müsste er
stehen wo es belebt ist. Wo er frei steht und von allen
Seiten sichtbar ist. Und wo man ihn von einem er-
höhten Punkte rundum auch betrachten könnte. Denn
er hat keine Seite und Ansicht, die nicht lebendig und
bedeutsam wäre.
Man vergisst über Rodins Penseur den Mineur
Meuniers, der in seinem Sinn und seiner Weise auch
ein Penseur ist.
Wilhelm Holzamer.
4Z5
Er existiert einzig nur in ihr. Für die Kunst ist er tot. —
Im Salon der„Societe nationale des beaux-arts" über-
wiegen die Chargenspieler, um im Jargon des Theaters
zu bleiben. Auch das Schauspiel selbst ist nicht so öde,
so leer und tot, es hat mehr Beziehung zum Leben und
zu uns selbst. Wenn auch direkter Impressionismus
fehlt, sein Einfluss ist doch da. Er ist missverstanden und
auch verdorben worden. Viele haben ihn nicht bewältigt.
Für solche, die nur HauspantofFel tragen dürften, hat
er Kanonenstiefel gegeben. Ueberall ist er mit seinen
Forderungen, so allgemein sie sich ausdrücken mögen
als Helle, Luft, Licht, Bewegung. Und in diesem All-
gemeinen ist denn mancher ehrlich bei seiner Charge
geblieben. Aber dazu kommt: im Ensemble dieses
Salons sind zwei Genies: Rodin und Whistler. Ein
erstklassiges Talent von bewährter Meisterschaft:
Carriere. Ein Virtuose von grosser Delikatesse: Sargent.
Künstler der leisen Töne: Duhem und Le Sidaner. Ge-
schickte und tüchtige Könner: Besnard,Thaulow, Aman-
Jean, Cottet, Simon. Talentierte Streber: Caro-Del-
vaille,Baertson.Und schliesslich einursprünglichesTalent,
das sich kraftvoll und bedeutsam ankündigt: Anglada-
Camarasa. Vielleicht ist mir von allen Anglada am
meisten nahe gegangen. Er ist kühn und eigenwillig.
Er ist ein Phantast, der die Wirklichkeit steigert. Er
ist grob und delikat zugleich. Er scheint Reichtum
auszuschütten. Er ist farbig, als male er Spanien in
Paris und Paris in Spanien. Und er hat eine ganz merk-
würdige Isolation in seinen Bildern, die doch keine
Leere lässt. Dabei scheint ein Sinn in seinen Gemälden,
der in all die Malerfreudigkeit ein leises, unheimliches,
goyahaftes Grinsen trägt. Vor James Mc. N. Whistlers
Harmonien ruht man davon aus. Hier feiert man;
vor Gegenstand, Farben- und Bildwirkung gleitet das
Geniessen sacht in ein stilles Entzücktsein, darin sich
von der Welt so viel aufthut, weil sich so viel von
ihr darin abzuschliessen scheint. Ein wenig gehts einem
auch so vor Carri&re. In manchen Momenten möchte
man denken, die Zartheit der Farbe Whistlers habe
sich hier noch um eine Stufe weiter verflüchtigt, und
es sei nur ein Hauch von ihr übrig geblieben, der von
dem Braun der Carriereschen Bilder eingetrunken sei
und nun kaum merkbar darin opalisiere. Im Werke
Carrieres steht das Bild der „Familie" sicher sehr hoch.
Aber ich sehe es dennoch in zwei Teilen. Der stärkste
Teil der Mann. Wunderbar ist seine Hand, fein, zart,
nervös, sprechend und den Blick ins Bild ziehend. Auf
der anderen Seite der andere Teil: die Frau. Sie hat
diesmal nicht das Leben wie sonst bei Carriere. Es ist,
als ob ihr alles Leben auf das Kind, dass auf ihrem
Schosse sitzt, hinübergeglitten sei. Da scheint mir aber
ein leiser malerischer Mangel nun zu liegen: das Kind
verbindet Mann und Frau nicht fest genug zum Bilde.
Vor dem Bilde kam mir übrigens der Gedanke, wie ge-
fahrvoll nahe doch Carriere der Schwelle im Kinderbild
stehe, über die Lenbach geschritten ist, zu viel Geistiges
ins Kind zu legen. Bis jetzt erlag er der Gefahr noch
nicht. Die Augen des Kindes hat er stechend schwarz
gemalt. Caro-Delvaille's „Sommer", ein weiblicher
Akt, ist verfehlt. Die Blumen und Früchte sind er-
staunlich schlecht gemalt. Die Familie des Malers da-
gegen ist ein geschmackvolles Bild, von einer gewissen
trockenen Decenz in den Farben — Schwarz, Grün,
Orange zu Weiss bis in seine Abtönungen des Graugrün.
Die Wirkung von Fleisch auf Fleisch bei dem Säugling
an der Brust der Frau ist sorgsam bei Rubens studiert.
Sonst ist manches absichtlich in Haltung und Tönung, der
Hände besonders. Baertsons forsche Art ist noch nicht
ausgeglichen genug und wirkt leicht unruhig. In seinem
bretonischen Fest hat Cottet ganz und gar die Luft
vergessen. Das Bild wirkt bunt und erdig. Die Porträts
von Veber sind Bonmots, La Touche's outrierte Ge-
schicklichkeit ist ungeniessbar. In Sargents Porträt eines
englischen Lords ist soviel Malerei auf den Anzug ver-
wandt, dass man eigentlich von einem Porträt nicht
reden kann. Das Gesicht bleibt eindruckslos. Was für
eine eminente Technik aber steckt in dem Schwarz,
Gelbbraun und Grau des Reitanzugs! Mit Entsetzen
sieht man die Bilder Desvalliere's. Er hat sich Manet
und Moreau mit grossem Missverständnis angesehen.
Ein Wunderwerk ist Rodins „Penseur". Das ist der
Penseur für unsere Zeit wie der Michelangelos für
seine Zeit war. Ganz von unten stieg der Penseur
Rodins über die Menschen auf. Er ist ein Lutteur.
Sein Rücken, seine Muskeln, die aufstämmende linke
Schulter sprechen von seiner Arbeit. Es könnte dastehen:
denn ich bin ein Mensch gewesen, und das heisst ein
Kämpfer sein. Es ist nichts Spielerisches in seinen Ge-
danken, nichts Leichtes, Elegantes und Aristokratisches.
Sie sind schwer. Ernst bis zur Düsterkeit, hart bis zur
Verachtung. Das steht in seinem Blick, der Wölbung
seiner Brauen, in der Haltung seines Kopfes und seines
Körpers. Sein Kampf ist der besondere unserer Zeit
gewesen, in ihm ist sein Menschsein bestimmt, das in
dem Sinne Goethes seine Wurzel hat. Er hat die Erde
darüber nicht verloren. Er sitzt fest auf ihr und seine
Füsse klammern sich an den Block, Zehe um Zehe.
„Über dem Leben, an dem wir kleben!"
Wenn es gelingt ihn anzukaufen und auf einem
öffentlichen Platze in Paris aufzustellen, müsste er
stehen wo es belebt ist. Wo er frei steht und von allen
Seiten sichtbar ist. Und wo man ihn von einem er-
höhten Punkte rundum auch betrachten könnte. Denn
er hat keine Seite und Ansicht, die nicht lebendig und
bedeutsam wäre.
Man vergisst über Rodins Penseur den Mineur
Meuniers, der in seinem Sinn und seiner Weise auch
ein Penseur ist.
Wilhelm Holzamer.
4Z5