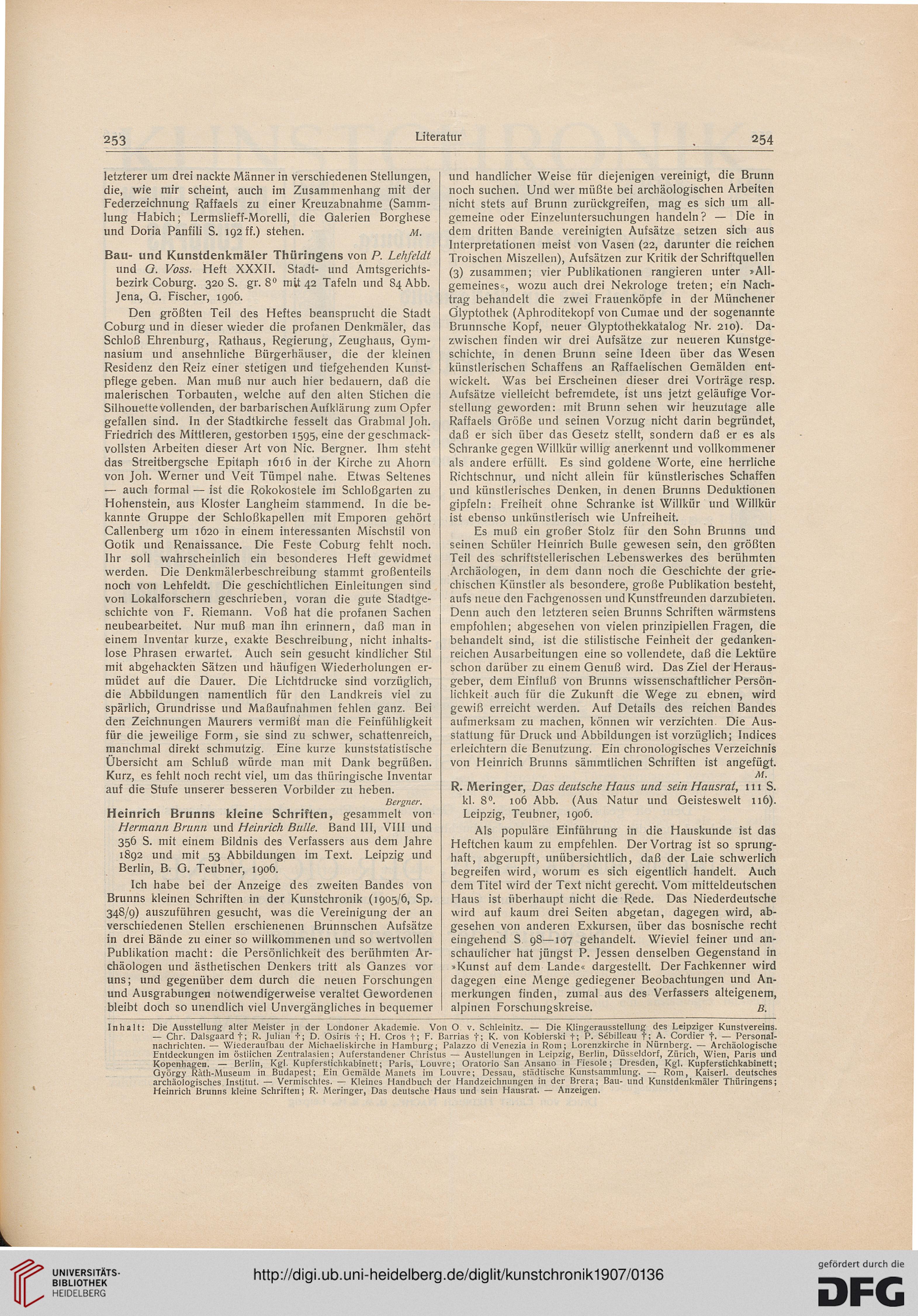253
Literatur
254
letzterer um drei nackte Männer in verschiedenen Stellungen,
die, wie mir scheint, auch im Zusammenhang mit der
Federzeichnung Raffaels zu einer Kreuzabnahme (Samm-
lung Habich; Lermslieff-Morelli, die Galerien Borghese
und Doria Panfili S. 192 ff.) stehen. m.
Bau- und Kunstdenkmäler Thüringens von P. Lehfeldt
und G. Voss. Heft XXXII. Stadt- und Amtsgerichts-
bezirk Coburg. 320 S. gr. 8° mit 42 Tafeln und 84 Abb.
Jena, O. Fischer, 1906.
Den größten Teil des Heftes beansprucht die Stadt
Coburg und in dieser wieder die profanen Denkmäler, das
Schloß Ehrenburg, Rathaus, Regierung, Zeughaus, Gym-
nasium und ansehnliche Bürgerhäuser, die der kleinen
Residenz den Reiz einer stetigen und tiefgehenden Kunst-
pflege geben. Man muß nur auch hier bedauern, daß die
malerischen Torbauten, welche auf den alten Stichen die
Silhouette vollenden, der barbarischen Aufklärung zum Opfer
gefallen sind. In der Stadtkirche fesselt das Grabmal Joh.
Friedrich des Mittleren, gestorben 1595, eine der geschmack-
vollsten Arbeiten dieser Art von Nie. Bergner. Ihm steht
das Streitbergsche Epitaph 1616 in der Kirche zu Ahorn
von Joh. Werner und Veit Tümpel nahe. Etwas Seltenes
— auch formal — ist die Rokokostele im Schloßgarten zu
Hohenstein, aus Kloster Langheim stammend. In die be-
kannte Gruppe der Schloßkapellen mit Emporen gehört
Callenberg um 1620 in einem interessanten Mischstil von
Gotik und Renaissance. Die Feste Coburg fehlt noch.
Ihr soll wahrscheinlich ein besonderes Heft gewidmet
werden. Die Denkmälerbeschreibung stammt großenteils
noch von Lehfeldt. Die geschichtlichen Einleitungen sind
von Lokalforschern geschrieben, voran die gute Stadtge-
schichte von F. Riemann. Voß hat die profanen Sachen
neubearbeitet. Nur muß man ihn erinnern, daß man in
einem Inventar kurze, exakte Beschreibung, nicht inhalts-
lose Phrasen erwartet. Auch sein gesucht kindlicher Stil
mit abgehackten Sätzen und häufigen Wiederholungen er-
müdet auf die Dauer. Die Lichtdrucke sind vorzüglich,
die Abbildungen namentlich für den Landkreis viel zu
spärlich, Grundrisse und Maßaufnahmen fehlen ganz. Bei
den Zeichnungen Maurers vermißt man die Feinfühligkeit
für die jeweilige Form, sie sind zu schwer, schattenreich,
manchmal direkt schmutzig. Eine kurze kunststatistische
Übersicht am Schluß würde man mit Dank begrüßen.
Kurz, es fehlt noch recht viel, um das thüringische Inventar
auf die Stufe unserer besseren Vorbilder zu heben.
Bergner.
Heinrich Brunns kleine Schriften, gesammelt von
Hermann Brunn und Heinrich Bulle. Band III, VIII und
356 S. mit einem Bildnis des Verfassers aus dem Jahre
1892 und mit 53 Abbildungen im Text. Leipzig und
Berlin, B. G. Teubner, 1906.
Ich habe bei der Anzeige des zweiten Bandes von
Brunns kleinen Schriften in der Kunstchronik (1905/6, Sp.
348/9) auszuführen gesucht, was die Vereinigung der an
verschiedenen Stellen erschienenen Brunnschen Aufsätze
in drei Bände zu einer so willkommenen und so wertvollen
Publikation macht: die Persönlichkeit des berühmten Ar-
chäologen und ästhetischen Denkers tritt als Ganzes vor
uns; und gegenüber dem durch die neuen Forschungen
und Ausgrabungen notwendigerweise veraltet Gewordenen
bleibt doch so unendlich viel Unvergängliches in bequemer
und handlicher Weise für diejenigen vereinigt, die Brunn
noch suchen. Und wer müßte bei archäologischen Arbeiten
nicht stets auf Brunn zurückgreifen, mag es sich um all-
gemeine oder Einzeluntersuchungen handeln? — Die in
dem dritten Bande vereinigten Aufsätze setzen sich aus
Interpretationen meist von Vasen (22, darunter die reichen
Troischen Miszellen), Aufsätzen zur Kritik der Schriftquellen
(3) zusammen; vier Publikationen rangieren unter »All-
gemeines«, wozu auch drei Nekrologe treten; ein Nach-
trag behandelt die zwei Frauenköpfe in der Münchener
Glyptothek (Aphroditekopf von Cumae und der sogenannte
Brunnsche Kopf, neuer Glyptothekkatalog Nr. 210). Da-
zwischen finden wir drei Aufsätze zur neueren Kunstge-
schichte, in denen Brunn seine Ideen über das Wesen
künstlerischen Schaffens an Raffaelischen Gemälden ent-
wickelt. Was bei Erscheinen dieser drei Vorträge resp.
Aufsätze vielleicht befremdete, ist uns jetzt geläufige Vor-
stellung geworden: mit Brunn sehen wir heuzutage alle
Raffaels Größe und seinen Vorzug nicht darin begründet,
daß er sich über das Gesetz stellt, sondern daß er es als
Schranke gegen Willkür willig anerkennt und vollkommener
als andere erfüllt. Es sind goldene Worte, eine herrliche
Richtschnur, und nicht allein für künstlerisches Schaffen
und künstlerisches Denken, in denen Brunns Deduktionen
gipfeln: Freiheit ohne Schranke ist Willkür und Willkür
ist ebenso unkünstlerisch wie Unfreiheit.
Es muß ein großer Stolz für den Sohn Brunns und
seinen Schüler Heinrich Bulle gewesen sein, den größten
Teil des schriftstellerischen Lebenswerkes des berühmten
Archäologen, in dem dann noch die Geschichte der grie-
chischen Künstler als besondere, große Publikation besteht,
aufs neue den Fachgenossen und Kunstfreunden darzubieten.
Denn auch den letzteren seien Brunns Schriften wärmstens
empfohlen; abgesehen von vielen prinzipiellen Fragen, die
behandelt sind, ist die stilistische Feinheit der gedanken-
reichen Ausarbeitungen eine so vollendete, daß die Lektüre
schon darüber zu einem Genuß wird. Das Ziel der Heraus-
geber, dem Einfluß von Brunns wissenschaftlicher Persön-
lichkeit auch für die Zukunft die Wege zu ebnen, wird
gewiß erreicht werden. Auf Details des reichen Bandes
aufmerksam zu machen, können wir verzichten Die Aus-
stattung für Druck und Abbildungen ist vorzüglich; Indices
erleichtern die Benutzung. Ein chronologisches Verzeichnis
von Heinrich Brunns sämmtlichen Schriften ist angefügt.
m.
R. Meringer, Das deutsche Haus und sein Hausrat, 111 S.
kl. 8°. 106 Abb. (Aus Natur und Geisteswelt 116).
Leipzig, Teubner, 1906.
Als populäre Einführung in die Hauskunde ist das
Heftchen kaum zu empfehlen. Der Vortrag ist so sprung-
haft, abgerupft, unübersichtlich, daß der Laie schwerlich
begreifen wird, worum es sich eigentlich handelt. Auch
dem Titel wird der Text nicht gerecht. Vom mitteldeutschen
Haus ist überhaupt nicht die Rede. Das Niederdeutsche
wird auf kaum drei Seiten abgetan, dagegen wird, ab-
gesehen von anderen Exkursen, über das bosnische recht
eingehend S 98—107 gehandelt. Wieviel feiner und an-
schaulicher hat jüngst P. Jessen denselben Gegenstand in
»Kunst auf dem Lande« dargestellt. Der Fachkenner wird
dagegen eine Menge gediegener Beobachtungen und An-
merkungen finden, zumal aus des Verfassers alteigenem,
alpinen Forschungskreise. b.
Inhalt: Die Ausstellung alter Meister in der Londoner Akademie. Von O. v. Schleinitz. — Die Klingerausstellung des Leipziger Kunstvereins.
— Chr. Dalsgaard t; R- Julian + ; D. Osiris t; H. Cros t; F. Barrias ti K. von Kobierski t; P. Sebiileau t; A. Cordier f. — Personal-
nachrichten. — Wiederaufbau der Michaeliskirche in Hamburg; Palazzo di Venezia in Rom; Lorenzkirche in Nürnberg. — Archäologische
Entdeckungen im östlichen Zentralasien; Auferstandener Christus — Austellungen in Leipzig, Berlin, Düsseldorf, Zürich, Wien, Paris und
Kopenhagen. — Berlin, Kgl. Kupferstichkabinett; Paris, Louvre; Oratorio San Ansano in Fiesole; Dresden, Kgl. Kupferstichkabinett;
Oyörgy Räth-Museum in Budapest; Ein Gemälde Manets im Louvre; Dessau, städtische Kunstsammlung. — Rom, Kaiserl. deutsches
archäologisches Institut. — Vermischtes. — Kleines Handbuch der Handzeichnungen in der Brera; Bau- und Kunstdenkmäler Thüringens;
Heinrich Brunns kleine Schriften; R. Meringer, Das deutsche Haus und sein Hausrat. — Anzeigen.
Literatur
254
letzterer um drei nackte Männer in verschiedenen Stellungen,
die, wie mir scheint, auch im Zusammenhang mit der
Federzeichnung Raffaels zu einer Kreuzabnahme (Samm-
lung Habich; Lermslieff-Morelli, die Galerien Borghese
und Doria Panfili S. 192 ff.) stehen. m.
Bau- und Kunstdenkmäler Thüringens von P. Lehfeldt
und G. Voss. Heft XXXII. Stadt- und Amtsgerichts-
bezirk Coburg. 320 S. gr. 8° mit 42 Tafeln und 84 Abb.
Jena, O. Fischer, 1906.
Den größten Teil des Heftes beansprucht die Stadt
Coburg und in dieser wieder die profanen Denkmäler, das
Schloß Ehrenburg, Rathaus, Regierung, Zeughaus, Gym-
nasium und ansehnliche Bürgerhäuser, die der kleinen
Residenz den Reiz einer stetigen und tiefgehenden Kunst-
pflege geben. Man muß nur auch hier bedauern, daß die
malerischen Torbauten, welche auf den alten Stichen die
Silhouette vollenden, der barbarischen Aufklärung zum Opfer
gefallen sind. In der Stadtkirche fesselt das Grabmal Joh.
Friedrich des Mittleren, gestorben 1595, eine der geschmack-
vollsten Arbeiten dieser Art von Nie. Bergner. Ihm steht
das Streitbergsche Epitaph 1616 in der Kirche zu Ahorn
von Joh. Werner und Veit Tümpel nahe. Etwas Seltenes
— auch formal — ist die Rokokostele im Schloßgarten zu
Hohenstein, aus Kloster Langheim stammend. In die be-
kannte Gruppe der Schloßkapellen mit Emporen gehört
Callenberg um 1620 in einem interessanten Mischstil von
Gotik und Renaissance. Die Feste Coburg fehlt noch.
Ihr soll wahrscheinlich ein besonderes Heft gewidmet
werden. Die Denkmälerbeschreibung stammt großenteils
noch von Lehfeldt. Die geschichtlichen Einleitungen sind
von Lokalforschern geschrieben, voran die gute Stadtge-
schichte von F. Riemann. Voß hat die profanen Sachen
neubearbeitet. Nur muß man ihn erinnern, daß man in
einem Inventar kurze, exakte Beschreibung, nicht inhalts-
lose Phrasen erwartet. Auch sein gesucht kindlicher Stil
mit abgehackten Sätzen und häufigen Wiederholungen er-
müdet auf die Dauer. Die Lichtdrucke sind vorzüglich,
die Abbildungen namentlich für den Landkreis viel zu
spärlich, Grundrisse und Maßaufnahmen fehlen ganz. Bei
den Zeichnungen Maurers vermißt man die Feinfühligkeit
für die jeweilige Form, sie sind zu schwer, schattenreich,
manchmal direkt schmutzig. Eine kurze kunststatistische
Übersicht am Schluß würde man mit Dank begrüßen.
Kurz, es fehlt noch recht viel, um das thüringische Inventar
auf die Stufe unserer besseren Vorbilder zu heben.
Bergner.
Heinrich Brunns kleine Schriften, gesammelt von
Hermann Brunn und Heinrich Bulle. Band III, VIII und
356 S. mit einem Bildnis des Verfassers aus dem Jahre
1892 und mit 53 Abbildungen im Text. Leipzig und
Berlin, B. G. Teubner, 1906.
Ich habe bei der Anzeige des zweiten Bandes von
Brunns kleinen Schriften in der Kunstchronik (1905/6, Sp.
348/9) auszuführen gesucht, was die Vereinigung der an
verschiedenen Stellen erschienenen Brunnschen Aufsätze
in drei Bände zu einer so willkommenen und so wertvollen
Publikation macht: die Persönlichkeit des berühmten Ar-
chäologen und ästhetischen Denkers tritt als Ganzes vor
uns; und gegenüber dem durch die neuen Forschungen
und Ausgrabungen notwendigerweise veraltet Gewordenen
bleibt doch so unendlich viel Unvergängliches in bequemer
und handlicher Weise für diejenigen vereinigt, die Brunn
noch suchen. Und wer müßte bei archäologischen Arbeiten
nicht stets auf Brunn zurückgreifen, mag es sich um all-
gemeine oder Einzeluntersuchungen handeln? — Die in
dem dritten Bande vereinigten Aufsätze setzen sich aus
Interpretationen meist von Vasen (22, darunter die reichen
Troischen Miszellen), Aufsätzen zur Kritik der Schriftquellen
(3) zusammen; vier Publikationen rangieren unter »All-
gemeines«, wozu auch drei Nekrologe treten; ein Nach-
trag behandelt die zwei Frauenköpfe in der Münchener
Glyptothek (Aphroditekopf von Cumae und der sogenannte
Brunnsche Kopf, neuer Glyptothekkatalog Nr. 210). Da-
zwischen finden wir drei Aufsätze zur neueren Kunstge-
schichte, in denen Brunn seine Ideen über das Wesen
künstlerischen Schaffens an Raffaelischen Gemälden ent-
wickelt. Was bei Erscheinen dieser drei Vorträge resp.
Aufsätze vielleicht befremdete, ist uns jetzt geläufige Vor-
stellung geworden: mit Brunn sehen wir heuzutage alle
Raffaels Größe und seinen Vorzug nicht darin begründet,
daß er sich über das Gesetz stellt, sondern daß er es als
Schranke gegen Willkür willig anerkennt und vollkommener
als andere erfüllt. Es sind goldene Worte, eine herrliche
Richtschnur, und nicht allein für künstlerisches Schaffen
und künstlerisches Denken, in denen Brunns Deduktionen
gipfeln: Freiheit ohne Schranke ist Willkür und Willkür
ist ebenso unkünstlerisch wie Unfreiheit.
Es muß ein großer Stolz für den Sohn Brunns und
seinen Schüler Heinrich Bulle gewesen sein, den größten
Teil des schriftstellerischen Lebenswerkes des berühmten
Archäologen, in dem dann noch die Geschichte der grie-
chischen Künstler als besondere, große Publikation besteht,
aufs neue den Fachgenossen und Kunstfreunden darzubieten.
Denn auch den letzteren seien Brunns Schriften wärmstens
empfohlen; abgesehen von vielen prinzipiellen Fragen, die
behandelt sind, ist die stilistische Feinheit der gedanken-
reichen Ausarbeitungen eine so vollendete, daß die Lektüre
schon darüber zu einem Genuß wird. Das Ziel der Heraus-
geber, dem Einfluß von Brunns wissenschaftlicher Persön-
lichkeit auch für die Zukunft die Wege zu ebnen, wird
gewiß erreicht werden. Auf Details des reichen Bandes
aufmerksam zu machen, können wir verzichten Die Aus-
stattung für Druck und Abbildungen ist vorzüglich; Indices
erleichtern die Benutzung. Ein chronologisches Verzeichnis
von Heinrich Brunns sämmtlichen Schriften ist angefügt.
m.
R. Meringer, Das deutsche Haus und sein Hausrat, 111 S.
kl. 8°. 106 Abb. (Aus Natur und Geisteswelt 116).
Leipzig, Teubner, 1906.
Als populäre Einführung in die Hauskunde ist das
Heftchen kaum zu empfehlen. Der Vortrag ist so sprung-
haft, abgerupft, unübersichtlich, daß der Laie schwerlich
begreifen wird, worum es sich eigentlich handelt. Auch
dem Titel wird der Text nicht gerecht. Vom mitteldeutschen
Haus ist überhaupt nicht die Rede. Das Niederdeutsche
wird auf kaum drei Seiten abgetan, dagegen wird, ab-
gesehen von anderen Exkursen, über das bosnische recht
eingehend S 98—107 gehandelt. Wieviel feiner und an-
schaulicher hat jüngst P. Jessen denselben Gegenstand in
»Kunst auf dem Lande« dargestellt. Der Fachkenner wird
dagegen eine Menge gediegener Beobachtungen und An-
merkungen finden, zumal aus des Verfassers alteigenem,
alpinen Forschungskreise. b.
Inhalt: Die Ausstellung alter Meister in der Londoner Akademie. Von O. v. Schleinitz. — Die Klingerausstellung des Leipziger Kunstvereins.
— Chr. Dalsgaard t; R- Julian + ; D. Osiris t; H. Cros t; F. Barrias ti K. von Kobierski t; P. Sebiileau t; A. Cordier f. — Personal-
nachrichten. — Wiederaufbau der Michaeliskirche in Hamburg; Palazzo di Venezia in Rom; Lorenzkirche in Nürnberg. — Archäologische
Entdeckungen im östlichen Zentralasien; Auferstandener Christus — Austellungen in Leipzig, Berlin, Düsseldorf, Zürich, Wien, Paris und
Kopenhagen. — Berlin, Kgl. Kupferstichkabinett; Paris, Louvre; Oratorio San Ansano in Fiesole; Dresden, Kgl. Kupferstichkabinett;
Oyörgy Räth-Museum in Budapest; Ein Gemälde Manets im Louvre; Dessau, städtische Kunstsammlung. — Rom, Kaiserl. deutsches
archäologisches Institut. — Vermischtes. — Kleines Handbuch der Handzeichnungen in der Brera; Bau- und Kunstdenkmäler Thüringens;
Heinrich Brunns kleine Schriften; R. Meringer, Das deutsche Haus und sein Hausrat. — Anzeigen.