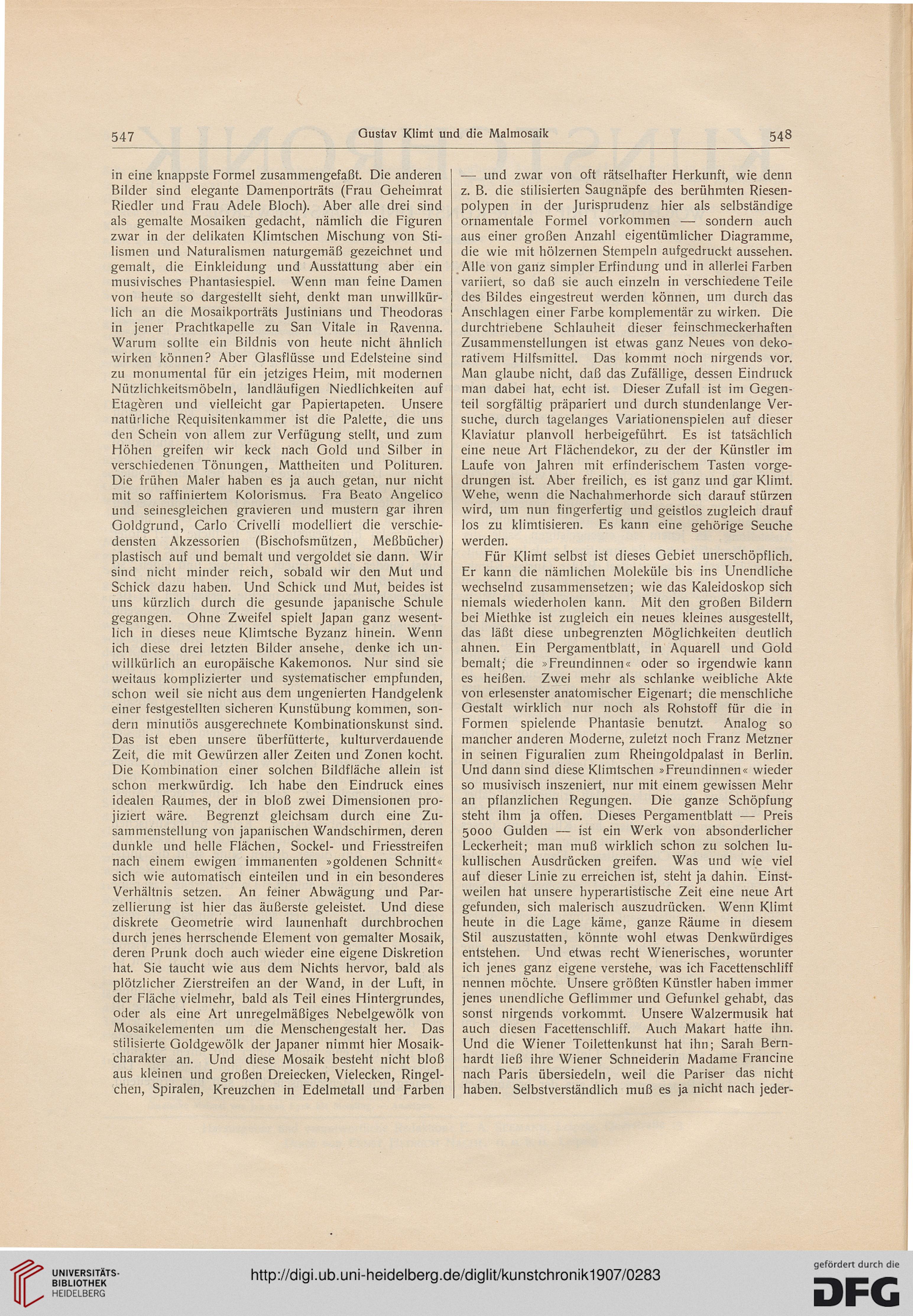547
Gustav Klimt und die Malmosaik
548
in eine knappste Formel zusammengefaßt. Die anderen
Bilder sind elegante Damenporträts (Frau Geheimrat
Riedler und Frau Adele Bloch). Aber alle drei sind
als gemalte Mosaiken gedacht, nämlich die Figuren
zwar in der delikaten Klimtschen Mischung von Sti-
lismen und Naturalismen naturgemäß gezeichnet und
gemalt, die Einkleidung und Ausstattung aber ein
musivisches Phantasiespiel. Wenn man feine Damen
von heute so dargestellt sieht, denkt man unwillkür-
lich an die Mosaikporträts Justinians und Theodoras
in jener Prachtkapelle zu San Vitale in Ravenna.
Warum sollte ein Bildnis von heute nicht ähnlich
wirken können? Aber Glasflüsse und Edelsteine sind
zu monumental für ein jetziges Heim, mit modernen
Nützlichkeitsmöbeln, landläufigen Niedlichkeiten auf
Etageren und vielleicht gar Papiertapeten. Unsere
natürliche Requisitenkammer ist die Palette, die uns
den Schein von allem zur Verfügung stellt, und zum
Höhen greifen wir keck nach Gold und Silber in
verschiedenen Tönungen, Mattheiten und Polituren.
Die frühen Maler haben es ja auch getan, nur nicht
mit so raffiniertem Kolorismus. Fra Beato Angelico
und seinesgleichen gravieren und mustern gar ihren
Goldgrund, Carlo Crivelli modelliert die verschie-
densten Akzessorien (Bischofsmützen, Meßbücher)
plastisch auf und bemalt und vergoldet sie dann. Wir
sind nicht minder reich, sobald wir den Mut und
Schick dazu haben. Und Schick und Mut, beides ist
uns kürzlich durch die gesunde japanische Schule
gegangen. Ohne Zweifel spielt Japan ganz wesent-
lich in dieses neue Klimtsche Byzanz hinein. Wenn
ich diese drei letzten Bilder ansehe, denke ich un-
willkürlich an europäische Kakemonos. Nur sind sie
weitaus komplizierter und systematischer empfunden,
schon weil sie nicht aus dem ungenierten Handgelenk
einer festgestellten sicheren Kunstübung kommen, son-
dern minutiös ausgerechnete Kombinationskunst sind.
Das ist eben unsere überfütterte, kulturverdauende
Zeit, die mit Gewürzen aller Zeiten und Zonen kocht.
Die Kombination einer solchen Bildfläche allein ist
schon merkwürdig. Ich habe den Eindruck eines
idealen Raumes, der in bloß zwei Dimensionen pro-
jiziert wäre. Begrenzt gleichsam durch eine Zu-
sammenstellung von japanischen Wandschirmen, deren
dunkle und helle Flächen, Sockel- und Friesstreifen
nach einem ewigen immanenten »goldenen Schnitt«
sich wie automatisch einteilen und in ein besonderes
Verhältnis setzen. An feiner Abwägung und Par-
zellierung ist hier das äußerste geleistet. Und diese
diskrete Geometrie wird launenhaft durchbrochen
durch jenes herrschende Element von gemalter Mosaik,
deren Prunk doch auch wieder eine eigene Diskretion
hat. Sie taucht wie aus dem Nichts hervor, bald als
plötzlicher Zierstreifen an der Wand, in der Luft, in
der Fläche vielmehr, bald als Teil eines Hintergrundes,
oder als eine Art unregelmäßiges Nebelgewölk von
Mosaikelementen um die Menschengestalt her. Das
stilisierte Goldgewölk der Japaner nimmt hier Mosaik-
charakter an. Und diese Mosaik besteht nicht bloß
aus kleinen und großen Dreiecken, Vielecken, Ringel-
chen, Spiralen, Kreuzchen in Edelmetall und Farben
— und zwar von oft rätselhafter Herkunft, wie denn
z. B. die stilisierten Saugnäpfe des berühmten Riesen-
polypen in der Jurisprudenz hier als selbständige
ornamentale Formel vorkommen — sondern auch
aus einer großen Anzahl eigentümlicher Diagramme,
die wie mit hölzernen Stempeln aufgedruckt aussehen.
Alle von ganz simpler Erfindung und in allerlei Farben
variiert, so daß sie auch einzeln in verschiedene Teile
des Bildes eingestreut werden können, um durch das
Anschlagen einer Farbe komplementär zu wirken. Die
durchtriebene Schlauheit dieser feinschmeckerhaften
Zusammenstellungen ist etwas ganz Neues von deko-
rativem Hilfsmittel. Das kommt noch nirgends vor.
Man glaube nicht, daß das Zufällige, dessen Eindruck
man dabei hat, echt ist. Dieser Zufall ist im Gegen-
teil sorgfältig präpariert und durch stundenlange Ver-
suche, durch tagelanges Variationenspielen auf dieser
Klaviatur planvoll herbeigeführt. Es ist tatsächlich
eine neue Art Flächendekor, zu der der Künstler im
Laufe von Jahren mit erfinderischem Tasten vorge-
drungen ist. Aber freilich, es ist ganz und gar Klimt.
Wehe, wenn die Nachahmerhorde sich darauf stürzen
wird, um nun fingerfertig und geistlos zugleich drauf
los zu klimtisieren. Es kann eine gehörige Seuche
werden.
Für Klimt selbst ist dieses Gebiet unerschöpflich.
Er kann die nämlichen Moleküle bis ins Unendliche
wechselnd zusammensetzen; wie das Kaleidoskop sich
niemals wiederholen kann. Mit den großen Bildern
bei Miethke ist zugleich ein neues kleines ausgestellt,
das läßt diese unbegrenzten Möglichkeiten deutlich
ahnen. Ein Pergamentblatt, in Aquarell und Gold
bemalt; die »Freundinnen« oder so irgendwie kann
es heißen. Zwei mehr als schlanke weibliche Akte
von erlesenster anatomischer Eigenart; die menschliche
Gestalt wirklich nur noch als Rohstoff für die in
Formen spielende Phantasie benutzt. Analog so
mancher anderen Moderne, zuletzt noch Franz Metzner
in seinen Figuralien zum Rheingoldpalast in Berlin.
Und dann sind diese Klimtschen »Freundinnen« wieder
so musivisch inszeniert, nur mit einem gewissen Mehr
an pflanzlichen Regungen. Die ganze Schöpfung
steht ihm ja offen. Dieses Pergamentblatt — Preis
5000 Gulden — ist ein Werk von absonderlicher
Leckerheit; man muß wirklich schon zu solchen lu-
kullischen Ausdrücken greifen. Was und wie viel
auf dieser Linie zu erreichen ist, steht ja dahin. Einst-
weilen hat unsere hyperartistische Zeit eine neue Art
gefunden, sich malerisch auszudrücken. Wenn Klimt
heute in die Lage käme, ganze Räume in diesem
Stil auszustatten, könnte wohl etwas Denkwürdiges
entstehen. Und etwas recht Wienerisches, worunter
ich jenes ganz eigene verstehe, was ich Facettenschliff
nennen möchte. Unsere größten Künstler haben immer
jenes unendliche Geflimmer und Gefunkel gehabt, das
sonst nirgends vorkommt. Unsere Walzermusik hat
auch diesen Facettenschliff. Auch Makart hatte ihn.
Und die Wiener Toilettenkunst hat ihn; Sarah Bern-
hardt ließ ihre Wiener Schneiderin Madame Francine
nach Paris übersiedeln, weil die Pariser das nicht
haben. Selbstverständlich muß es ja nicht nach jeder-
Gustav Klimt und die Malmosaik
548
in eine knappste Formel zusammengefaßt. Die anderen
Bilder sind elegante Damenporträts (Frau Geheimrat
Riedler und Frau Adele Bloch). Aber alle drei sind
als gemalte Mosaiken gedacht, nämlich die Figuren
zwar in der delikaten Klimtschen Mischung von Sti-
lismen und Naturalismen naturgemäß gezeichnet und
gemalt, die Einkleidung und Ausstattung aber ein
musivisches Phantasiespiel. Wenn man feine Damen
von heute so dargestellt sieht, denkt man unwillkür-
lich an die Mosaikporträts Justinians und Theodoras
in jener Prachtkapelle zu San Vitale in Ravenna.
Warum sollte ein Bildnis von heute nicht ähnlich
wirken können? Aber Glasflüsse und Edelsteine sind
zu monumental für ein jetziges Heim, mit modernen
Nützlichkeitsmöbeln, landläufigen Niedlichkeiten auf
Etageren und vielleicht gar Papiertapeten. Unsere
natürliche Requisitenkammer ist die Palette, die uns
den Schein von allem zur Verfügung stellt, und zum
Höhen greifen wir keck nach Gold und Silber in
verschiedenen Tönungen, Mattheiten und Polituren.
Die frühen Maler haben es ja auch getan, nur nicht
mit so raffiniertem Kolorismus. Fra Beato Angelico
und seinesgleichen gravieren und mustern gar ihren
Goldgrund, Carlo Crivelli modelliert die verschie-
densten Akzessorien (Bischofsmützen, Meßbücher)
plastisch auf und bemalt und vergoldet sie dann. Wir
sind nicht minder reich, sobald wir den Mut und
Schick dazu haben. Und Schick und Mut, beides ist
uns kürzlich durch die gesunde japanische Schule
gegangen. Ohne Zweifel spielt Japan ganz wesent-
lich in dieses neue Klimtsche Byzanz hinein. Wenn
ich diese drei letzten Bilder ansehe, denke ich un-
willkürlich an europäische Kakemonos. Nur sind sie
weitaus komplizierter und systematischer empfunden,
schon weil sie nicht aus dem ungenierten Handgelenk
einer festgestellten sicheren Kunstübung kommen, son-
dern minutiös ausgerechnete Kombinationskunst sind.
Das ist eben unsere überfütterte, kulturverdauende
Zeit, die mit Gewürzen aller Zeiten und Zonen kocht.
Die Kombination einer solchen Bildfläche allein ist
schon merkwürdig. Ich habe den Eindruck eines
idealen Raumes, der in bloß zwei Dimensionen pro-
jiziert wäre. Begrenzt gleichsam durch eine Zu-
sammenstellung von japanischen Wandschirmen, deren
dunkle und helle Flächen, Sockel- und Friesstreifen
nach einem ewigen immanenten »goldenen Schnitt«
sich wie automatisch einteilen und in ein besonderes
Verhältnis setzen. An feiner Abwägung und Par-
zellierung ist hier das äußerste geleistet. Und diese
diskrete Geometrie wird launenhaft durchbrochen
durch jenes herrschende Element von gemalter Mosaik,
deren Prunk doch auch wieder eine eigene Diskretion
hat. Sie taucht wie aus dem Nichts hervor, bald als
plötzlicher Zierstreifen an der Wand, in der Luft, in
der Fläche vielmehr, bald als Teil eines Hintergrundes,
oder als eine Art unregelmäßiges Nebelgewölk von
Mosaikelementen um die Menschengestalt her. Das
stilisierte Goldgewölk der Japaner nimmt hier Mosaik-
charakter an. Und diese Mosaik besteht nicht bloß
aus kleinen und großen Dreiecken, Vielecken, Ringel-
chen, Spiralen, Kreuzchen in Edelmetall und Farben
— und zwar von oft rätselhafter Herkunft, wie denn
z. B. die stilisierten Saugnäpfe des berühmten Riesen-
polypen in der Jurisprudenz hier als selbständige
ornamentale Formel vorkommen — sondern auch
aus einer großen Anzahl eigentümlicher Diagramme,
die wie mit hölzernen Stempeln aufgedruckt aussehen.
Alle von ganz simpler Erfindung und in allerlei Farben
variiert, so daß sie auch einzeln in verschiedene Teile
des Bildes eingestreut werden können, um durch das
Anschlagen einer Farbe komplementär zu wirken. Die
durchtriebene Schlauheit dieser feinschmeckerhaften
Zusammenstellungen ist etwas ganz Neues von deko-
rativem Hilfsmittel. Das kommt noch nirgends vor.
Man glaube nicht, daß das Zufällige, dessen Eindruck
man dabei hat, echt ist. Dieser Zufall ist im Gegen-
teil sorgfältig präpariert und durch stundenlange Ver-
suche, durch tagelanges Variationenspielen auf dieser
Klaviatur planvoll herbeigeführt. Es ist tatsächlich
eine neue Art Flächendekor, zu der der Künstler im
Laufe von Jahren mit erfinderischem Tasten vorge-
drungen ist. Aber freilich, es ist ganz und gar Klimt.
Wehe, wenn die Nachahmerhorde sich darauf stürzen
wird, um nun fingerfertig und geistlos zugleich drauf
los zu klimtisieren. Es kann eine gehörige Seuche
werden.
Für Klimt selbst ist dieses Gebiet unerschöpflich.
Er kann die nämlichen Moleküle bis ins Unendliche
wechselnd zusammensetzen; wie das Kaleidoskop sich
niemals wiederholen kann. Mit den großen Bildern
bei Miethke ist zugleich ein neues kleines ausgestellt,
das läßt diese unbegrenzten Möglichkeiten deutlich
ahnen. Ein Pergamentblatt, in Aquarell und Gold
bemalt; die »Freundinnen« oder so irgendwie kann
es heißen. Zwei mehr als schlanke weibliche Akte
von erlesenster anatomischer Eigenart; die menschliche
Gestalt wirklich nur noch als Rohstoff für die in
Formen spielende Phantasie benutzt. Analog so
mancher anderen Moderne, zuletzt noch Franz Metzner
in seinen Figuralien zum Rheingoldpalast in Berlin.
Und dann sind diese Klimtschen »Freundinnen« wieder
so musivisch inszeniert, nur mit einem gewissen Mehr
an pflanzlichen Regungen. Die ganze Schöpfung
steht ihm ja offen. Dieses Pergamentblatt — Preis
5000 Gulden — ist ein Werk von absonderlicher
Leckerheit; man muß wirklich schon zu solchen lu-
kullischen Ausdrücken greifen. Was und wie viel
auf dieser Linie zu erreichen ist, steht ja dahin. Einst-
weilen hat unsere hyperartistische Zeit eine neue Art
gefunden, sich malerisch auszudrücken. Wenn Klimt
heute in die Lage käme, ganze Räume in diesem
Stil auszustatten, könnte wohl etwas Denkwürdiges
entstehen. Und etwas recht Wienerisches, worunter
ich jenes ganz eigene verstehe, was ich Facettenschliff
nennen möchte. Unsere größten Künstler haben immer
jenes unendliche Geflimmer und Gefunkel gehabt, das
sonst nirgends vorkommt. Unsere Walzermusik hat
auch diesen Facettenschliff. Auch Makart hatte ihn.
Und die Wiener Toilettenkunst hat ihn; Sarah Bern-
hardt ließ ihre Wiener Schneiderin Madame Francine
nach Paris übersiedeln, weil die Pariser das nicht
haben. Selbstverständlich muß es ja nicht nach jeder-