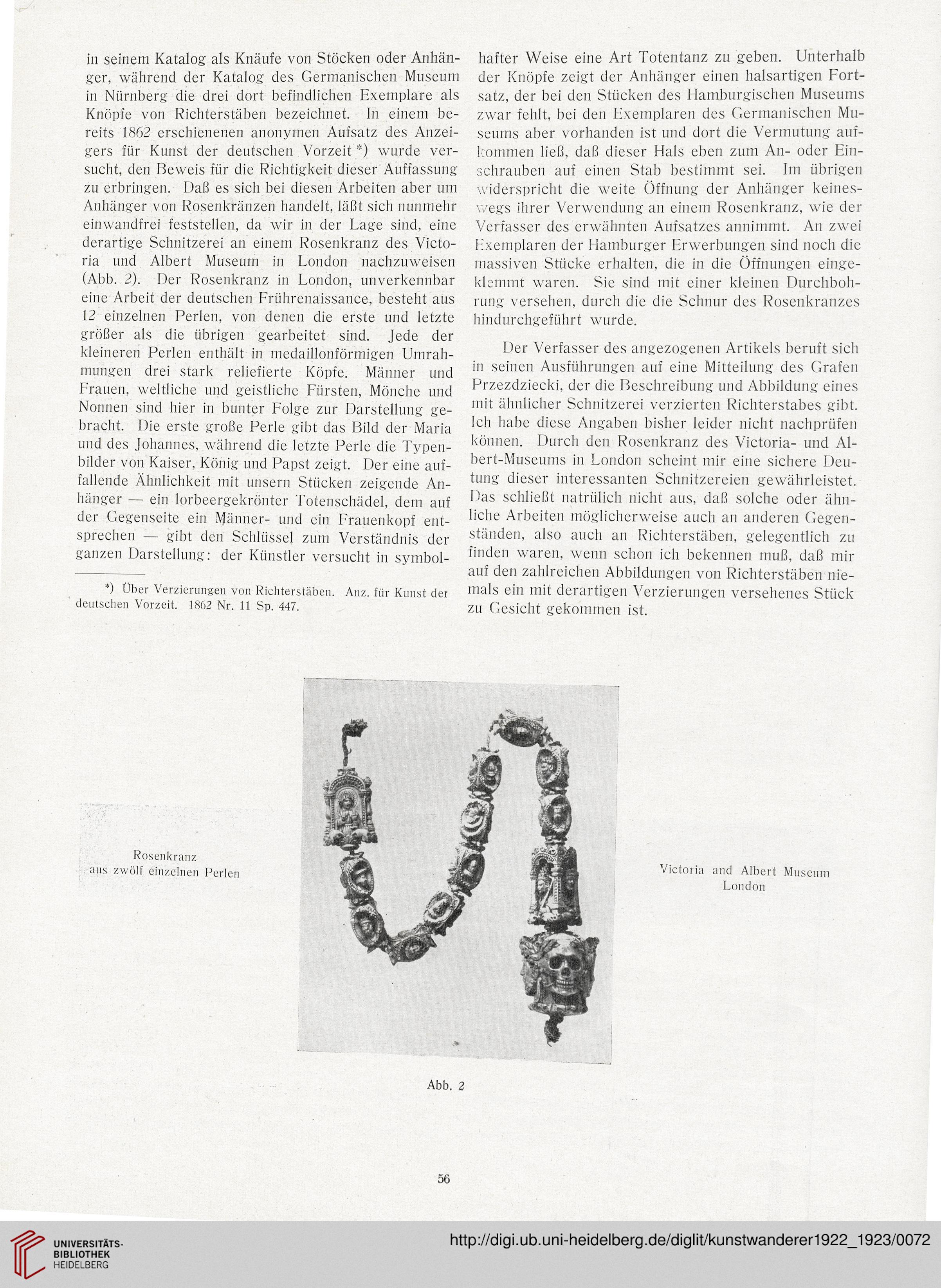Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 4./5.1922/23
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.20303#0072
DOI Heft:
1. Oktoberheft
DOI Artikel:Eimers, John: Über Anhänger von Rosenkränzen
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.20303#0072
in seinem Katalog als Knäufe von Stöcken oder Anhän-
ger, während der Katalog des Germanischen Museum
in Nürnberg die drei dort befindlichen Exemplare als
Knöpfe von Richterstäben bezeichnet. In einem be-
reits 1862 erschienenen anonymen Aufsatz des Anzei-
gers für Kunst der deutschen Vorzeit *) wurde ver-
sucht, den Beweis fiir die Richtigkeit dieser Auffassung
zu erbriugen. Daß es sich bei diesen Arbeiten aber um
Anhänger von Rosenkränzen handelt, Iäßt sich nunmehr
einwandfrei feststellen, da wir in der Lage sind, eine
derartige Schnitzerei an einem Rosenkranz des Victo-
ria und Albert Museum in London nachzuweisen
(Abb. 2). Der Rosenkranz in London, unverkennbar
eine Arbeit der deutschen Frührenaissance, besteht aus
12 einzelnen Perlen, von denen die erste und letzte
größer als die übrigen gearbeitet sind. Jede der
kleineren Perlen enthält in medaillonförmigen Umrah-
mungen drei stark reliefierte Köpfe. Männer und
Frauen, weltliche und geistliche Fürsten, Mönche und
Nonnen sind hier in bunter Folge zur Darstellung ge-
braclit. Die erste große Perle gibt das Bild der Maria
und des Johannes, während die letzte Perle die Typen-
bilder von Kaiser, König und Papst zeigt. Der eine auf-
fallende Ähnlichkeit mit unsern Stücken zeigende An-
hänger — ein lorbeergekrönter Totenschädel, dem auf
der Gegenseite ein Männer- und ein Frauenkopf ent-
sprechen — gibt den Schlüssel zum Verständnis der
ganzen Darstellung: der Kiinstler versucht in symbol-
*) Uber Verzierungen von Richterstäben. Anz. für Kunst der
deutschen Vorzeit. 1862 Nr. 11 Sp. 447.
hafter Weise eine Art Totentanz zu geben. Unterhalb
der Knöpfe zeigt der Anhänger einen halsartigen Fort-
satz, der bei den Stücken des Hamburgischen Museums
zwar fehlt, bei den Exemplaren des Germanischen Mu-
seums aber vorhanden ist und dort die Vermutung auf-
kommen ließ, daß dieser Hals eben zum An- oder Ein-
schrauben auf einen Stab bestimmt sei. Im übrigen
widerspricht die weite Öffnung der Anhänger keines-
v/egs ihrer Verwendung an einem Rosenkranz, wie der
Verfasser des erwähnten Aufsatzes annimmt. An zwei
Exemplaren der Hamburger Erwerbungen sind nocli die
massiven Stiicke erhalten, die in die Öffnungen einge-
klemmt waren. Sie sind mit einer kleinen Durchboh-
rung versehen, durch die die Schnur des Rosenkranzes
hindurchgeführt wurde.
Der Verfasser des angezogenen Artikels beruft sich
in seinen Ausführungen auf eine Mitteilung des Grafen
Przezdziecki, der die Beschreibung und Abbildung eines
mit ähnlicher Schnitzerei verzierten Richterstabes gibt.
Ich habe diese Angaben bisher leider nicht nachprüfen
können. Durch den Rosenkranz des Victoria- und Al-
bert-Museums in London scheint mir eine sichere Deu-
tung dieser interessanten Schnitzereien gewährleistet.
Das schließt hatrülich nicht aus, daß solche oder ähn-
liche Arbeiten möglicherweise auch an anderen Gegen-
ständen, also auch an Richterstäben, gelegentlich zu
finden waren, wenn schon ich bekennen muß, daß mir
auf den zahlreichen Abbildungen von Richterstäben nie-
mals ein mit derartigen Verzierungen versehenes Stück
zu Gesicht gekommen ist.
56
ger, während der Katalog des Germanischen Museum
in Nürnberg die drei dort befindlichen Exemplare als
Knöpfe von Richterstäben bezeichnet. In einem be-
reits 1862 erschienenen anonymen Aufsatz des Anzei-
gers für Kunst der deutschen Vorzeit *) wurde ver-
sucht, den Beweis fiir die Richtigkeit dieser Auffassung
zu erbriugen. Daß es sich bei diesen Arbeiten aber um
Anhänger von Rosenkränzen handelt, Iäßt sich nunmehr
einwandfrei feststellen, da wir in der Lage sind, eine
derartige Schnitzerei an einem Rosenkranz des Victo-
ria und Albert Museum in London nachzuweisen
(Abb. 2). Der Rosenkranz in London, unverkennbar
eine Arbeit der deutschen Frührenaissance, besteht aus
12 einzelnen Perlen, von denen die erste und letzte
größer als die übrigen gearbeitet sind. Jede der
kleineren Perlen enthält in medaillonförmigen Umrah-
mungen drei stark reliefierte Köpfe. Männer und
Frauen, weltliche und geistliche Fürsten, Mönche und
Nonnen sind hier in bunter Folge zur Darstellung ge-
braclit. Die erste große Perle gibt das Bild der Maria
und des Johannes, während die letzte Perle die Typen-
bilder von Kaiser, König und Papst zeigt. Der eine auf-
fallende Ähnlichkeit mit unsern Stücken zeigende An-
hänger — ein lorbeergekrönter Totenschädel, dem auf
der Gegenseite ein Männer- und ein Frauenkopf ent-
sprechen — gibt den Schlüssel zum Verständnis der
ganzen Darstellung: der Kiinstler versucht in symbol-
*) Uber Verzierungen von Richterstäben. Anz. für Kunst der
deutschen Vorzeit. 1862 Nr. 11 Sp. 447.
hafter Weise eine Art Totentanz zu geben. Unterhalb
der Knöpfe zeigt der Anhänger einen halsartigen Fort-
satz, der bei den Stücken des Hamburgischen Museums
zwar fehlt, bei den Exemplaren des Germanischen Mu-
seums aber vorhanden ist und dort die Vermutung auf-
kommen ließ, daß dieser Hals eben zum An- oder Ein-
schrauben auf einen Stab bestimmt sei. Im übrigen
widerspricht die weite Öffnung der Anhänger keines-
v/egs ihrer Verwendung an einem Rosenkranz, wie der
Verfasser des erwähnten Aufsatzes annimmt. An zwei
Exemplaren der Hamburger Erwerbungen sind nocli die
massiven Stiicke erhalten, die in die Öffnungen einge-
klemmt waren. Sie sind mit einer kleinen Durchboh-
rung versehen, durch die die Schnur des Rosenkranzes
hindurchgeführt wurde.
Der Verfasser des angezogenen Artikels beruft sich
in seinen Ausführungen auf eine Mitteilung des Grafen
Przezdziecki, der die Beschreibung und Abbildung eines
mit ähnlicher Schnitzerei verzierten Richterstabes gibt.
Ich habe diese Angaben bisher leider nicht nachprüfen
können. Durch den Rosenkranz des Victoria- und Al-
bert-Museums in London scheint mir eine sichere Deu-
tung dieser interessanten Schnitzereien gewährleistet.
Das schließt hatrülich nicht aus, daß solche oder ähn-
liche Arbeiten möglicherweise auch an anderen Gegen-
ständen, also auch an Richterstäben, gelegentlich zu
finden waren, wenn schon ich bekennen muß, daß mir
auf den zahlreichen Abbildungen von Richterstäben nie-
mals ein mit derartigen Verzierungen versehenes Stück
zu Gesicht gekommen ist.
56