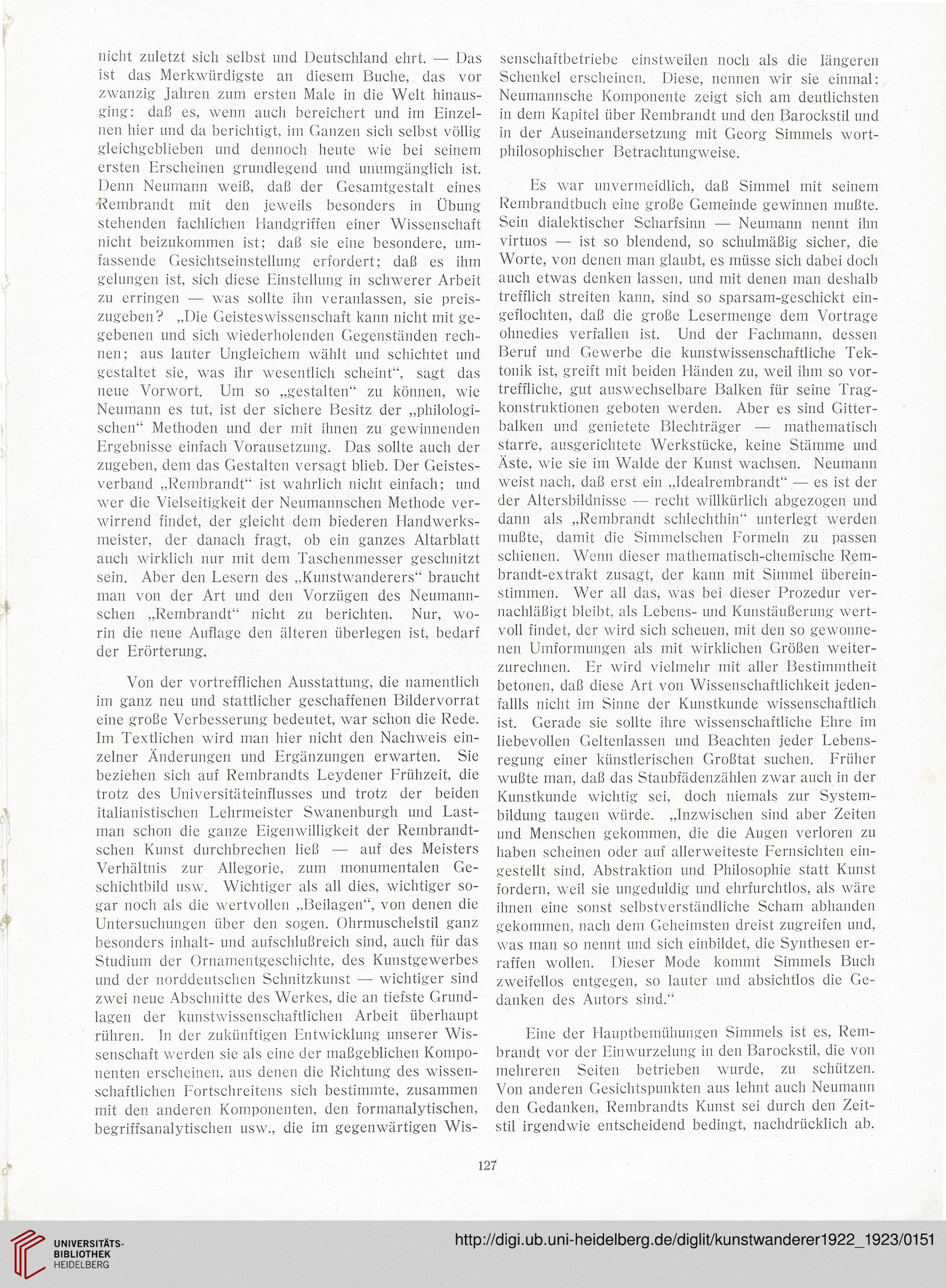iiiclit zuletzt sich selbst und Deutschland ehrt. — Das
ist das Merkwürdigste an diesem Buche, das vor
zwanzig Jahren zum ersten Male in die Welt hinaus-
ging: daß es, wenn aucli bereichert und im Einzel-
nen hier und da berichtigt, im Ganzen sich selbst völlig
gleichgeblieben und dennoch heute wie bei seinem
ersten Erscheinen grundlegend und unumgänglich ist.
Denn Neumann weiß, daß der Gesamtgestalt eines
Rembrandt mit den jeweils besonders in Übung
stehenden fachlichen Handgriffen einer Wissenschaft
nicht beizukommen ist: daß sie eine besondere, um-
fassende Gesichtseinstellung erfordert; daß es ihm
gelungen ist, sich diese Einstellung in schwerer Arbeit
zu erringen — was sollte ihn veranlassen, sie preis-
zugeben? „Die Geisteswissenschaft kann nicht init ge-
gebenen und sich wiederholenden Gegenständen rech-
nen; aus lauter Ungleichem wäiilt und schichtet und
gestaltet sie, was ihr wesentlich scheint“, sagt das
neue Vorwort. Um so „gestalten“ zu können, wie
Neumann es tut, ist der sichere Besitz der „philologi-
schen“ Methoden und der mit ihnen zu gewinnenden
Ergebnisse einfach Vorausetzung. Das sollte auch der
zugeben, dem das Gestalten versagt blieb. Der Geistes-
verband „Rembrandt“ ist wahrlich nicht einfach; und
wer die Vielseitigkeit der Neumannschen Methode ver-
wirrend findet, der gleicht dem biederen Handwerks-
meister, der danach fragt, ob ein ganzes Altarblatt
auch wirklich nur mit dem Taschenmesser geschnitzt
sein. Aber den Lesern des „Kunstwanderers“ braucht
man von der Art und den Vorziigen des Neumann-
schen „Rembrandt“ nicht zu berichten. Nur, wo-
rin die neue Auflage den älteren überlegen ist, bedarf
der Erörterung.
Von der vortrefflichen Ausstattung, die namentlich
im ganz neu und stattlicher geschaffenen Bildervorrat
eine große Verbesserung bedeutet, war schon die Rede.
Im Textlichen wird man hier nicht den Nachweis ein-
zelner Änderungen und Ergänzungen erwarten. Sie
beziehen sich auf Rembrandts Leydener Frühzeit, die
trotz des Universitäteinflusses und trotz der beiden
italianistischen Lehrmeister Swanenburgh und Last-
man schon die ganze Eigenwilligkeit der Rembrandt-
schen Kunst dürchbrechen ließ — auf des Meisters
Verhältnis zur Allegorie, zum monumentalen Ge-
schichtbild usw. Wicbtiger als all dies, wichtiger so-
gar noch als die wertvollen „Beilagen“, von denen die
Untersuchungen iiber den sogen. Ohrmuschelstil ganz
besonders inhalt- und aufschlußreich sind, auch fiir das
Studium der Ornamentgeschichte, des Kunstgewerbes
und der norddeutschen Schnitzkunst — wichtiger sind
zwei neue Abschnitte des Werkes, die an tiefste Grund-
lagen der kunstwissenschaftlichen Arbeit iiberhaupt
riihren. In der zukiinftigen Entwicklung unserer Wis-
senschaft werden sie als eine der maßgeblichen Kompo-
nenten erscheinen, aus denen die Richtung des wissen-
schaftlichen Fortschreitens sicli bestimmte, zusammen
mit den anderen Komponenten, den formanalytischen,
begriffsanalytischen usw., die im gegenwärtigen Wis-
senschaftbetriebe einstweilen nocli als die längeren
Schenkel erscheinen. Diese, nennen wir sie einmal:
Neumannsche Komponente zeigt sich am de.utlichsten
in dem Kapitel über Rembrandt und den Barockstil und
in der Auseinandersetzung mit Georg Simmels wort-
philosophischer Betrachtungweise.
Es war unvermeidlich, daß Simmel mit seinem
Rembrandtbuch eine große Gemeinde gewinnen mußte.
Sein dialektischer Scharfsinn — Neumann nennt ihn
virtuos —- ist so blendend, so schulmäßig sicher, die
Worte, von denen man glaubt, es müsse sich dabei doch
auch etwas denken lassen, und mit denen man deshalb
trefflich streiten kann, sind so sparsam-geschickt ein-
geflochten, daß die große Lesermenge dem Vortrage
ohnedies verfallen ist. Und der Fachmann, dessen
Beruf und Gewerbe die kunstwissenschaftliche Tek-
tonik ist, greift mit beiden Händen zu, weil ihm so vor-
treffliche, gut auswechselbare Balken für seine Trag-
konstruktionen geboten werden. Aber es sind Gitter-
balken und genietete Blechträger — mathematisch
starr'e, ausgerichtete Werkstücke, keine Stämme und
Äste, wie sie im Walde der Kunst wachsen. Neumann
weist nach, daß erst ein „Idealrembrandt“ — es ist der
der Altersbildnisse — recht willkürlich abgezogen und
dann als „Rembrandt schlechthin“ unterlegt werden
mußte, damit die Simmelschen Formeln zu passen
schienen. Wenn dieser mathematisch-chemische Rem-
brandt-extrakt zusagt, der kann mit Simmel überein-
stimmen. Wer all das, was bei dieser Prozedur ver-
nachläßigt bleibt, als Lebens- und Kunstäußerung wert-
voll findet, der wird sich scheuen, mit den so gewonne-
nen Umformungen als mit wirklichen Größen weiter-
zurechnen. Er wird vielmehr mit aller Bestimmtheit
betonen, daß diese Art von Wissenschaftlichkeit jeden-
fallls nicht im Sinne der Kunstkunde wissenschaftlich
ist. Gerade sie sollte ihre wissenschaftliche Ehre im
liebevollen Geltenlassen und Beachten jeder Lebens-
regung einer künstlerischen Großtat suchen. Friiher
wußte man, daß das Staubfädenzählen zwar auch in der
Kunstkunde wichtig sei, doch niemals zur System-
bildung taugen würde. „Inzwischen sind aber Zeiten
und Menschen gekommen, die die Augen verloren zu
haben scheinen oder auf allerweiteste Fernsichten ein-
gestellt sind, Abstraktion und Philosophie statt Kunst
fordern, weil sie ungeduldig und ehrfurchtlos, als wäre
ihnen eine sonst selbstverständliche Scham abhanden
gekommen, nach dem Geheimsten dreist zugreifen und,
was man so nennt und sich einbildet, die Synthesen er-
raffen wollen. Dieser Mode kommt Simmels Bucli
zweifellos entgegen, so lauter und absichtlos die Ge-
danken des Autors sind.“
Eine der Hauptbemühungen Simmels ist es, Rem-
brandt vor der Einwurzelung in den Barockstil, die von
mehreren Seiten betrieben wurde, zu schützen.
Von anderen Gesichtspunkten aus lehnt auch Neumann
den Gedanken, Rembrandts Kunst sei durch den Zeit-
stil irgendwie entscheidend bedingt, nachdrücklich ab.
127
ist das Merkwürdigste an diesem Buche, das vor
zwanzig Jahren zum ersten Male in die Welt hinaus-
ging: daß es, wenn aucli bereichert und im Einzel-
nen hier und da berichtigt, im Ganzen sich selbst völlig
gleichgeblieben und dennoch heute wie bei seinem
ersten Erscheinen grundlegend und unumgänglich ist.
Denn Neumann weiß, daß der Gesamtgestalt eines
Rembrandt mit den jeweils besonders in Übung
stehenden fachlichen Handgriffen einer Wissenschaft
nicht beizukommen ist: daß sie eine besondere, um-
fassende Gesichtseinstellung erfordert; daß es ihm
gelungen ist, sich diese Einstellung in schwerer Arbeit
zu erringen — was sollte ihn veranlassen, sie preis-
zugeben? „Die Geisteswissenschaft kann nicht init ge-
gebenen und sich wiederholenden Gegenständen rech-
nen; aus lauter Ungleichem wäiilt und schichtet und
gestaltet sie, was ihr wesentlich scheint“, sagt das
neue Vorwort. Um so „gestalten“ zu können, wie
Neumann es tut, ist der sichere Besitz der „philologi-
schen“ Methoden und der mit ihnen zu gewinnenden
Ergebnisse einfach Vorausetzung. Das sollte auch der
zugeben, dem das Gestalten versagt blieb. Der Geistes-
verband „Rembrandt“ ist wahrlich nicht einfach; und
wer die Vielseitigkeit der Neumannschen Methode ver-
wirrend findet, der gleicht dem biederen Handwerks-
meister, der danach fragt, ob ein ganzes Altarblatt
auch wirklich nur mit dem Taschenmesser geschnitzt
sein. Aber den Lesern des „Kunstwanderers“ braucht
man von der Art und den Vorziigen des Neumann-
schen „Rembrandt“ nicht zu berichten. Nur, wo-
rin die neue Auflage den älteren überlegen ist, bedarf
der Erörterung.
Von der vortrefflichen Ausstattung, die namentlich
im ganz neu und stattlicher geschaffenen Bildervorrat
eine große Verbesserung bedeutet, war schon die Rede.
Im Textlichen wird man hier nicht den Nachweis ein-
zelner Änderungen und Ergänzungen erwarten. Sie
beziehen sich auf Rembrandts Leydener Frühzeit, die
trotz des Universitäteinflusses und trotz der beiden
italianistischen Lehrmeister Swanenburgh und Last-
man schon die ganze Eigenwilligkeit der Rembrandt-
schen Kunst dürchbrechen ließ — auf des Meisters
Verhältnis zur Allegorie, zum monumentalen Ge-
schichtbild usw. Wicbtiger als all dies, wichtiger so-
gar noch als die wertvollen „Beilagen“, von denen die
Untersuchungen iiber den sogen. Ohrmuschelstil ganz
besonders inhalt- und aufschlußreich sind, auch fiir das
Studium der Ornamentgeschichte, des Kunstgewerbes
und der norddeutschen Schnitzkunst — wichtiger sind
zwei neue Abschnitte des Werkes, die an tiefste Grund-
lagen der kunstwissenschaftlichen Arbeit iiberhaupt
riihren. In der zukiinftigen Entwicklung unserer Wis-
senschaft werden sie als eine der maßgeblichen Kompo-
nenten erscheinen, aus denen die Richtung des wissen-
schaftlichen Fortschreitens sicli bestimmte, zusammen
mit den anderen Komponenten, den formanalytischen,
begriffsanalytischen usw., die im gegenwärtigen Wis-
senschaftbetriebe einstweilen nocli als die längeren
Schenkel erscheinen. Diese, nennen wir sie einmal:
Neumannsche Komponente zeigt sich am de.utlichsten
in dem Kapitel über Rembrandt und den Barockstil und
in der Auseinandersetzung mit Georg Simmels wort-
philosophischer Betrachtungweise.
Es war unvermeidlich, daß Simmel mit seinem
Rembrandtbuch eine große Gemeinde gewinnen mußte.
Sein dialektischer Scharfsinn — Neumann nennt ihn
virtuos —- ist so blendend, so schulmäßig sicher, die
Worte, von denen man glaubt, es müsse sich dabei doch
auch etwas denken lassen, und mit denen man deshalb
trefflich streiten kann, sind so sparsam-geschickt ein-
geflochten, daß die große Lesermenge dem Vortrage
ohnedies verfallen ist. Und der Fachmann, dessen
Beruf und Gewerbe die kunstwissenschaftliche Tek-
tonik ist, greift mit beiden Händen zu, weil ihm so vor-
treffliche, gut auswechselbare Balken für seine Trag-
konstruktionen geboten werden. Aber es sind Gitter-
balken und genietete Blechträger — mathematisch
starr'e, ausgerichtete Werkstücke, keine Stämme und
Äste, wie sie im Walde der Kunst wachsen. Neumann
weist nach, daß erst ein „Idealrembrandt“ — es ist der
der Altersbildnisse — recht willkürlich abgezogen und
dann als „Rembrandt schlechthin“ unterlegt werden
mußte, damit die Simmelschen Formeln zu passen
schienen. Wenn dieser mathematisch-chemische Rem-
brandt-extrakt zusagt, der kann mit Simmel überein-
stimmen. Wer all das, was bei dieser Prozedur ver-
nachläßigt bleibt, als Lebens- und Kunstäußerung wert-
voll findet, der wird sich scheuen, mit den so gewonne-
nen Umformungen als mit wirklichen Größen weiter-
zurechnen. Er wird vielmehr mit aller Bestimmtheit
betonen, daß diese Art von Wissenschaftlichkeit jeden-
fallls nicht im Sinne der Kunstkunde wissenschaftlich
ist. Gerade sie sollte ihre wissenschaftliche Ehre im
liebevollen Geltenlassen und Beachten jeder Lebens-
regung einer künstlerischen Großtat suchen. Friiher
wußte man, daß das Staubfädenzählen zwar auch in der
Kunstkunde wichtig sei, doch niemals zur System-
bildung taugen würde. „Inzwischen sind aber Zeiten
und Menschen gekommen, die die Augen verloren zu
haben scheinen oder auf allerweiteste Fernsichten ein-
gestellt sind, Abstraktion und Philosophie statt Kunst
fordern, weil sie ungeduldig und ehrfurchtlos, als wäre
ihnen eine sonst selbstverständliche Scham abhanden
gekommen, nach dem Geheimsten dreist zugreifen und,
was man so nennt und sich einbildet, die Synthesen er-
raffen wollen. Dieser Mode kommt Simmels Bucli
zweifellos entgegen, so lauter und absichtlos die Ge-
danken des Autors sind.“
Eine der Hauptbemühungen Simmels ist es, Rem-
brandt vor der Einwurzelung in den Barockstil, die von
mehreren Seiten betrieben wurde, zu schützen.
Von anderen Gesichtspunkten aus lehnt auch Neumann
den Gedanken, Rembrandts Kunst sei durch den Zeit-
stil irgendwie entscheidend bedingt, nachdrücklich ab.
127