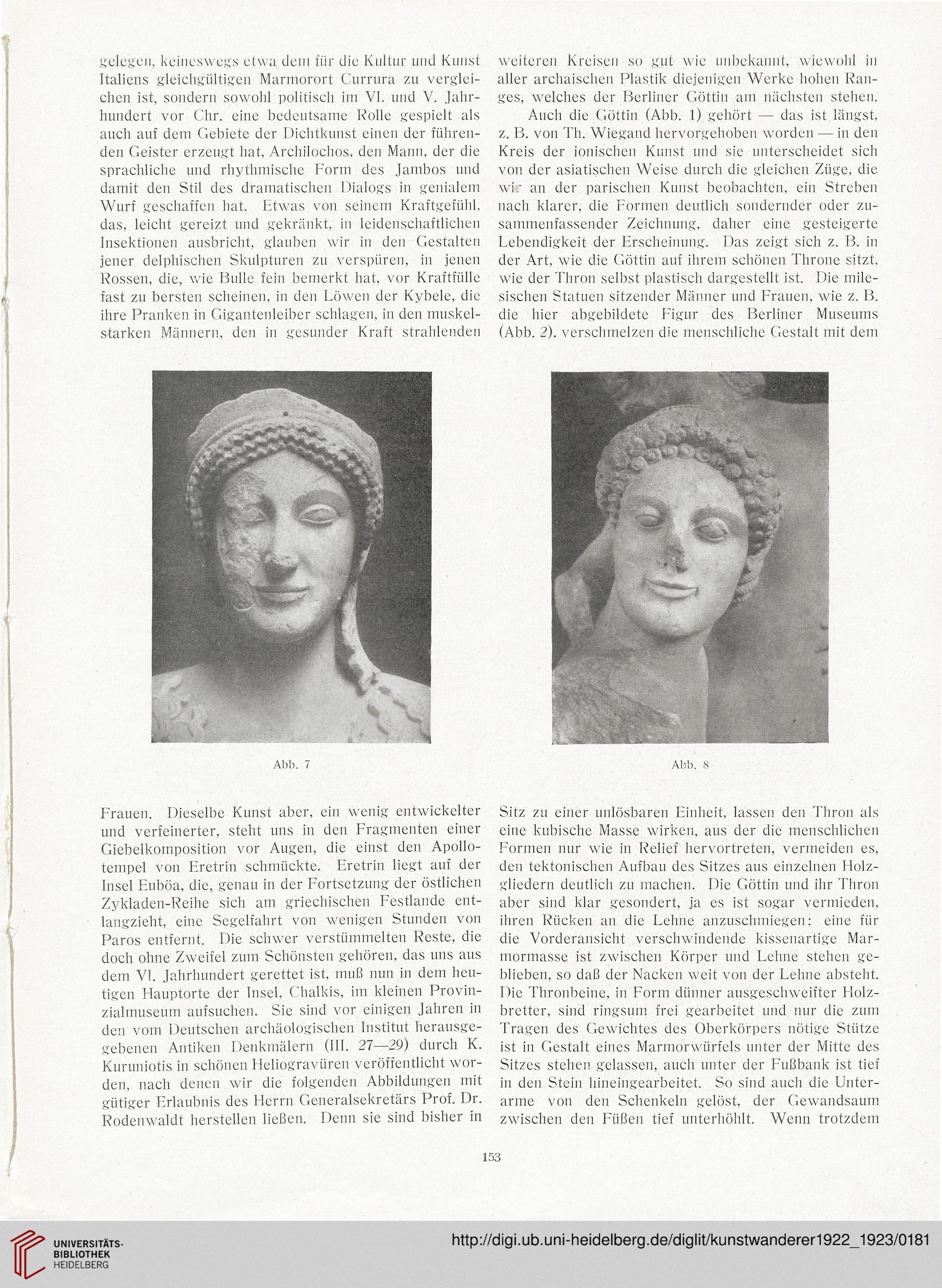Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 4./5.1922/23
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.20303#0181
DOI Heft:
1. Dezemberheft
DOI Artikel:Schrader, Hans: Die thronende Göttin im Alten Museum zu Berlin
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.20303#0181
yelegen, keinc.swegs etwa dem für die Kultur uud Kuust
Italiens gleichgültigen Marmorort Gurrura zu verglei-
chen ist, sondern sowohl politisch im VI. und V. Jahr-
hundert vor Chr. eine bedeutsame Rolle gespielt als
auch auf dem Gebiete der Dichtkunst einen der führen-
den Geister erzeugt hat, Archilochos, den Mann, der die
sprachliche und rhythmische Form des Jambos und
damit den Stil des dramatischen Dialogs in genialem
Wurf geschaffen hat. Etwas von seinem Kraftgefühl,
das, leicht gereizt und gekränkt, in leidenschaftlichen
Insektionen ausbricht, glauben wir in den Gestalten
jener delphischen Skulpturen zu yerspüren, in jenen
Rossen, die, wie Bulle fein bemerkt hat, vor Kraftfüllc
fast zu bersten scheinen, in den Löwen der Kybele, die
ihre Pranken in Gigantenleiber schlagen, in den muskel-
starken Männern, den in gesunder Kraft strahlenden
Abb. 7
Frauen. Dieselbe Kunst aber, ein wenig entwickelter
und verfeinerter, steht uns in den Fragmenten einer
Giebelkomposition vor Augen, die einst den Apollo-
tempel von Eretrin schmückte. Eretrin liegt auf der
Insel Euböa, die, genau in der Fortsetzung der östlichen
Zykladen-Reihe sich am griechischen Festlande ent-
langzieht, eine Segelfahrt von wenigen Stunden von
Paros entfernt. Die schwer verstümmelten Reste, die
doch ohne Zweifel zum Schönsten gehören, das uns aus
dem VI. Jahrhundert gerettet ist, muß nun in dem heu-
tigen Hauptorte der Insel, Chalkis, im kleinen Provin-
zialmuseum aufsuchen. Sie sind vor einigen Jahren in
den vom Deutschen archäologischen Institut herausge-
gebenen Antiken Denkmälern (III. 27—29) durcli K.
Kuruniotis in schönen Heliogravüren veröffentlicht wor-
den, nach denen wir die folgenden Abbildungen mit
gütiger Erlaubnis des Herrn Generalsekretärs Prof. Dr.
Rodenwaldt herstellen ließen. Denn sie sind bisher in
weiteren Kreisen so gut wie uiibekannt, wiewohl in
aller archaischen Plastik diejenigen Werke hohen Ran-
ges, welches der Berliner Göttin am nächsten stehen.
Auch die Göttin (Abb. 1) gehört — das ist längst,
z. B. von Th. Wiegand hervorgehoben worden — in den
Kreis der ionischen Kunst und sie unterscheidet sich
von der asiatischen Weise durch die gleichen Züge, die
wk' an der parischen Kunst beobachten, ein Streben
nach klarer, die Forrnen deutlich sondernder oder zu-
sammenfassender Zeichnung, daher eine gesteigerte
Lebendigkeit der Erscheinung. Das zeigt sich z. B. in
der Art, wie die Göttin auf ihrem schönen Throne sitzt.
wie der Thron selbst plastisch dargestellt ist. Die mile-
sischen Statuen sitzender Männer und Frauen, wie z. B.
die hier abgebildete Figur des Berlmer Museums
(Abb. 2). verschmelzen die menschliche Gestalt mit dem
Abb. 8
Sitz zu einer unlösbaren Einheit, lassen den Thron als
eine kubische Masse wirken, aus der die menschlichen
Formen nur wie in Relief hervortreten, vermeiden es,
den tektonischen Aufbau des Sitzes aus einzelnen Holz-
gliedern deutlich zu machen. Die Göttin und ihr Thron
aber sind klar gesondert, ja es ist sogar vermieden,
ihren Rücken an die Lehne anzuschmiegen: eine für
die Vorderansicht verschwindende kissenartige Mar-
mormasse ist zwischen Körper und Lehne stehen ge-
blieben, so daß der Nacken weit von der Lehne absteht.
Die Thronbeine, in Form dünner ausgeschweifter Holz-
bretter, sind ringsum frei gearbeitet und nur die zum
Tragen des Gewichtes des Oberkörpers nötige Stütze
ist in Gestalt eines Marmorwürfels unter der Mitte des
Sitzes stehen gelassen, auch unter der Fußbank ist tief
in den Stein hineingearbeitet. So sind auch die Unter-
arme von den Schenkeln gelöst, der Gewandsaum
zwischen den Füßen tief unterhöhlt. Wenn trotzdem
153
Italiens gleichgültigen Marmorort Gurrura zu verglei-
chen ist, sondern sowohl politisch im VI. und V. Jahr-
hundert vor Chr. eine bedeutsame Rolle gespielt als
auch auf dem Gebiete der Dichtkunst einen der führen-
den Geister erzeugt hat, Archilochos, den Mann, der die
sprachliche und rhythmische Form des Jambos und
damit den Stil des dramatischen Dialogs in genialem
Wurf geschaffen hat. Etwas von seinem Kraftgefühl,
das, leicht gereizt und gekränkt, in leidenschaftlichen
Insektionen ausbricht, glauben wir in den Gestalten
jener delphischen Skulpturen zu yerspüren, in jenen
Rossen, die, wie Bulle fein bemerkt hat, vor Kraftfüllc
fast zu bersten scheinen, in den Löwen der Kybele, die
ihre Pranken in Gigantenleiber schlagen, in den muskel-
starken Männern, den in gesunder Kraft strahlenden
Abb. 7
Frauen. Dieselbe Kunst aber, ein wenig entwickelter
und verfeinerter, steht uns in den Fragmenten einer
Giebelkomposition vor Augen, die einst den Apollo-
tempel von Eretrin schmückte. Eretrin liegt auf der
Insel Euböa, die, genau in der Fortsetzung der östlichen
Zykladen-Reihe sich am griechischen Festlande ent-
langzieht, eine Segelfahrt von wenigen Stunden von
Paros entfernt. Die schwer verstümmelten Reste, die
doch ohne Zweifel zum Schönsten gehören, das uns aus
dem VI. Jahrhundert gerettet ist, muß nun in dem heu-
tigen Hauptorte der Insel, Chalkis, im kleinen Provin-
zialmuseum aufsuchen. Sie sind vor einigen Jahren in
den vom Deutschen archäologischen Institut herausge-
gebenen Antiken Denkmälern (III. 27—29) durcli K.
Kuruniotis in schönen Heliogravüren veröffentlicht wor-
den, nach denen wir die folgenden Abbildungen mit
gütiger Erlaubnis des Herrn Generalsekretärs Prof. Dr.
Rodenwaldt herstellen ließen. Denn sie sind bisher in
weiteren Kreisen so gut wie uiibekannt, wiewohl in
aller archaischen Plastik diejenigen Werke hohen Ran-
ges, welches der Berliner Göttin am nächsten stehen.
Auch die Göttin (Abb. 1) gehört — das ist längst,
z. B. von Th. Wiegand hervorgehoben worden — in den
Kreis der ionischen Kunst und sie unterscheidet sich
von der asiatischen Weise durch die gleichen Züge, die
wk' an der parischen Kunst beobachten, ein Streben
nach klarer, die Forrnen deutlich sondernder oder zu-
sammenfassender Zeichnung, daher eine gesteigerte
Lebendigkeit der Erscheinung. Das zeigt sich z. B. in
der Art, wie die Göttin auf ihrem schönen Throne sitzt.
wie der Thron selbst plastisch dargestellt ist. Die mile-
sischen Statuen sitzender Männer und Frauen, wie z. B.
die hier abgebildete Figur des Berlmer Museums
(Abb. 2). verschmelzen die menschliche Gestalt mit dem
Abb. 8
Sitz zu einer unlösbaren Einheit, lassen den Thron als
eine kubische Masse wirken, aus der die menschlichen
Formen nur wie in Relief hervortreten, vermeiden es,
den tektonischen Aufbau des Sitzes aus einzelnen Holz-
gliedern deutlich zu machen. Die Göttin und ihr Thron
aber sind klar gesondert, ja es ist sogar vermieden,
ihren Rücken an die Lehne anzuschmiegen: eine für
die Vorderansicht verschwindende kissenartige Mar-
mormasse ist zwischen Körper und Lehne stehen ge-
blieben, so daß der Nacken weit von der Lehne absteht.
Die Thronbeine, in Form dünner ausgeschweifter Holz-
bretter, sind ringsum frei gearbeitet und nur die zum
Tragen des Gewichtes des Oberkörpers nötige Stütze
ist in Gestalt eines Marmorwürfels unter der Mitte des
Sitzes stehen gelassen, auch unter der Fußbank ist tief
in den Stein hineingearbeitet. So sind auch die Unter-
arme von den Schenkeln gelöst, der Gewandsaum
zwischen den Füßen tief unterhöhlt. Wenn trotzdem
153