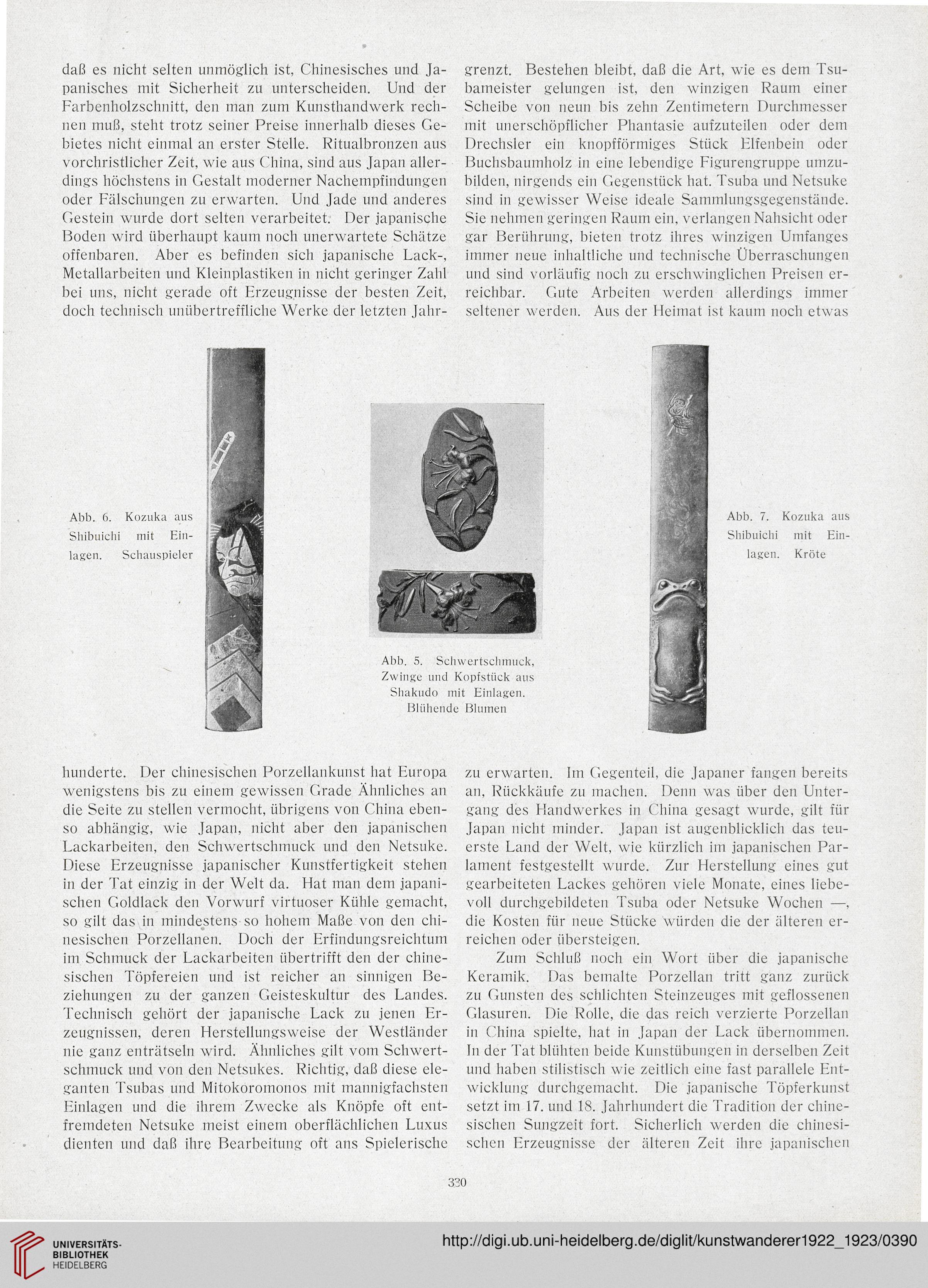Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 4./5.1922/23
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.20303#0390
DOI Heft:
1. Aprilheft
DOI Artikel:Cohn, William: Ostasiatische Kunstgewerbe
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.20303#0390
daß es nicht selten unmöglich ist, Chinesisches und Ja-
panisches mit Sicherheit zu unterscheiden. Und der
Farbenholzschnitt, den man zum Kunsthandwerk rech-
nen muß, steht trotz seiner Preise innerhalb dieses Ge-
bietes nicht einmal an erster Stelle. Ritualbronzen aus
vorchristlicher Zeit, wie aus China, sind aus Japan aller-
dings höchstens iu Gestalt moderner Nachempfindungen
oder Fälschungen zu erwarten. Und Jade und anderes
Gestein wurde dort selten verarbeitet. Der japanische
Boden wird überhaupt kaum noch unerwartete Schätze
offenbaren. Aber es befinden sich japanische Lack-,
Metallarbeiten und Kleinplastiken in nicht geringer Zahl
bei uns, nicht gerade oft Erzeugnisse der besten Zeit,
doch technisch unübertreffliche Werke der letzten Jahr-
grenzt. Bestehen bleibt, daß die Art, wie es dem Tsu-
bameister gelungen ist, den winzigen Raum einer
Scheibe von neun bis zehn Zentimetern Durchmesser
mit unerschöpflicher Phantasie aufzuteilen oder dem
Drechsler ein knopfförmiges Stück Elfenbein oder
Buchsbaumholz in eine lebendige Figurengruppe umzu-
bilden, nirgends ein Gegenstiick hat. Tsuba und Netsuke
sind in gewisser Weise ideale Sammlungsgegenstände.
Sie nehmen geringen Raum ein, verlangen Nahsicht oder
gar Berührung, bieten trotz ihres winzigen Umfanges
immer neue inhaltliche und technische Überraschungen
und sind vorläufig noch zu erschwinglichen Preisen er-
reichbar. Gute Arbeiten werden allerdings immer
seltener werden. Aus der Heimat ist kaum noch etwas
Abb. 6. Kozuka aus
Shibuichi mit Ein-
lagen. Schauspieler
Abb. 5. Schwertschmuck,
Zwinge und Kopfstück aus
Shakudo mit Einlagen.
Bltihende Blumen
Abb. 7. Kozuka aus
Shibuichi mit Ein-
lagen. Kröte
hunderte. Der chinesischen Porzellankunst hat Europa
wenigstens bis zu einem gewissen Grade Ähnliches an
die Seite zu stelien vermocht, übrigens von China eben-
so abhängig, wie Japan, nicht aber den japanischen
Lackarbeiten, den Schwertschmuck und den Netsuke.
Diese Erzeugnisse japanischer Kunstfertigkeit stehen
in der Tat einzig in der Welt da. Hat man dem japani-
schen Goldlack den Vorwurf virtuoser Küiile gemacht,
so gilt das in mindestens so hohem Maße von den chi-
nesischen Porzellanen. Doch der Erfindungsreichtum
itn Schmuck der Lackarbeiten übertrifft den der chine-
sischen Töpfereien und ist reicher an sinnigen Be-
ziehungen zu der ganzen Geisteskultur des Landes.
Technisch gehört der japanische Lack zu jenert Er-
zeugnissen, deren Herstellungsweise der Westländer
nie ganz enträtseln wird. Ähnliches gilt votn Schwert-
schmuck und von den Netsukes. Richtig, daß diese ele-
ganten Tsubas und Mitokoromonos mit mannigfachsten
Einlagen und die ihrem Zwecke als Knöpfe oft ent-
fremdeten Netsuke meist einem oberflächlichen Luxus
dienten und daß ihre Bearbeitung oft ans Spielerische
zu erwarten. Im Gegenteil, die Japaner fangen bereits
an, Rückkäufe zu machen. Denn was über den Unter-
gang des Handwerkes in China gesagt wurde, gilt für
Japan nicht minder. Japan ist augenblicklich das teu-
erste Land der Welt, wie kürzlich im japanischen Par-
lament festgestellt wurde. Zur Herstellung eines gut
gearbeiteten Lackes gehören viele Monate, eines liebe-
voll durchgebildeten Tsuba oder Netsuke Wochen —,
die Kosteu für neue Stücke würden die der älteren er-
reichen oder iibersteigen.
Zum Scliluß noch ein Wort über die japanische
Keramik. Das bemalte Porzellan tritt ganz zurück
zu Gunsten des schlichten Steinzeuges mit geflossenen
Glasuren. Die Rolle, die das reich verzierte Porzellan
in China spielte, hat in Japan der Lack übernommen.
In der Tat blühten beide Kunstübungen in derselben Zeit
und haben stilistisch wie zeitlich eine fast parallele Ent-
wicklung durchgemacht. Die japanische Töpferkunst
setzt im 17. und 18. Jahrhundert die Tradition der chine-
sischen Sungzeit fort. Sicherlich werden die chinesi-
schen Erzeugnisse der älteren Zeit ihre japanischen
330
panisches mit Sicherheit zu unterscheiden. Und der
Farbenholzschnitt, den man zum Kunsthandwerk rech-
nen muß, steht trotz seiner Preise innerhalb dieses Ge-
bietes nicht einmal an erster Stelle. Ritualbronzen aus
vorchristlicher Zeit, wie aus China, sind aus Japan aller-
dings höchstens iu Gestalt moderner Nachempfindungen
oder Fälschungen zu erwarten. Und Jade und anderes
Gestein wurde dort selten verarbeitet. Der japanische
Boden wird überhaupt kaum noch unerwartete Schätze
offenbaren. Aber es befinden sich japanische Lack-,
Metallarbeiten und Kleinplastiken in nicht geringer Zahl
bei uns, nicht gerade oft Erzeugnisse der besten Zeit,
doch technisch unübertreffliche Werke der letzten Jahr-
grenzt. Bestehen bleibt, daß die Art, wie es dem Tsu-
bameister gelungen ist, den winzigen Raum einer
Scheibe von neun bis zehn Zentimetern Durchmesser
mit unerschöpflicher Phantasie aufzuteilen oder dem
Drechsler ein knopfförmiges Stück Elfenbein oder
Buchsbaumholz in eine lebendige Figurengruppe umzu-
bilden, nirgends ein Gegenstiick hat. Tsuba und Netsuke
sind in gewisser Weise ideale Sammlungsgegenstände.
Sie nehmen geringen Raum ein, verlangen Nahsicht oder
gar Berührung, bieten trotz ihres winzigen Umfanges
immer neue inhaltliche und technische Überraschungen
und sind vorläufig noch zu erschwinglichen Preisen er-
reichbar. Gute Arbeiten werden allerdings immer
seltener werden. Aus der Heimat ist kaum noch etwas
Abb. 6. Kozuka aus
Shibuichi mit Ein-
lagen. Schauspieler
Abb. 5. Schwertschmuck,
Zwinge und Kopfstück aus
Shakudo mit Einlagen.
Bltihende Blumen
Abb. 7. Kozuka aus
Shibuichi mit Ein-
lagen. Kröte
hunderte. Der chinesischen Porzellankunst hat Europa
wenigstens bis zu einem gewissen Grade Ähnliches an
die Seite zu stelien vermocht, übrigens von China eben-
so abhängig, wie Japan, nicht aber den japanischen
Lackarbeiten, den Schwertschmuck und den Netsuke.
Diese Erzeugnisse japanischer Kunstfertigkeit stehen
in der Tat einzig in der Welt da. Hat man dem japani-
schen Goldlack den Vorwurf virtuoser Küiile gemacht,
so gilt das in mindestens so hohem Maße von den chi-
nesischen Porzellanen. Doch der Erfindungsreichtum
itn Schmuck der Lackarbeiten übertrifft den der chine-
sischen Töpfereien und ist reicher an sinnigen Be-
ziehungen zu der ganzen Geisteskultur des Landes.
Technisch gehört der japanische Lack zu jenert Er-
zeugnissen, deren Herstellungsweise der Westländer
nie ganz enträtseln wird. Ähnliches gilt votn Schwert-
schmuck und von den Netsukes. Richtig, daß diese ele-
ganten Tsubas und Mitokoromonos mit mannigfachsten
Einlagen und die ihrem Zwecke als Knöpfe oft ent-
fremdeten Netsuke meist einem oberflächlichen Luxus
dienten und daß ihre Bearbeitung oft ans Spielerische
zu erwarten. Im Gegenteil, die Japaner fangen bereits
an, Rückkäufe zu machen. Denn was über den Unter-
gang des Handwerkes in China gesagt wurde, gilt für
Japan nicht minder. Japan ist augenblicklich das teu-
erste Land der Welt, wie kürzlich im japanischen Par-
lament festgestellt wurde. Zur Herstellung eines gut
gearbeiteten Lackes gehören viele Monate, eines liebe-
voll durchgebildeten Tsuba oder Netsuke Wochen —,
die Kosteu für neue Stücke würden die der älteren er-
reichen oder iibersteigen.
Zum Scliluß noch ein Wort über die japanische
Keramik. Das bemalte Porzellan tritt ganz zurück
zu Gunsten des schlichten Steinzeuges mit geflossenen
Glasuren. Die Rolle, die das reich verzierte Porzellan
in China spielte, hat in Japan der Lack übernommen.
In der Tat blühten beide Kunstübungen in derselben Zeit
und haben stilistisch wie zeitlich eine fast parallele Ent-
wicklung durchgemacht. Die japanische Töpferkunst
setzt im 17. und 18. Jahrhundert die Tradition der chine-
sischen Sungzeit fort. Sicherlich werden die chinesi-
schen Erzeugnisse der älteren Zeit ihre japanischen
330