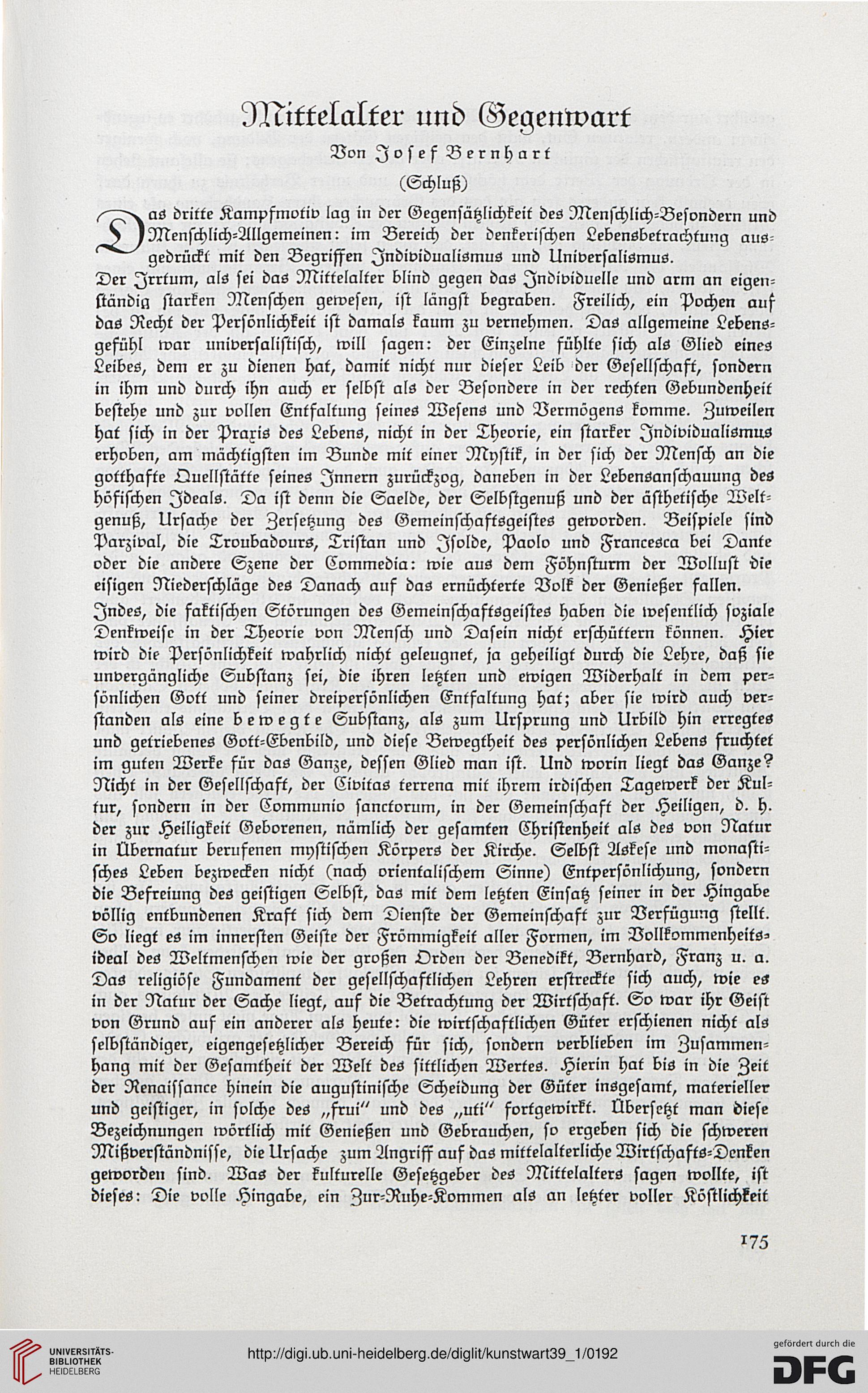MiLtelalLer und GegenwarL
Don Josef Bernhart
(Schlnß)
as dritte Kampfrnotiv lag in der Gegensätzlichkeit des Menfchlich-Besondern und
^ iMenfchlich-Allgemeinen: im Bereich der denkerifchen Lebensbetrachtung aus-
gedrückt mit den Begriffen Jndividualismus und Universalismus.
Der Jrrtum, als sei das Mittelalter blind gegen daS Jndividuelle und arm an eigen-
ftändig starken Menfchen gewesen, ist längst begraben. Freilich, ein Pochcn auf
das Recht der Persönlichkeit ist damals kaum zu vernehmen. Das allgemeine Lebens-
gefühl war um'versalistifch, will sagen: der Einzelne fühlte sich als Glied eines
Leibes, dem er zu dienen hat, damit nicht nur dieser Leib der Gesellfchaft, sondern
in ihm und durch ihn auch er selbst als der Besondere in der rechten Gebundenheit
bestehe und zur vollen Entfaltung seines WesenS und Bermögens komme. Zuweilen
hat sich in der Praxis deS Lebens, nicht in der Theorie, ein starker Jndividualismus
erhoben, am mächtigsten im Bunde mit eincr Mystik, in der sich der Menfch an die
gotthafte Quellstätte seines Jnnern zurückzog, daneben in der Lebensanfchauung des
höfifchen Jdeals. Da ist denn die Saelde, der Selbstgenuß und der ästhetische Welt-
genuß, Ursache der Zersetzung des Gemeinfchaftögeistes geworden. Beispiele sind
Parzival, die Troubadours, Tristan und Jsolde, Paolo und Francesca bei Dante
oder die andere Szene der Commedia: wie aus dem Föhnsturm der Wollust die
eisigen Niederfchläge des Danach auf das ernüchterte Bolk der Genießer fallen.
JndeS, die faktifchen Störungen des Gemeinfchaftsgeistes haben die wesentlich soziale
Denkweise in der Theorie von Menfch und Dasein nichk erfchüttern können. Hier
wird die Persönlichkeit wahrlich nicht geleugnet, ja geheiligt durch die Lehre, daß sie
unvergängliche Substanz sei, die ihren letzten und ewigen Widerhalt in dem per-
sönlichen Gott und seiner dreipersönlichen Entfaltung hat; aber sie wird auch ver-
standen als eine bewegte Substanz, als zum Ursprung und Urbild hin errcgkes
und getriebenes Gott-Ebenbild, und diese Bewegtheit des persönlichen Lebens fruchtet
im guten Werke für das Ganze, dessen Glied man ist. Und worin liegt das Ganze?
Nicht in der Gesellfchaft, der Civitas terrena mit ihrem irdifchen Tagewerk der Kul-
tur, sondern in der Commum'o sanctorum, in der Gemeinfchaft der Heiligen, d. h.
der zur Heiligkeit Geborenen, nämlich der gesamten Christenheit als des von Natur
in Ubernatur berufenen mystifchen Körpers der Kirche. Selbst Askese und monafti-
fches Leben bezwecken nicht (nach orientalifchem Sinne) Entpersönlichung, sondern
die Befreiung des geistigen Selbst, das mit dem letzten Einsatz seiner in der Hingabe
völli'g entbundenen Kraft sich dem Dienste der Gemeinfchaft zur Derfügung stellt.
So liegt es im innersten Geifte der Frömmigkeit aller Formen, im BollkommenheitS--
ideal des Weltmenfchen wie der großen Orden der Benedikt, Bernhard, Franz u. a.
Das religiöse Fundament der gesellfchaftlichen Lehren erstreckte sich auch, wie es
in der Natur der Sache liegk, auf die Betrachtung der Wirtfchaft. So war ihr Geist
von Grund auf ein anderer als heute: die wirtfchaftlichen Güter erfchiencn nicht als
selbständiger, eigengesetzlicher Bereich für sich, sondern verblieben im Zusammen-
hang mit der Gesamtheit der Welt deö sittlichen Wertes. Hierin hat bis in die Zeit
der Renaissance hinein die auguftinifche Scheidung der Güter insgesamt, materieller
und geistiger, in solche des „frui" und des „uti" forkgewirkt. Übersetzt man diese
Bezeichnungen wörtlich mit Genießen und Gebrauchen, so ergeben sich die fchweren
Mißverftändnisse, die Ursache zum Angriff auf daS nüttelalterliche Wi'rtfchaftS-Denken
geworden sind. Was der kulturelle Gesetzgeber des Mittelalters sagen wollte, ift
dieses: Die volle Hingabe, ein Zur-Ruhe-Kommen als an lehter voller Köftlichkeit
175
Don Josef Bernhart
(Schlnß)
as dritte Kampfrnotiv lag in der Gegensätzlichkeit des Menfchlich-Besondern und
^ iMenfchlich-Allgemeinen: im Bereich der denkerifchen Lebensbetrachtung aus-
gedrückt mit den Begriffen Jndividualismus und Universalismus.
Der Jrrtum, als sei das Mittelalter blind gegen daS Jndividuelle und arm an eigen-
ftändig starken Menfchen gewesen, ist längst begraben. Freilich, ein Pochcn auf
das Recht der Persönlichkeit ist damals kaum zu vernehmen. Das allgemeine Lebens-
gefühl war um'versalistifch, will sagen: der Einzelne fühlte sich als Glied eines
Leibes, dem er zu dienen hat, damit nicht nur dieser Leib der Gesellfchaft, sondern
in ihm und durch ihn auch er selbst als der Besondere in der rechten Gebundenheit
bestehe und zur vollen Entfaltung seines WesenS und Bermögens komme. Zuweilen
hat sich in der Praxis deS Lebens, nicht in der Theorie, ein starker Jndividualismus
erhoben, am mächtigsten im Bunde mit eincr Mystik, in der sich der Menfch an die
gotthafte Quellstätte seines Jnnern zurückzog, daneben in der Lebensanfchauung des
höfifchen Jdeals. Da ist denn die Saelde, der Selbstgenuß und der ästhetische Welt-
genuß, Ursache der Zersetzung des Gemeinfchaftögeistes geworden. Beispiele sind
Parzival, die Troubadours, Tristan und Jsolde, Paolo und Francesca bei Dante
oder die andere Szene der Commedia: wie aus dem Föhnsturm der Wollust die
eisigen Niederfchläge des Danach auf das ernüchterte Bolk der Genießer fallen.
JndeS, die faktifchen Störungen des Gemeinfchaftsgeistes haben die wesentlich soziale
Denkweise in der Theorie von Menfch und Dasein nichk erfchüttern können. Hier
wird die Persönlichkeit wahrlich nicht geleugnet, ja geheiligt durch die Lehre, daß sie
unvergängliche Substanz sei, die ihren letzten und ewigen Widerhalt in dem per-
sönlichen Gott und seiner dreipersönlichen Entfaltung hat; aber sie wird auch ver-
standen als eine bewegte Substanz, als zum Ursprung und Urbild hin errcgkes
und getriebenes Gott-Ebenbild, und diese Bewegtheit des persönlichen Lebens fruchtet
im guten Werke für das Ganze, dessen Glied man ist. Und worin liegt das Ganze?
Nicht in der Gesellfchaft, der Civitas terrena mit ihrem irdifchen Tagewerk der Kul-
tur, sondern in der Commum'o sanctorum, in der Gemeinfchaft der Heiligen, d. h.
der zur Heiligkeit Geborenen, nämlich der gesamten Christenheit als des von Natur
in Ubernatur berufenen mystifchen Körpers der Kirche. Selbst Askese und monafti-
fches Leben bezwecken nicht (nach orientalifchem Sinne) Entpersönlichung, sondern
die Befreiung des geistigen Selbst, das mit dem letzten Einsatz seiner in der Hingabe
völli'g entbundenen Kraft sich dem Dienste der Gemeinfchaft zur Derfügung stellt.
So liegt es im innersten Geifte der Frömmigkeit aller Formen, im BollkommenheitS--
ideal des Weltmenfchen wie der großen Orden der Benedikt, Bernhard, Franz u. a.
Das religiöse Fundament der gesellfchaftlichen Lehren erstreckte sich auch, wie es
in der Natur der Sache liegk, auf die Betrachtung der Wirtfchaft. So war ihr Geist
von Grund auf ein anderer als heute: die wirtfchaftlichen Güter erfchiencn nicht als
selbständiger, eigengesetzlicher Bereich für sich, sondern verblieben im Zusammen-
hang mit der Gesamtheit der Welt deö sittlichen Wertes. Hierin hat bis in die Zeit
der Renaissance hinein die auguftinifche Scheidung der Güter insgesamt, materieller
und geistiger, in solche des „frui" und des „uti" forkgewirkt. Übersetzt man diese
Bezeichnungen wörtlich mit Genießen und Gebrauchen, so ergeben sich die fchweren
Mißverftändnisse, die Ursache zum Angriff auf daS nüttelalterliche Wi'rtfchaftS-Denken
geworden sind. Was der kulturelle Gesetzgeber des Mittelalters sagen wollte, ift
dieses: Die volle Hingabe, ein Zur-Ruhe-Kommen als an lehter voller Köftlichkeit
175