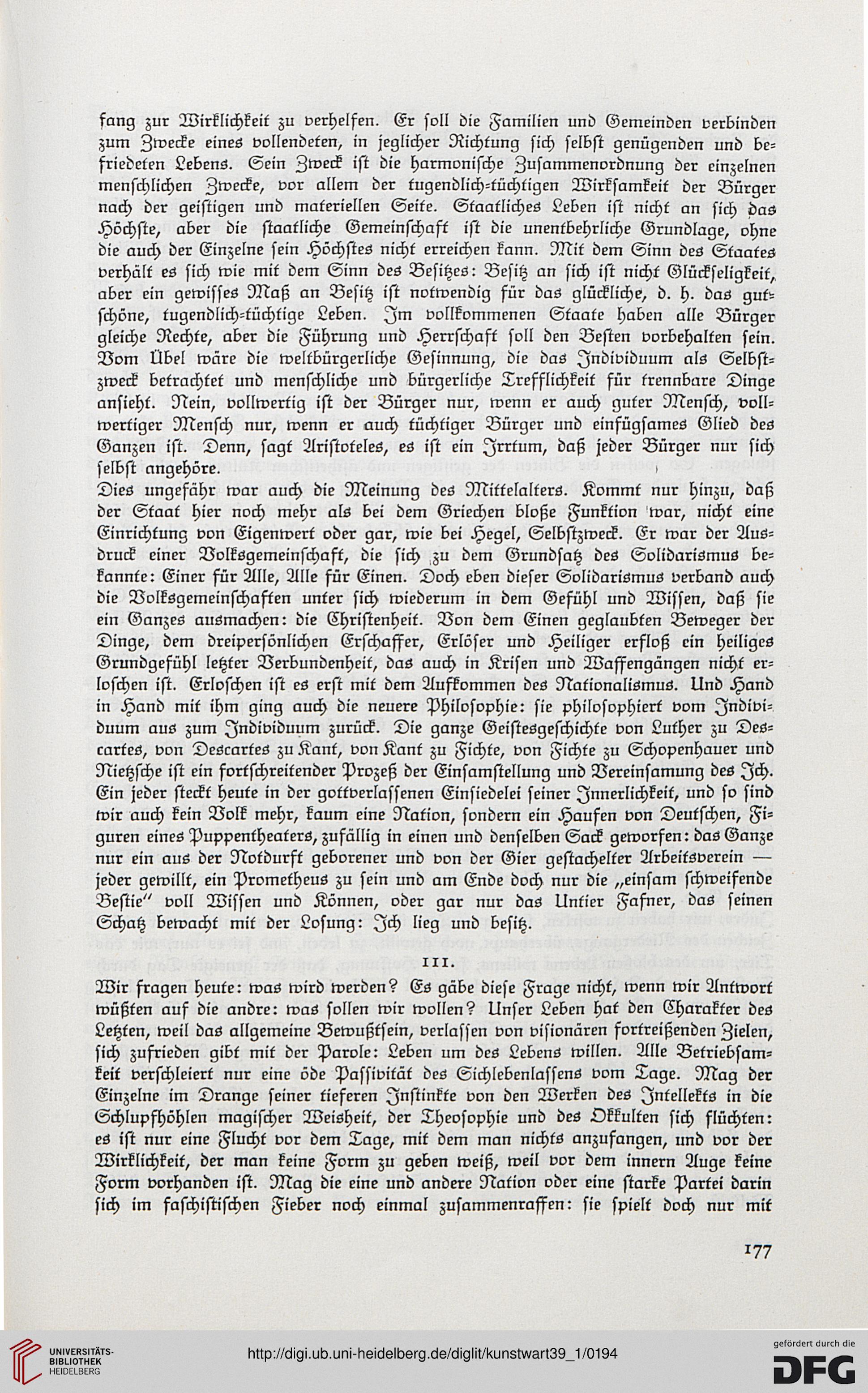fang znr WirklichkeiL zu verhelfen. Er soll die Famili'en und Genieinden verbinden
zum Zwecke eines vollendeten, in jeglicher Richtung sich selbst genügenöen und be-
friedeten Lebens. Sein Ztveck ist di'e harmvmsche Zusammenordnung der cinzelnen
menschlichen Zwecke, vor allem der kugendli'ch-tuchtigen Wi'rksamkeit der Bürger
nach der gei'stigen und materiellen Sei'te. Staatli'ches Leben i'st nicht an si'ch daS
Höchste, aber die staatli'che Gememschaft ist di'e unentbehrli'che Grundlage, ohne
die auch der Einzelne sein Höchstes ni'cht erreichen kann. Mit dem Si'nn des Staates
verhält es sich tvie mit dem Sinn des Besitzes: Besitz an sich ist nicht Glückseligkeit,.
aber ei'n gewisses Maß an Besitz ist notwendig für daS glückliche, d. h. das gut-
schöne, tugendlich-tüchtige Leben. Jm vollkommenen Staate haben alle Bürger
gleiche Nechte, aber die Führung und Herrschaft soll den Besten vorbehalten sein.
Vom blbel wäre die weltbürgerliche Gesinnung, die das Jndividuum als Selbst-
zweck betrachtet und menschliche und bürgerliche Trefflichkeit für trennbare Dinge
ansieht. Nein, vollwertig ist der Bürger nur, wenn er auch guter Mcnsch, voll-
wertiger Mensch nur, wenn er auch tüchtiger Bürger und einsügsames Glied des
Ganzen ist. Denn, sagt Aristoteles, eü ist ein Jrrtum, daß jeder Bürger nur sich
selbst angehöre. >
Dies ungefähr war auch die Meinung des Mittelalters. Kommt nur hinzu, daß
der Staat hier noch mehr als bei dem Griechen bloße Funktion war, nicht eine
Einrichtung von Eigenwert oder gar, wie bei Hegel, Selbstzweck. Er war der Aus-
druck einer Dolksgemeinschaft, die sich zu dem Grundsatz des SolidarismuS be-
kannte: Einer sür Alle, Alle für Einen. Doch eben dieser Solidarismus verband auch
die Volksgemeinschaften unter sich wiederum in dem Gefühl und Wissen, daß sie
ein Ganzes ausmachen: die Christenheit. Von dem Einen geglaubten Beweger der
Dinge, dem dreipersönlichen Erschaffer, Erlöser und Heiliger erfloß ein heiligeS
Grundgefühl letzter Verbundenheit, das auch in Krisen und Waffengängen nicht er-
loschen ist. Erloschen ist es erst mit dem Aufkommen des Nationalismus. Und Hand
in Hand mit ihm ging auch die neuere Philosophie: sie philosophiert vom Jndivi-
duum aus zum Jndividuum zurück. Die ganze Geistesgeschichte von Luther zu DeS-
cartes, von Descartes zu Kant, von Kant zu Fichte, von Fichte zu Schopenhauer und
Nietzsche ist ein fortschreitender Prozeß der Einsamstellung und Bereinsamung des Jch.
Ein jeder steckt heute in der gottverlassenen Einsiedelei seiner Jnnerlichkeit, und so sind
wir auch kein Bolk mehr, kaum eine Nation, sondern ein Haufen von Deutschen, Fi-
guren eines Puppentheaters, zufällig in einen und denselben Sack geworfen: das Ganze
nur ein auS der Notdurft geborener und von der Gier gestachelter Arbeitsverein —
jeder gewillt, ein Prometheus zu sein und am Ende doch nur die „einsam schweifende
Bestie" voll Wissen und Können, oder gar nur das Untier Fafner, das seinen
Schatz bewacht mit der Losung: Jch lieg und besitz.
iii.
Wir fragen heute: was wird werden? Es gäbe diese Frage nicht, wenn wir Antwort
wüßten auf die andre: was sollen wir wollen? Unser Leben hat den Charakter des
Letzten, weil das allgemeine Bewußtsein, verlassen von visionären fortreißenden Zielen,
sich zufrieden gibt mit der Parole: Leben um des Lebens willen. Alle Betriebsam-
keit verschleiert nur eine öde Passivität des Sichlebenlassens vom Tagc. Mag der
Einzelne im Drange seiner tieferen Jnstinkte von den Werken des Jntellekts in die
Schlupfhöhlen magischer Weisheit, der Theosophie und des Okkulten sich flüchten:
es ist nur eine Flucht vor dem Tage, mit dem man m'chts anzufangen, und vor der
Wirklichkeit, der man keine Form zu geben weiß, weil vor dem innern Auge keine
Form vorhanden ift. Mag die eine und andere Nation oder eine starke Partei darin
sich im faschistifchen Fieber noch einmal zusammenraffen: sie spielt doch nur mit
177
zum Zwecke eines vollendeten, in jeglicher Richtung sich selbst genügenöen und be-
friedeten Lebens. Sein Ztveck ist di'e harmvmsche Zusammenordnung der cinzelnen
menschlichen Zwecke, vor allem der kugendli'ch-tuchtigen Wi'rksamkeit der Bürger
nach der gei'stigen und materiellen Sei'te. Staatli'ches Leben i'st nicht an si'ch daS
Höchste, aber die staatli'che Gememschaft ist di'e unentbehrli'che Grundlage, ohne
die auch der Einzelne sein Höchstes ni'cht erreichen kann. Mit dem Si'nn des Staates
verhält es sich tvie mit dem Sinn des Besitzes: Besitz an sich ist nicht Glückseligkeit,.
aber ei'n gewisses Maß an Besitz ist notwendig für daS glückliche, d. h. das gut-
schöne, tugendlich-tüchtige Leben. Jm vollkommenen Staate haben alle Bürger
gleiche Nechte, aber die Führung und Herrschaft soll den Besten vorbehalten sein.
Vom blbel wäre die weltbürgerliche Gesinnung, die das Jndividuum als Selbst-
zweck betrachtet und menschliche und bürgerliche Trefflichkeit für trennbare Dinge
ansieht. Nein, vollwertig ist der Bürger nur, wenn er auch guter Mcnsch, voll-
wertiger Mensch nur, wenn er auch tüchtiger Bürger und einsügsames Glied des
Ganzen ist. Denn, sagt Aristoteles, eü ist ein Jrrtum, daß jeder Bürger nur sich
selbst angehöre. >
Dies ungefähr war auch die Meinung des Mittelalters. Kommt nur hinzu, daß
der Staat hier noch mehr als bei dem Griechen bloße Funktion war, nicht eine
Einrichtung von Eigenwert oder gar, wie bei Hegel, Selbstzweck. Er war der Aus-
druck einer Dolksgemeinschaft, die sich zu dem Grundsatz des SolidarismuS be-
kannte: Einer sür Alle, Alle für Einen. Doch eben dieser Solidarismus verband auch
die Volksgemeinschaften unter sich wiederum in dem Gefühl und Wissen, daß sie
ein Ganzes ausmachen: die Christenheit. Von dem Einen geglaubten Beweger der
Dinge, dem dreipersönlichen Erschaffer, Erlöser und Heiliger erfloß ein heiligeS
Grundgefühl letzter Verbundenheit, das auch in Krisen und Waffengängen nicht er-
loschen ist. Erloschen ist es erst mit dem Aufkommen des Nationalismus. Und Hand
in Hand mit ihm ging auch die neuere Philosophie: sie philosophiert vom Jndivi-
duum aus zum Jndividuum zurück. Die ganze Geistesgeschichte von Luther zu DeS-
cartes, von Descartes zu Kant, von Kant zu Fichte, von Fichte zu Schopenhauer und
Nietzsche ist ein fortschreitender Prozeß der Einsamstellung und Bereinsamung des Jch.
Ein jeder steckt heute in der gottverlassenen Einsiedelei seiner Jnnerlichkeit, und so sind
wir auch kein Bolk mehr, kaum eine Nation, sondern ein Haufen von Deutschen, Fi-
guren eines Puppentheaters, zufällig in einen und denselben Sack geworfen: das Ganze
nur ein auS der Notdurft geborener und von der Gier gestachelter Arbeitsverein —
jeder gewillt, ein Prometheus zu sein und am Ende doch nur die „einsam schweifende
Bestie" voll Wissen und Können, oder gar nur das Untier Fafner, das seinen
Schatz bewacht mit der Losung: Jch lieg und besitz.
iii.
Wir fragen heute: was wird werden? Es gäbe diese Frage nicht, wenn wir Antwort
wüßten auf die andre: was sollen wir wollen? Unser Leben hat den Charakter des
Letzten, weil das allgemeine Bewußtsein, verlassen von visionären fortreißenden Zielen,
sich zufrieden gibt mit der Parole: Leben um des Lebens willen. Alle Betriebsam-
keit verschleiert nur eine öde Passivität des Sichlebenlassens vom Tagc. Mag der
Einzelne im Drange seiner tieferen Jnstinkte von den Werken des Jntellekts in die
Schlupfhöhlen magischer Weisheit, der Theosophie und des Okkulten sich flüchten:
es ist nur eine Flucht vor dem Tage, mit dem man m'chts anzufangen, und vor der
Wirklichkeit, der man keine Form zu geben weiß, weil vor dem innern Auge keine
Form vorhanden ift. Mag die eine und andere Nation oder eine starke Partei darin
sich im faschistifchen Fieber noch einmal zusammenraffen: sie spielt doch nur mit
177