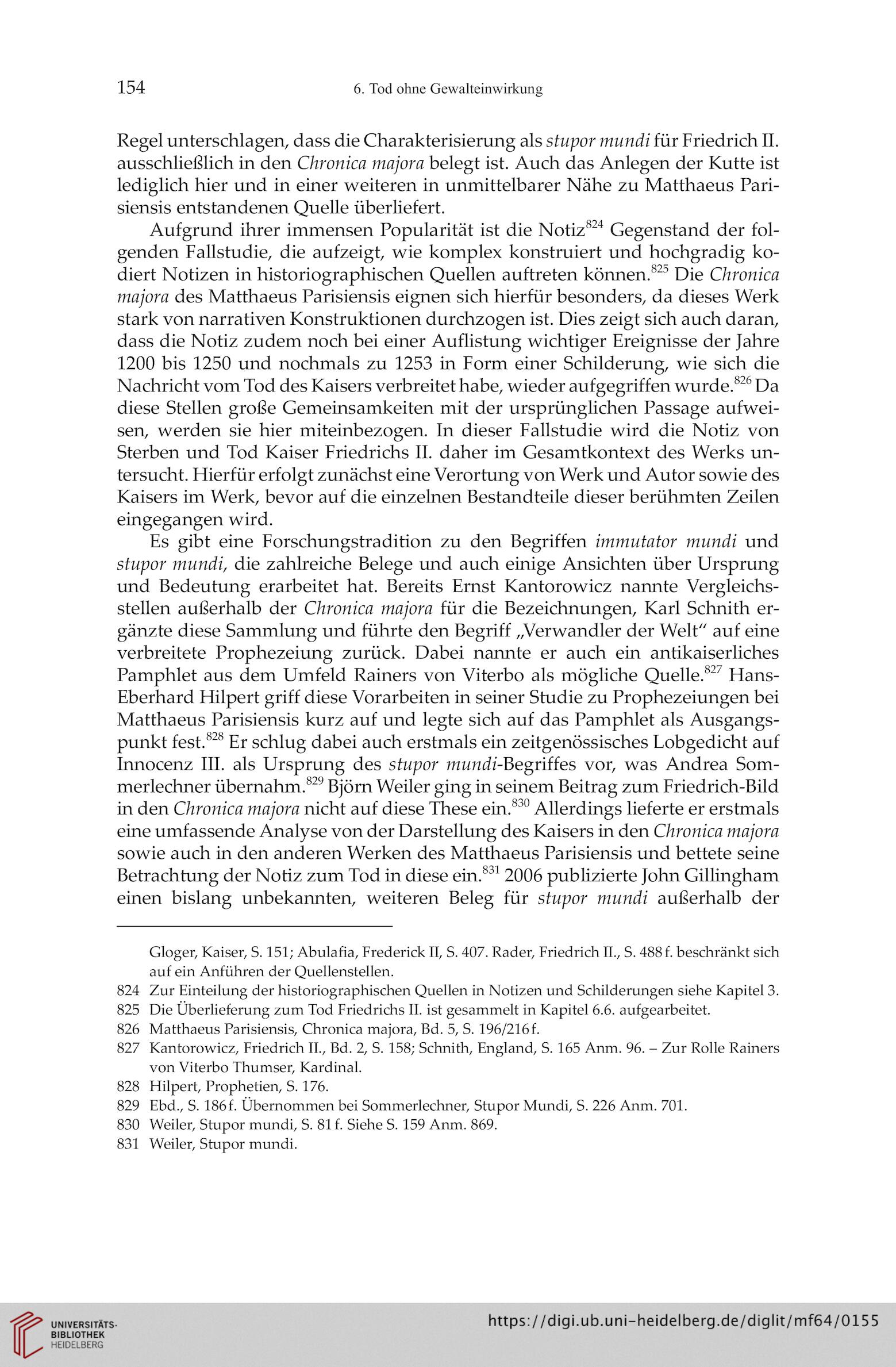154
6. Tod ohne Gewalteinwirkung
Regel unterschlagen, dass die Charakterisierung als stupor mundi für Friedrich II.
ausschließlich in den Chronica majora belegt ist. Auch das Anlegen der Kutte ist
lediglich hier und in einer weiteren in unmittelbarer Nähe zu Matthaeus Pari-
siensis entstandenen Quelle überliefert.
Aufgrund ihrer immensen Popularität ist die Notiz824 Gegenstand der fol-
genden Fallstudie, die aufzeigt, wie komplex konstruiert und hochgradig ko-
diert Notizen in historiographischen Quellen auftreten können.825 Die Chronica
majora des Matthaeus Parisiensis eignen sich hierfür besonders, da dieses Werk
stark von narrativen Konstruktionen durchzogen ist. Dies zeigt sich auch daran,
dass die Notiz zudem noch bei einer Auflistung wichtiger Ereignisse der Jahre
1200 bis 1250 und nochmals zu 1253 in Form einer Schilderung, wie sich die
Nachricht vom Tod des Kaisers verbreitet habe, wieder aufgegriffen wurde.826 Da
diese Stellen große Gemeinsamkeiten mit der ursprünglichen Passage aufwei-
sen, werden sie hier miteinbezogen. In dieser Fallstudie wird die Notiz von
Sterben und Tod Kaiser Friedrichs II. daher im Gesamtkontext des Werks un-
tersucht. Hierfür erfolgt zunächst eine Verortung von Werk und Autor sowie des
Kaisers im Werk, bevor auf die einzelnen Bestandteile dieser berühmten Zeilen
eingegangen wird.
Es gibt eine Forschungstradition zu den Begriffen immutator mundi und
stupor mundi, die zahlreiche Belege und auch einige Ansichten über Ursprung
und Bedeutung erarbeitet hat. Bereits Ernst Kantorowicz nannte Vergleichs-
stellen außerhalb der Chronica majora für die Bezeichnungen, Karl Schnith er-
gänzte diese Sammlung und führte den Begriff „Verwandler der Welt" auf eine
verbreitete Prophezeiung zurück. Dabei nannte er auch ein antikaiserliches
Pamphlet aus dem Umfeld Rainers von Viterbo als mögliche Quelle.827 Hans-
Eberhard Hilpert griff diese Vorarbeiten in seiner Studie zu Prophezeiungen bei
Matthaeus Parisiensis kurz auf und legte sich auf das Pamphlet als Ausgangs-
punkt fest.828 Er schlug dabei auch erstmals ein zeitgenössisches Lobgedicht auf
Innocenz III. als Ursprung des stupor mundi-Begriffes vor, was Andrea Som-
merlechner übernahm.829 Björn Weiler ging in seinem Beitrag zum Friedrich-Bild
in den Chronica majora nicht auf diese These ein.830 Allerdings lieferte er erstmals
eine umfassende Analyse von der Darstellung des Kaisers in den Chronica majora
sowie auch in den anderen Werken des Matthaeus Parisiensis und bettete seine
Betrachtung der Notiz zum Tod in diese ein.831 2006 publizierte John Gillingham
einen bislang unbekannten, weiteren Beleg für stupor mundi außerhalb der
Gloger, Kaiser, S. 151; Abulafia, Frederick II, S. 407. Rader, Friedrich II., S. 488 f. beschränkt sich
auf ein Anführen der Quellenstellen.
824 Zur Einteilung der historiographischen Quellen in Notizen und Schilderungen siehe Kapitel 3.
825 Die Überlieferung zum Tod Friedrichs II. ist gesammelt in Kapitel 6.6. aufgearbeitet.
826 Matthaeus Parisiensis, Chronica majora, Bd. 5, S. 196/216 f.
827 Kantorowicz, Friedrich II., Bd. 2, S. 158; Schnith, England, S. 165 Anm. 96. - Zur Rolle Rainers
von Viterbo Thumser, Kardinal.
828 Hilpert, Prophetien, S. 176.
829 Ebd., S. 186f. Übernommen bei Sommerlechner, Stupor Mundi, S. 226 Anm. 701.
830 Weiler, Stupor mundi, S. 81 f. Siehe S. 159 Anm. 869.
831 Weiler, Stupor mundi.
6. Tod ohne Gewalteinwirkung
Regel unterschlagen, dass die Charakterisierung als stupor mundi für Friedrich II.
ausschließlich in den Chronica majora belegt ist. Auch das Anlegen der Kutte ist
lediglich hier und in einer weiteren in unmittelbarer Nähe zu Matthaeus Pari-
siensis entstandenen Quelle überliefert.
Aufgrund ihrer immensen Popularität ist die Notiz824 Gegenstand der fol-
genden Fallstudie, die aufzeigt, wie komplex konstruiert und hochgradig ko-
diert Notizen in historiographischen Quellen auftreten können.825 Die Chronica
majora des Matthaeus Parisiensis eignen sich hierfür besonders, da dieses Werk
stark von narrativen Konstruktionen durchzogen ist. Dies zeigt sich auch daran,
dass die Notiz zudem noch bei einer Auflistung wichtiger Ereignisse der Jahre
1200 bis 1250 und nochmals zu 1253 in Form einer Schilderung, wie sich die
Nachricht vom Tod des Kaisers verbreitet habe, wieder aufgegriffen wurde.826 Da
diese Stellen große Gemeinsamkeiten mit der ursprünglichen Passage aufwei-
sen, werden sie hier miteinbezogen. In dieser Fallstudie wird die Notiz von
Sterben und Tod Kaiser Friedrichs II. daher im Gesamtkontext des Werks un-
tersucht. Hierfür erfolgt zunächst eine Verortung von Werk und Autor sowie des
Kaisers im Werk, bevor auf die einzelnen Bestandteile dieser berühmten Zeilen
eingegangen wird.
Es gibt eine Forschungstradition zu den Begriffen immutator mundi und
stupor mundi, die zahlreiche Belege und auch einige Ansichten über Ursprung
und Bedeutung erarbeitet hat. Bereits Ernst Kantorowicz nannte Vergleichs-
stellen außerhalb der Chronica majora für die Bezeichnungen, Karl Schnith er-
gänzte diese Sammlung und führte den Begriff „Verwandler der Welt" auf eine
verbreitete Prophezeiung zurück. Dabei nannte er auch ein antikaiserliches
Pamphlet aus dem Umfeld Rainers von Viterbo als mögliche Quelle.827 Hans-
Eberhard Hilpert griff diese Vorarbeiten in seiner Studie zu Prophezeiungen bei
Matthaeus Parisiensis kurz auf und legte sich auf das Pamphlet als Ausgangs-
punkt fest.828 Er schlug dabei auch erstmals ein zeitgenössisches Lobgedicht auf
Innocenz III. als Ursprung des stupor mundi-Begriffes vor, was Andrea Som-
merlechner übernahm.829 Björn Weiler ging in seinem Beitrag zum Friedrich-Bild
in den Chronica majora nicht auf diese These ein.830 Allerdings lieferte er erstmals
eine umfassende Analyse von der Darstellung des Kaisers in den Chronica majora
sowie auch in den anderen Werken des Matthaeus Parisiensis und bettete seine
Betrachtung der Notiz zum Tod in diese ein.831 2006 publizierte John Gillingham
einen bislang unbekannten, weiteren Beleg für stupor mundi außerhalb der
Gloger, Kaiser, S. 151; Abulafia, Frederick II, S. 407. Rader, Friedrich II., S. 488 f. beschränkt sich
auf ein Anführen der Quellenstellen.
824 Zur Einteilung der historiographischen Quellen in Notizen und Schilderungen siehe Kapitel 3.
825 Die Überlieferung zum Tod Friedrichs II. ist gesammelt in Kapitel 6.6. aufgearbeitet.
826 Matthaeus Parisiensis, Chronica majora, Bd. 5, S. 196/216 f.
827 Kantorowicz, Friedrich II., Bd. 2, S. 158; Schnith, England, S. 165 Anm. 96. - Zur Rolle Rainers
von Viterbo Thumser, Kardinal.
828 Hilpert, Prophetien, S. 176.
829 Ebd., S. 186f. Übernommen bei Sommerlechner, Stupor Mundi, S. 226 Anm. 701.
830 Weiler, Stupor mundi, S. 81 f. Siehe S. 159 Anm. 869.
831 Weiler, Stupor mundi.