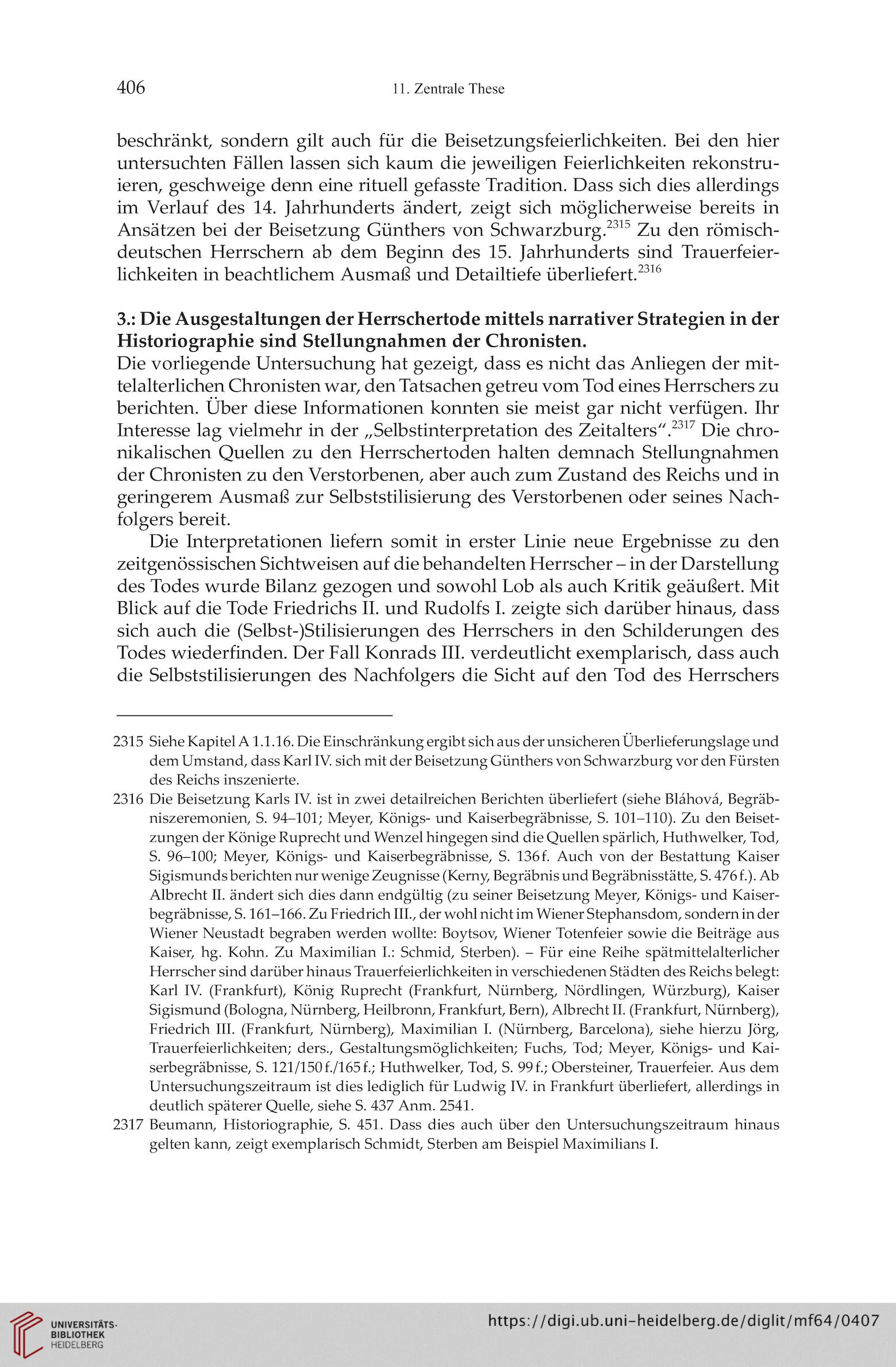406
11. Zentrale These
beschränkt, sondern gilt auch für die Beisetzungsfeierlichkeiten. Bei den hier
untersuchten Fällen lassen sich kaum die jeweiligen Feierlichkeiten rekonstru-
ieren, geschweige denn eine rituell gefasste Tradition. Dass sich dies allerdings
im Verlauf des 14. Jahrhunderts ändert, zeigt sich möglicherweise bereits in
Ansätzen bei der Beisetzung Günthers von Schwarzburg.2315 Zu den römisch-
deutschen Herrschern ab dem Beginn des 15. Jahrhunderts sind Trauerfeier-
lichkeiten in beachtlichem Ausmaß und Detailtiefe überliefert.2316
3.: Die Ausgestaltungen der Herrschertode mittels narrativer Strategien in der
Historiographie sind Stellungnahmen der Chronisten.
Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, dass es nicht das Anliegen der mit-
telalterlichen Chronisten war, den Tatsachen getreu vom Tod eines Herrschers zu
berichten. Uber diese Informationen konnten sie meist gar nicht verfügen. Ihr
Interesse lag vielmehr in der „Selbstinterpretation des Zeitalters".2317 Die chro-
nikalischen Quellen zu den Herrschertoden halten demnach Stellungnahmen
der Chronisten zu den Verstorbenen, aber auch zum Zustand des Reichs und in
geringerem Ausmaß zur Selbststilisierung des Verstorbenen oder seines Nach-
folgers bereit.
Die Interpretationen liefern somit in erster Linie neue Ergebnisse zu den
zeitgenössischen Sichtweisen auf die behandelten Herrscher - in der Darstellung
des Todes wurde Bilanz gezogen und sowohl Lob als auch Kritik geäußert. Mit
Blick auf die Tode Friedrichs II. und Rudolfs I. zeigte sich darüber hinaus, dass
sich auch die (Selbst-)Stilisierungen des Herrschers in den Schilderungen des
Todes wiederfinden. Der Fall Konrads III. verdeutlicht exemplarisch, dass auch
die Selbststilisierungen des Nachfolgers die Sicht auf den Tod des Herrschers
2315 Siehe Kapitel A1.1.16. Die Einschränkung ergibt sich aus der unsicheren Überlieferungslage und
dem Umstand, dass Karl IV. sich mit der Beisetzung Günthers von Schwarzburg vor den Fürsten
des Reichs inszenierte.
2316 Die Beisetzung Karls IV. ist in zwei detailreichen Berichten überliefert (siehe Blähovä, Begräb-
niszeremonien, S. 94-101; Meyer, Königs- und Kaiserbegräbnisse, S. 101-110). Zu den Beiset-
zungen der Könige Ruprecht und Wenzel hingegen sind die Quellen spärlich, Huth welker, Tod,
S. 96-100; Meyer, Königs- und Kaiserbegräbnisse, S. 136 f. Auch von der Bestattung Kaiser
Sigismunds berichten nur wenige Zeugnisse (Kerny Begräbnis und Begräbnisstätte, S. 476 f.). Ab
Albrecht II. ändert sich dies dann endgültig (zu seiner Beisetzung Meyer, Königs- und Kaiser-
begräbnisse, S. 161-166. Zu Friedrich III., der wohl nicht im Wiener Stephansdom, sondern in der
Wiener Neustadt begraben werden wollte: Boytsov, Wiener Totenfeier sowie die Beiträge aus
Kaiser, hg. Kohn. Zu Maximilian I.: Schmid, Sterben). - Für eine Reihe spätmittelalterlicher
Herrscher sind darüber hinaus Trauerfeierlichkeiten in verschiedenen Städten des Reichs belegt:
Karl IV (Frankfurt), König Ruprecht (Frankfurt, Nürnberg, Nördlingen, Würzburg), Kaiser
Sigismund (Bologna, Nürnberg, Heilbronn, Frankfurt, Bern), Albrecht II. (Frankfurt, Nürnberg),
Friedrich III. (Frankfurt, Nürnberg), Maximilian I. (Nürnberg, Barcelona), siehe hierzu Jörg,
Trauerfeierlichkeiten; ders., Gestaltungsmöglichkeiten; Fuchs, Tod; Meyer, Königs- und Kai-
serbegräbnisse, S. 121/150 f./165f.; Huthwelker, Tod, S. 99 f.; Obersteiner, Trauerfeier. Aus dem
Untersuchungszeitraum ist dies lediglich für Ludwig IV in Frankfurt überliefert, allerdings in
deutlich späterer Quelle, siehe S. 437 Anm. 2541.
2317 Beumann, Historiographie, S. 451. Dass dies auch über den Untersuchungszeitraum hinaus
gelten kann, zeigt exemplarisch Schmidt, Sterben am Beispiel Maximilians I.
11. Zentrale These
beschränkt, sondern gilt auch für die Beisetzungsfeierlichkeiten. Bei den hier
untersuchten Fällen lassen sich kaum die jeweiligen Feierlichkeiten rekonstru-
ieren, geschweige denn eine rituell gefasste Tradition. Dass sich dies allerdings
im Verlauf des 14. Jahrhunderts ändert, zeigt sich möglicherweise bereits in
Ansätzen bei der Beisetzung Günthers von Schwarzburg.2315 Zu den römisch-
deutschen Herrschern ab dem Beginn des 15. Jahrhunderts sind Trauerfeier-
lichkeiten in beachtlichem Ausmaß und Detailtiefe überliefert.2316
3.: Die Ausgestaltungen der Herrschertode mittels narrativer Strategien in der
Historiographie sind Stellungnahmen der Chronisten.
Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, dass es nicht das Anliegen der mit-
telalterlichen Chronisten war, den Tatsachen getreu vom Tod eines Herrschers zu
berichten. Uber diese Informationen konnten sie meist gar nicht verfügen. Ihr
Interesse lag vielmehr in der „Selbstinterpretation des Zeitalters".2317 Die chro-
nikalischen Quellen zu den Herrschertoden halten demnach Stellungnahmen
der Chronisten zu den Verstorbenen, aber auch zum Zustand des Reichs und in
geringerem Ausmaß zur Selbststilisierung des Verstorbenen oder seines Nach-
folgers bereit.
Die Interpretationen liefern somit in erster Linie neue Ergebnisse zu den
zeitgenössischen Sichtweisen auf die behandelten Herrscher - in der Darstellung
des Todes wurde Bilanz gezogen und sowohl Lob als auch Kritik geäußert. Mit
Blick auf die Tode Friedrichs II. und Rudolfs I. zeigte sich darüber hinaus, dass
sich auch die (Selbst-)Stilisierungen des Herrschers in den Schilderungen des
Todes wiederfinden. Der Fall Konrads III. verdeutlicht exemplarisch, dass auch
die Selbststilisierungen des Nachfolgers die Sicht auf den Tod des Herrschers
2315 Siehe Kapitel A1.1.16. Die Einschränkung ergibt sich aus der unsicheren Überlieferungslage und
dem Umstand, dass Karl IV. sich mit der Beisetzung Günthers von Schwarzburg vor den Fürsten
des Reichs inszenierte.
2316 Die Beisetzung Karls IV. ist in zwei detailreichen Berichten überliefert (siehe Blähovä, Begräb-
niszeremonien, S. 94-101; Meyer, Königs- und Kaiserbegräbnisse, S. 101-110). Zu den Beiset-
zungen der Könige Ruprecht und Wenzel hingegen sind die Quellen spärlich, Huth welker, Tod,
S. 96-100; Meyer, Königs- und Kaiserbegräbnisse, S. 136 f. Auch von der Bestattung Kaiser
Sigismunds berichten nur wenige Zeugnisse (Kerny Begräbnis und Begräbnisstätte, S. 476 f.). Ab
Albrecht II. ändert sich dies dann endgültig (zu seiner Beisetzung Meyer, Königs- und Kaiser-
begräbnisse, S. 161-166. Zu Friedrich III., der wohl nicht im Wiener Stephansdom, sondern in der
Wiener Neustadt begraben werden wollte: Boytsov, Wiener Totenfeier sowie die Beiträge aus
Kaiser, hg. Kohn. Zu Maximilian I.: Schmid, Sterben). - Für eine Reihe spätmittelalterlicher
Herrscher sind darüber hinaus Trauerfeierlichkeiten in verschiedenen Städten des Reichs belegt:
Karl IV (Frankfurt), König Ruprecht (Frankfurt, Nürnberg, Nördlingen, Würzburg), Kaiser
Sigismund (Bologna, Nürnberg, Heilbronn, Frankfurt, Bern), Albrecht II. (Frankfurt, Nürnberg),
Friedrich III. (Frankfurt, Nürnberg), Maximilian I. (Nürnberg, Barcelona), siehe hierzu Jörg,
Trauerfeierlichkeiten; ders., Gestaltungsmöglichkeiten; Fuchs, Tod; Meyer, Königs- und Kai-
serbegräbnisse, S. 121/150 f./165f.; Huthwelker, Tod, S. 99 f.; Obersteiner, Trauerfeier. Aus dem
Untersuchungszeitraum ist dies lediglich für Ludwig IV in Frankfurt überliefert, allerdings in
deutlich späterer Quelle, siehe S. 437 Anm. 2541.
2317 Beumann, Historiographie, S. 451. Dass dies auch über den Untersuchungszeitraum hinaus
gelten kann, zeigt exemplarisch Schmidt, Sterben am Beispiel Maximilians I.