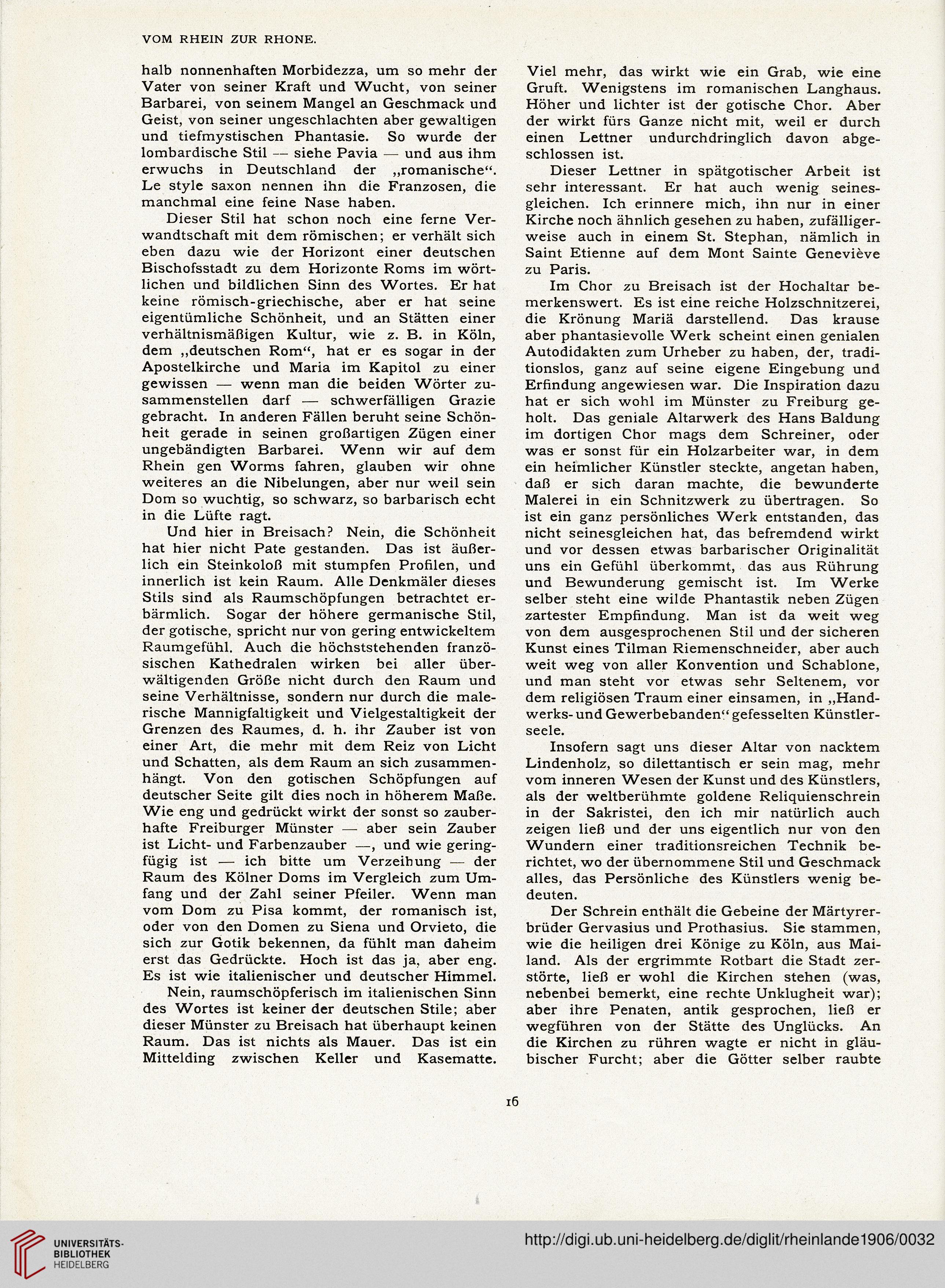VOM RHEIN ZUR RHONE.
halb nonnenhaften Morbidezza, um so mehr der
Vater von seiner Kraft und Wucht, von seiner
Barbarei, von seinem Mangel an Geschmack und
Geist, von seiner ungeschlachten aber gewaltigen
und tiefmystischen Phantasie. So wurde der
lombardische Stil — siehe Pavia — und aus ihm
erwuchs in Deutschland der „romanische“.
Le style saxon nennen ihn die Franzosen, die
manchmal eine feine Nase haben.
Dieser Stil hat schon noch eine ferne Ver-
wandtschaft mit dem römischen; er verhält sich
eben dazu wie der Horizont einer deutschen
Bischofsstadt zu dem Horizonte Roms im wört-
lichen und bildlichen Sinn des Wortes. Er hat
keine römisch-griechische, aber er hat seine
eigentümliche Schönheit, und an Stätten einer
verhältnismäßigen Kultur, wie z. B. in Köln,
dem „deutschen Rom“, hat er es sogar in der
Apostelkirche und Maria im Kapitol zu einer
gewissen — wenn man die beiden Wörter zu-
sammenstellen darf — schwerfälligen Grazie
gebracht. In anderen Fällen beruht seine Schön-
heit gerade in seinen großartigen Zügen einer
ungebändigten Barbarei. Wenn wir auf dem
Rhein gen Worms fahren, glauben wir ohne
weiteres an die Nibelungen, aber nur weil sein
Dom so wuchtig, so schwarz, so barbarisch echt
in die Lüfte ragt.
Und hier in Breisach? Nein, die Schönheit
hat hier nicht Pate gestanden. Das ist äußer-
lich ein Steinkoloß mit stumpfen Profilen, und
innerlich ist kein Raum. Alle Denkmäler dieses
Stils sind als Raumschöpfungen betrachtet er-
bärmlich. Sogar der höhere germanische Stil,
der gotische, spricht nur von gering entwickeltem
Raumgefühl. Auch die höchststehenden franzö-
sischen Kathedralen wirken bei aller über-
wältigenden Größe nicht durch den Raum und
seine Verhältnisse, sondern nur durch die male-
rische Mannigfaltigkeit und Vielgestaltigkeit der
Grenzen des Raumes, d. h. ihr Zauber ist von
einer Art, die mehr mit dem Reiz von Licht
und Schatten, als dem Raum an sich zusammen-
hängt. Von den gotischen Schöpfungen auf
deutscher Seite gilt dies noch in höherem Maße.
Wie eng und gedrückt wirkt der sonst so zauber-
hafte Freiburger Münster — aber sein Zauber
ist Licht- und Farbenzauber —, und wie gering-
fügig ist — ich bitte um Verzeihung — der
Raum des Kölner Doms im Vergleich zum Um-
fang und der Zahl seiner Pfeiler. Wenn man
vom Dom zu Pisa kommt, der romanisch ist,
oder von den Domen zu Siena und Orvieto, die
sich zur Gotik bekennen, da fühlt man daheim
erst das Gedrückte. Hoch ist das ja, aber eng.
Es ist wie italienischer und deutscher Himmel.
Nein, raumschöpferisch im italienischen Sinn
des Wortes ist keiner der deutschen Stile; aber
dieser Münster zu Breisach hat überhaupt keinen
Raum. Das ist nichts als Mauer. Das ist ein
Mittelding zwischen Keller und Kasematte.
Viel mehr, das wirkt wie ein Grab, wie eine
Gruft. Wenigstens im romanischen Langhaus.
Höher und lichter ist der gotische Chor. Aber
der wirkt fürs Ganze nicht mit, weil er durch
einen Lettner undurchdringlich davon abge-
schlossen ist.
Dieser Lettner in spätgotischer Arbeit ist
sehr interessant. Er hat auch wenig seines-
gleichen. Ich erinnere mich, ihn nur in einer
Kirche noch ähnlich gesehen zu haben, zufälliger-
weise auch in einem St. Stephan, nämlich in
Saint Etienne auf dem Mont Sainte Genevieve
zu Paris.
Im Chor zu Breisach ist der Hochaltar be-
merkenswert. Es ist eine reiche Holzschnitzerei,
die Krönung Mariä darstellend. Das krause
aber phantasievolle Werk scheint einen genialen
Autodidakten zum Urheber zu haben, der, tradi-
tionslos, ganz auf seine eigene Eingebung und
Erfindung angewiesen war. Die Inspiration dazu
hat er sich wohl im Münster zu Freiburg ge-
holt. Das geniale Altarwerk des Hans Baidung
im dortigen Chor mags dem Schreiner, oder
was er sonst für ein Holzarbeiter war, in dem
ein heimlicher Künstler steckte, angetan haben,
daß er sich daran machte, die bewunderte
Malerei in ein Schnitzwerk zu übertragen. So
ist ein ganz persönliches Werk entstanden, das
nicht seinesgleichen hat, das befremdend wirkt
und vor dessen etwas barbarischer Originalität
uns ein Gefühl überkommt, das aus Rührung
und Bewunderung gemischt ist. Im Werke
selber steht eine wilde Phantastik neben Zügen
zartester Empfindung. Man ist da weit weg
von dem ausgesprochenen Stil und der sicheren
Kunst eines Tilman Riemenschneider, aber auch
weit weg von aller Konvention und Schablone,
und man steht vor etwas sehr Seltenem, vor
dem religiösen Traum einer einsamen, in „Hand-
werks- und Gewerbebanden“ gefesselten Künstler-
seele.
Insofern sagt uns dieser Altar von nacktem
Lindenholz, so dilettantisch er sein mag, mehr
vom inneren Wesen der Kunst und des Künstlers,
als der weltberühmte goldene Reliquienschrein
in der Sakristei, den ich mir natürlich auch
zeigen ließ und der uns eigentlich nur von den
Wundern einer traditionsreichen Technik be-
richtet, wo der übernommene Stil und Geschmack
alles, das Persönliche des Künstlers wenig be-
deuten.
Der Schrein enthält die Gebeine der Märtyrer-
brüder Gervasius und Prothasius. Sie stammen,
wie die heiligen drei Könige zu Köln, aus Mai-
land. Als der ergrimmte Rotbart die Stadt zer-
störte, ließ er wohl die Kirchen stehen (was,
nebenbei bemerkt, eine rechte Unklugheit war);
aber ihre Penaten, antik gesprochen, ließ er
wegführen von der Stätte des Unglücks. An
die Kirchen zu rühren wagte er nicht in gläu-
bischer Furcht; aber die Götter selber raubte
16
halb nonnenhaften Morbidezza, um so mehr der
Vater von seiner Kraft und Wucht, von seiner
Barbarei, von seinem Mangel an Geschmack und
Geist, von seiner ungeschlachten aber gewaltigen
und tiefmystischen Phantasie. So wurde der
lombardische Stil — siehe Pavia — und aus ihm
erwuchs in Deutschland der „romanische“.
Le style saxon nennen ihn die Franzosen, die
manchmal eine feine Nase haben.
Dieser Stil hat schon noch eine ferne Ver-
wandtschaft mit dem römischen; er verhält sich
eben dazu wie der Horizont einer deutschen
Bischofsstadt zu dem Horizonte Roms im wört-
lichen und bildlichen Sinn des Wortes. Er hat
keine römisch-griechische, aber er hat seine
eigentümliche Schönheit, und an Stätten einer
verhältnismäßigen Kultur, wie z. B. in Köln,
dem „deutschen Rom“, hat er es sogar in der
Apostelkirche und Maria im Kapitol zu einer
gewissen — wenn man die beiden Wörter zu-
sammenstellen darf — schwerfälligen Grazie
gebracht. In anderen Fällen beruht seine Schön-
heit gerade in seinen großartigen Zügen einer
ungebändigten Barbarei. Wenn wir auf dem
Rhein gen Worms fahren, glauben wir ohne
weiteres an die Nibelungen, aber nur weil sein
Dom so wuchtig, so schwarz, so barbarisch echt
in die Lüfte ragt.
Und hier in Breisach? Nein, die Schönheit
hat hier nicht Pate gestanden. Das ist äußer-
lich ein Steinkoloß mit stumpfen Profilen, und
innerlich ist kein Raum. Alle Denkmäler dieses
Stils sind als Raumschöpfungen betrachtet er-
bärmlich. Sogar der höhere germanische Stil,
der gotische, spricht nur von gering entwickeltem
Raumgefühl. Auch die höchststehenden franzö-
sischen Kathedralen wirken bei aller über-
wältigenden Größe nicht durch den Raum und
seine Verhältnisse, sondern nur durch die male-
rische Mannigfaltigkeit und Vielgestaltigkeit der
Grenzen des Raumes, d. h. ihr Zauber ist von
einer Art, die mehr mit dem Reiz von Licht
und Schatten, als dem Raum an sich zusammen-
hängt. Von den gotischen Schöpfungen auf
deutscher Seite gilt dies noch in höherem Maße.
Wie eng und gedrückt wirkt der sonst so zauber-
hafte Freiburger Münster — aber sein Zauber
ist Licht- und Farbenzauber —, und wie gering-
fügig ist — ich bitte um Verzeihung — der
Raum des Kölner Doms im Vergleich zum Um-
fang und der Zahl seiner Pfeiler. Wenn man
vom Dom zu Pisa kommt, der romanisch ist,
oder von den Domen zu Siena und Orvieto, die
sich zur Gotik bekennen, da fühlt man daheim
erst das Gedrückte. Hoch ist das ja, aber eng.
Es ist wie italienischer und deutscher Himmel.
Nein, raumschöpferisch im italienischen Sinn
des Wortes ist keiner der deutschen Stile; aber
dieser Münster zu Breisach hat überhaupt keinen
Raum. Das ist nichts als Mauer. Das ist ein
Mittelding zwischen Keller und Kasematte.
Viel mehr, das wirkt wie ein Grab, wie eine
Gruft. Wenigstens im romanischen Langhaus.
Höher und lichter ist der gotische Chor. Aber
der wirkt fürs Ganze nicht mit, weil er durch
einen Lettner undurchdringlich davon abge-
schlossen ist.
Dieser Lettner in spätgotischer Arbeit ist
sehr interessant. Er hat auch wenig seines-
gleichen. Ich erinnere mich, ihn nur in einer
Kirche noch ähnlich gesehen zu haben, zufälliger-
weise auch in einem St. Stephan, nämlich in
Saint Etienne auf dem Mont Sainte Genevieve
zu Paris.
Im Chor zu Breisach ist der Hochaltar be-
merkenswert. Es ist eine reiche Holzschnitzerei,
die Krönung Mariä darstellend. Das krause
aber phantasievolle Werk scheint einen genialen
Autodidakten zum Urheber zu haben, der, tradi-
tionslos, ganz auf seine eigene Eingebung und
Erfindung angewiesen war. Die Inspiration dazu
hat er sich wohl im Münster zu Freiburg ge-
holt. Das geniale Altarwerk des Hans Baidung
im dortigen Chor mags dem Schreiner, oder
was er sonst für ein Holzarbeiter war, in dem
ein heimlicher Künstler steckte, angetan haben,
daß er sich daran machte, die bewunderte
Malerei in ein Schnitzwerk zu übertragen. So
ist ein ganz persönliches Werk entstanden, das
nicht seinesgleichen hat, das befremdend wirkt
und vor dessen etwas barbarischer Originalität
uns ein Gefühl überkommt, das aus Rührung
und Bewunderung gemischt ist. Im Werke
selber steht eine wilde Phantastik neben Zügen
zartester Empfindung. Man ist da weit weg
von dem ausgesprochenen Stil und der sicheren
Kunst eines Tilman Riemenschneider, aber auch
weit weg von aller Konvention und Schablone,
und man steht vor etwas sehr Seltenem, vor
dem religiösen Traum einer einsamen, in „Hand-
werks- und Gewerbebanden“ gefesselten Künstler-
seele.
Insofern sagt uns dieser Altar von nacktem
Lindenholz, so dilettantisch er sein mag, mehr
vom inneren Wesen der Kunst und des Künstlers,
als der weltberühmte goldene Reliquienschrein
in der Sakristei, den ich mir natürlich auch
zeigen ließ und der uns eigentlich nur von den
Wundern einer traditionsreichen Technik be-
richtet, wo der übernommene Stil und Geschmack
alles, das Persönliche des Künstlers wenig be-
deuten.
Der Schrein enthält die Gebeine der Märtyrer-
brüder Gervasius und Prothasius. Sie stammen,
wie die heiligen drei Könige zu Köln, aus Mai-
land. Als der ergrimmte Rotbart die Stadt zer-
störte, ließ er wohl die Kirchen stehen (was,
nebenbei bemerkt, eine rechte Unklugheit war);
aber ihre Penaten, antik gesprochen, ließ er
wegführen von der Stätte des Unglücks. An
die Kirchen zu rühren wagte er nicht in gläu-
bischer Furcht; aber die Götter selber raubte
16