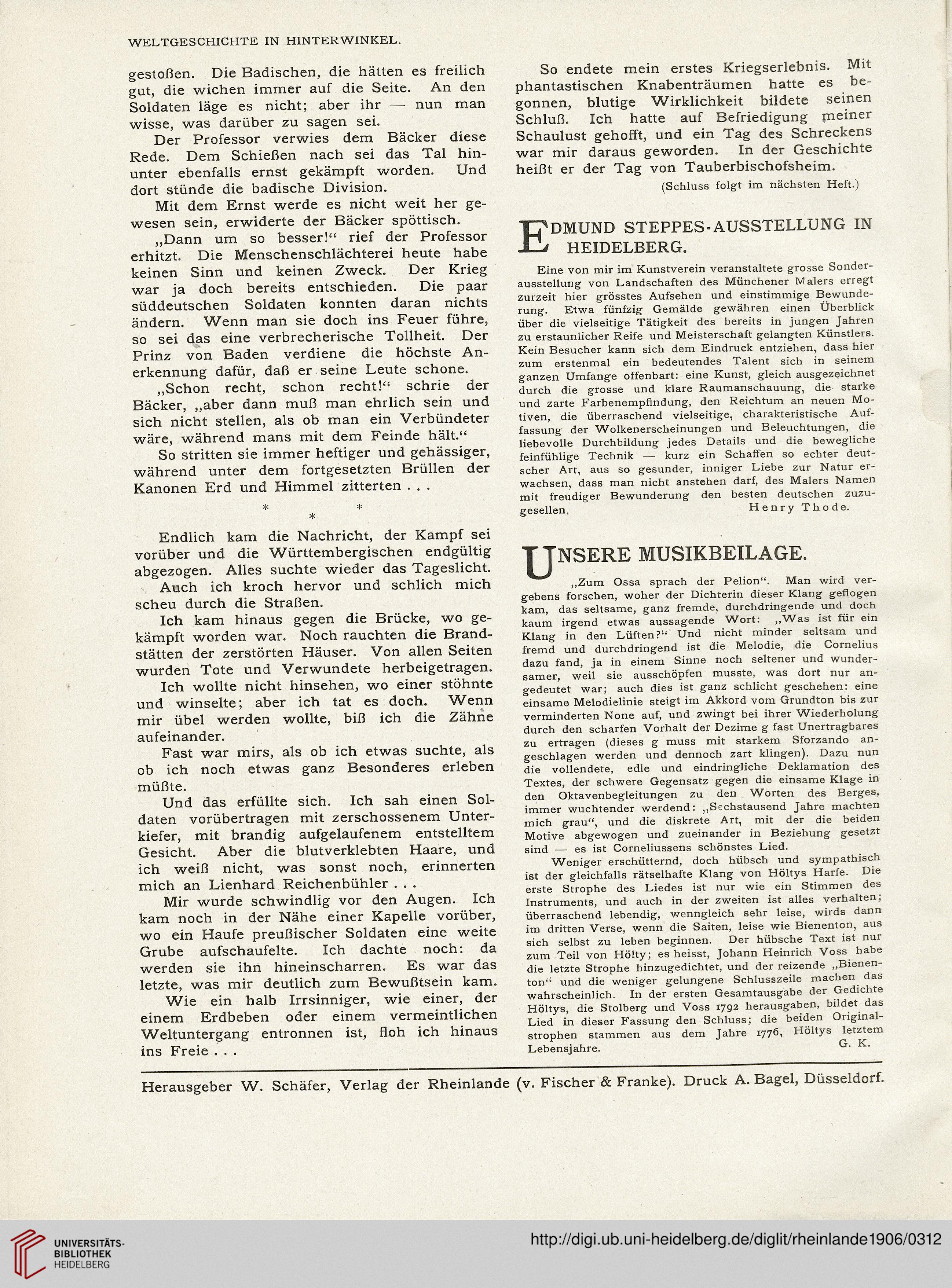WELTGESCHICHTE IN HINTERWINKEL.
gestoßen. Die Badischen, die hätten es freilich
gut, die wichen immer auf die Seite. An den
Soldaten läge es nicht; aber ihr — nun man
wisse, was darüber zu sagen sei.
Der Professor verwies dem Bäcker diese
Rede. Dem Schießen nach sei das Tal hin-
unter ebenfalls ernst gekämpft worden. Und
dort stünde die badische Division.
Mit dem Ernst werde es nicht weit her ge-
wesen sein, erwiderte der Bäcker spöttisch.
„Dann um so besser!“ rief der Professor
erhitzt. Die Menschenschlächterei heute habe
keinen Sinn und keinen Zweck. Der Krieg
war ja doch bereits entschieden. Die paar
süddeutschen Soldaten konnten daran nichts
ändern. Wenn man sie doch ins Feuer führe,
so sei das eine verbrecherische Tollheit. Der
Prinz von Baden verdiene die höchste An-
erkennung dafür, daß er seine Leute schone.
„Schon recht, schon recht!“ schrie der
Bäcker, „aber dann muß man ehrlich sein und
sich nicht stellen, als ob man ein Verbündeter
wäre, während mans mit dem Feinde hält.“
So stritten sie immer heftiger und gehässiger,
während unter dem fortgesetzten Brüllen der
Kanonen Erd und Himmel zitterten . . .
* *
*
Endlich kam die Nachricht, der Kampf sei
vorüber und die Württembergischen endgültig
abgezogen. Alles suchte wieder das Tageslicht.
Auch ich kroch hervor und schlich mich
scheu durch die Straßen.
Ich kam hinaus gegen die Brücke, wo ge-
kämpft worden war. Noch rauchten die Brand-
stätten der zerstörten Häuser. Von allen Seiten
wurden Tote und Verwundete herbeigetragen.
Ich wollte nicht hinsehen, wo einer stöhnte
und winselte; aber ich tat es doch. Wenn
mir übel werden wollte, biß ich die Zähne
aufeinander.
Fast war mirs, als ob ich etwas suchte, als
ob ich noch etwas ganz Besonderes erleben
müßte.
Und das erfüllte sich. Ich sah einen Sol-
daten vorübertragen mit zerschossenem Unter-
kiefer, mit brandig aufgelaufenem entstelltem
Gesicht. Aber die blutverklebten Haare, und
ich weiß nicht, was sonst noch, erinnerten
mich an Lienhard Reichenbühler . . .
Mir wurde schwindlig vor den Augen. Ich
kam noch in der Nähe einer Kapelle vorüber,
wo ein Haufe preußischer Soldaten eine weite
Grube aufschaufelte. Ich dachte noch: da
werden sie ihn hineinscharren. Es war das
letzte, was mir deutlich zum Bewußtsein kam.
Wie ein halb Irrsinniger, wie einer, der
einem Erdbeben oder einem vermeintlichen
Weltuntergang entronnen ist, floh ich hinaus
ins Freie . . .
So endete mein erstes Kriegserlebnis. Mit
phantastischen Knabenträumen hatte es be-
gonnen, blutige Wirklichkeit bildete seinen
Schluß. Ich hatte auf Befriedigung meiner
Schaulust gehofft, und ein Tag des Schreckens
war mir daraus geworden. In der Geschichte
heißt er der Tag von Tauberbischofsheim.
(Schluss folgt im nächsten Heft.)
Edmund steppes-ausstellung in
HEIDELBERG.
Eine von mir im Kunstverein veranstaltete grosse Sonder-
ausstellung von Landschaften des Münchener Malers erregt
zurzeit hier grösstes Aufsehen und einstimmige Bewunde-
rung. Etwa fünfzig Gemälde gewähren einen Überblick
über die vielseitige Tätigkeit des bereits in jungen Jahren
zu erstaunlicher Reife und Meisterschaft gelangten Künstlers.
Kein Besucher kann sich dem Eindruck entziehen, dass hier
zum erstenmal ein bedeutendes Talent sich in seinem
ganzen Umfange offenbart: eine Kunst, gleich ausgezeichnet
durch die grosse und klare Raumanschauung, die starke
und zarte Farbenempfindung, den Reichtum an neuen Mo-
tiven, die überraschend vielseitige, charakteristische Auf-
fassung der Wolkenerscheinungen und Beleuchtungen, die
liebevolle Durchbildung jedes Details und die bewegliche
feinfühlige Technik — kurz ein Schaffen so echter deut-
scher Art, aus so gesunder, inniger Liebe zur Natur er-
wachsen, dass man nicht anstehen darf, des Malers Namen
mit freudiger Bewunderung den besten deutschen zuzu-
gesellen. Henry Thode.
LE MUSIKBEILAGE.
Ossa sprach der Pelion“. Man wird ver-
gebens forschen, woher der Dichterin dieser Klang geflogen
kam, das seltsame, ganz fremde, durchdringende und doch
kaum irgend etwas aussagende Wort: „Was ist für ein
Klang in den Lüften ?u Und nicht minder seltsam und
fremd und durchdringend ist die Melodie, die Cornelius
dazu fand, ja in einem Sinne noch seltener und wunder-
samer, weil sie ausschöpfen musste, was dort nur an-
gedeutet war; auch dies ist ganz schlicht geschehen: eine
einsame Melodielinie steigt im Akkord vom Grundton bis zur
verminderten None auf, und zwingt bei ihrer Wiederholung
durch den scharfen Vorhalt der Dezime g fast Unertragbares
zu ertragen (dieses g muss mit starkem Sforzando an-
geschlagen werden und dennoch zart klingen). Dazu nun
die vollendete, edle und eindringliche Deklamation des
Textes, der schwere Gegensatz gegen die einsame Klage in
den Oktavenbegleitungen zu den Worten des Berges,
immer wuchtender werdend: ^Sechstausend Jahre machten
mich grau“, und die diskrete Art, mit der die beiden
Motive abgewogen und zueinander in Beziehung gesetzt
sind — es ist Corneliussens schönstes Lied.
Weniger erschütternd, doch hübsch und sympathisch
ist der gleichfalls rätselhafte Klang von Höltys Harfe. Die
erste Strophe des Liedes ist nur wie ein Stimmen des
Instruments, und auch in der zweiten ist alles verhalten;
überraschend lebendig, wenngleich sehr leise, wirds dann
im dritten Verse, wenn die Saiten, leise wie Bienenton, aus
sich selbst zu leben beginnen. Der hübsche Text ist nur
zum Teil von Hölty; es heisst, Johann Heinrich Voss habe
die letzte Strophe hinzugedichtet, und der reizende „Bienen-
ton“ und die weniger gelungene Schlusszeile machen das
wahrscheinlich. In der ersten Gesamtausgabe der Gedichte
Höltys, die Stolberg und Voss 1792 herausgaben, bildet das
Lied in dieser Fassung den Schluss; die beiden Original-
strophen stammen aus dem Jahre 1776, Höltys letztem
Lebensjahre. G. K.
Herausgeber W. Schäfer, Verlag der Rheinlande (v. Fischer & Franke). Druck A. Bagel, Düsseldorf.
gestoßen. Die Badischen, die hätten es freilich
gut, die wichen immer auf die Seite. An den
Soldaten läge es nicht; aber ihr — nun man
wisse, was darüber zu sagen sei.
Der Professor verwies dem Bäcker diese
Rede. Dem Schießen nach sei das Tal hin-
unter ebenfalls ernst gekämpft worden. Und
dort stünde die badische Division.
Mit dem Ernst werde es nicht weit her ge-
wesen sein, erwiderte der Bäcker spöttisch.
„Dann um so besser!“ rief der Professor
erhitzt. Die Menschenschlächterei heute habe
keinen Sinn und keinen Zweck. Der Krieg
war ja doch bereits entschieden. Die paar
süddeutschen Soldaten konnten daran nichts
ändern. Wenn man sie doch ins Feuer führe,
so sei das eine verbrecherische Tollheit. Der
Prinz von Baden verdiene die höchste An-
erkennung dafür, daß er seine Leute schone.
„Schon recht, schon recht!“ schrie der
Bäcker, „aber dann muß man ehrlich sein und
sich nicht stellen, als ob man ein Verbündeter
wäre, während mans mit dem Feinde hält.“
So stritten sie immer heftiger und gehässiger,
während unter dem fortgesetzten Brüllen der
Kanonen Erd und Himmel zitterten . . .
* *
*
Endlich kam die Nachricht, der Kampf sei
vorüber und die Württembergischen endgültig
abgezogen. Alles suchte wieder das Tageslicht.
Auch ich kroch hervor und schlich mich
scheu durch die Straßen.
Ich kam hinaus gegen die Brücke, wo ge-
kämpft worden war. Noch rauchten die Brand-
stätten der zerstörten Häuser. Von allen Seiten
wurden Tote und Verwundete herbeigetragen.
Ich wollte nicht hinsehen, wo einer stöhnte
und winselte; aber ich tat es doch. Wenn
mir übel werden wollte, biß ich die Zähne
aufeinander.
Fast war mirs, als ob ich etwas suchte, als
ob ich noch etwas ganz Besonderes erleben
müßte.
Und das erfüllte sich. Ich sah einen Sol-
daten vorübertragen mit zerschossenem Unter-
kiefer, mit brandig aufgelaufenem entstelltem
Gesicht. Aber die blutverklebten Haare, und
ich weiß nicht, was sonst noch, erinnerten
mich an Lienhard Reichenbühler . . .
Mir wurde schwindlig vor den Augen. Ich
kam noch in der Nähe einer Kapelle vorüber,
wo ein Haufe preußischer Soldaten eine weite
Grube aufschaufelte. Ich dachte noch: da
werden sie ihn hineinscharren. Es war das
letzte, was mir deutlich zum Bewußtsein kam.
Wie ein halb Irrsinniger, wie einer, der
einem Erdbeben oder einem vermeintlichen
Weltuntergang entronnen ist, floh ich hinaus
ins Freie . . .
So endete mein erstes Kriegserlebnis. Mit
phantastischen Knabenträumen hatte es be-
gonnen, blutige Wirklichkeit bildete seinen
Schluß. Ich hatte auf Befriedigung meiner
Schaulust gehofft, und ein Tag des Schreckens
war mir daraus geworden. In der Geschichte
heißt er der Tag von Tauberbischofsheim.
(Schluss folgt im nächsten Heft.)
Edmund steppes-ausstellung in
HEIDELBERG.
Eine von mir im Kunstverein veranstaltete grosse Sonder-
ausstellung von Landschaften des Münchener Malers erregt
zurzeit hier grösstes Aufsehen und einstimmige Bewunde-
rung. Etwa fünfzig Gemälde gewähren einen Überblick
über die vielseitige Tätigkeit des bereits in jungen Jahren
zu erstaunlicher Reife und Meisterschaft gelangten Künstlers.
Kein Besucher kann sich dem Eindruck entziehen, dass hier
zum erstenmal ein bedeutendes Talent sich in seinem
ganzen Umfange offenbart: eine Kunst, gleich ausgezeichnet
durch die grosse und klare Raumanschauung, die starke
und zarte Farbenempfindung, den Reichtum an neuen Mo-
tiven, die überraschend vielseitige, charakteristische Auf-
fassung der Wolkenerscheinungen und Beleuchtungen, die
liebevolle Durchbildung jedes Details und die bewegliche
feinfühlige Technik — kurz ein Schaffen so echter deut-
scher Art, aus so gesunder, inniger Liebe zur Natur er-
wachsen, dass man nicht anstehen darf, des Malers Namen
mit freudiger Bewunderung den besten deutschen zuzu-
gesellen. Henry Thode.
LE MUSIKBEILAGE.
Ossa sprach der Pelion“. Man wird ver-
gebens forschen, woher der Dichterin dieser Klang geflogen
kam, das seltsame, ganz fremde, durchdringende und doch
kaum irgend etwas aussagende Wort: „Was ist für ein
Klang in den Lüften ?u Und nicht minder seltsam und
fremd und durchdringend ist die Melodie, die Cornelius
dazu fand, ja in einem Sinne noch seltener und wunder-
samer, weil sie ausschöpfen musste, was dort nur an-
gedeutet war; auch dies ist ganz schlicht geschehen: eine
einsame Melodielinie steigt im Akkord vom Grundton bis zur
verminderten None auf, und zwingt bei ihrer Wiederholung
durch den scharfen Vorhalt der Dezime g fast Unertragbares
zu ertragen (dieses g muss mit starkem Sforzando an-
geschlagen werden und dennoch zart klingen). Dazu nun
die vollendete, edle und eindringliche Deklamation des
Textes, der schwere Gegensatz gegen die einsame Klage in
den Oktavenbegleitungen zu den Worten des Berges,
immer wuchtender werdend: ^Sechstausend Jahre machten
mich grau“, und die diskrete Art, mit der die beiden
Motive abgewogen und zueinander in Beziehung gesetzt
sind — es ist Corneliussens schönstes Lied.
Weniger erschütternd, doch hübsch und sympathisch
ist der gleichfalls rätselhafte Klang von Höltys Harfe. Die
erste Strophe des Liedes ist nur wie ein Stimmen des
Instruments, und auch in der zweiten ist alles verhalten;
überraschend lebendig, wenngleich sehr leise, wirds dann
im dritten Verse, wenn die Saiten, leise wie Bienenton, aus
sich selbst zu leben beginnen. Der hübsche Text ist nur
zum Teil von Hölty; es heisst, Johann Heinrich Voss habe
die letzte Strophe hinzugedichtet, und der reizende „Bienen-
ton“ und die weniger gelungene Schlusszeile machen das
wahrscheinlich. In der ersten Gesamtausgabe der Gedichte
Höltys, die Stolberg und Voss 1792 herausgaben, bildet das
Lied in dieser Fassung den Schluss; die beiden Original-
strophen stammen aus dem Jahre 1776, Höltys letztem
Lebensjahre. G. K.
Herausgeber W. Schäfer, Verlag der Rheinlande (v. Fischer & Franke). Druck A. Bagel, Düsseldorf.