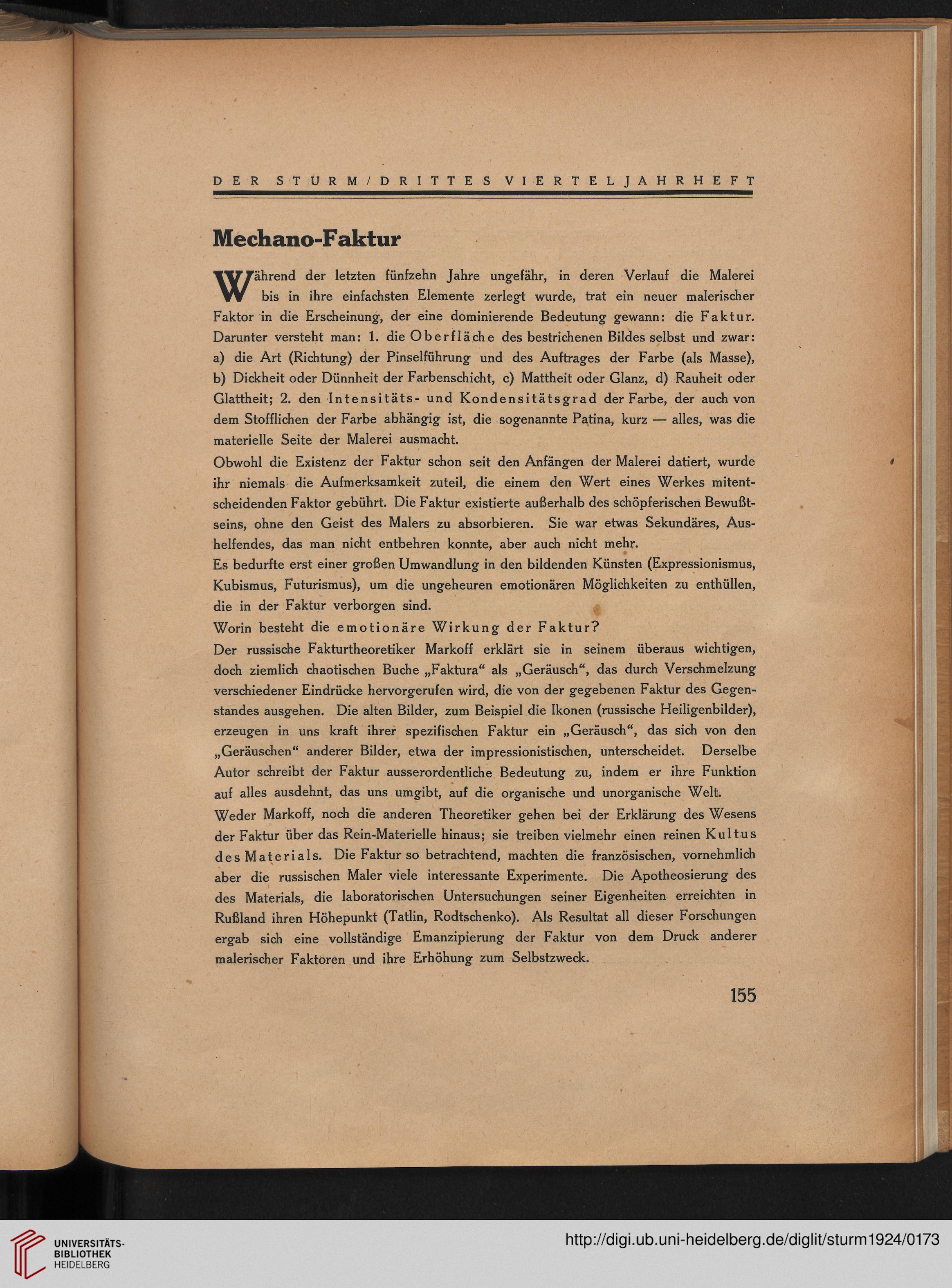DER STURM/DRITTES VIERTELJAHRHEFT
Mechano-Faktur
Während der letzten fünfzehn Jahre ungefähr, in deren Verlauf die Malerei
bis in ihre einfachsten Elemente zerlegt wurde, trat ein neuer malerischer
Faktor in die Erscheinung, der eine dominierende Bedeutung gewann: die Faktur.
Darunter versteht man: 1. die Oberfläche des bestrichenen Bildes selbst und zwar:
a) die Art (Richtung) der Pinselführung und des Auftrages der Farbe (als Masse),
b) Dickheit oder Dünnheit der Farbenschicht, c) Mattheit oder Glanz, d) Rauheit oder
Glattheit; 2. den Intensitäts- und Kondensitätsgrad der Farbe, der auch von
dem Stofflichen der Farbe abhängig ist, die sogenannte Patina, kurz — alles, was die
materielle Seite der Malerei ausmacht.
Obwohl die Existenz der Faktur schon seit den Anfängen der Malerei datiert, wurde
ihr niemals die Aufmerksamkeit zuteil, die einem den Wert eines Werkes mitent-
scheidenden Faktor gebührt. Die Faktur existierte außerhalb des schöpferischen Bewußt-
seins, ohne den Geist des Malers zu absorbieren. Sie war etwas Sekundäres, Aus-
helfendes, das man nicht entbehren konnte, aber auch nicht mehr.
Es bedurfte erst einer großen Umwandlung in den bildenden Künsten (Expressionismus,
Kubismus, Futurismus), um die ungeheuren emotionären Möglichkeiten zu enthüllen,
die in der Faktur verborgen sind.
Worin besteht die emotionäre Wirkung der Faktur?
Der russische Fakturtheoretiker Markoff erklärt sie in seinem überaus wichtigen,
doch ziemlich chaotischen Buche „Faktura“ als „Geräusch“, das durch Verschmelzung
verschiedener Eindrücke hervorgerufen wird, die von der gegebenen Faktur des Gegen-
standes ausgehen. Die alten Bilder, zum Beispiel die Ikonen (russische Heiligenbilder),
erzeugen in uns kraft ihrer spezifischen Faktur ein „Geräusch“, das sich von den
„Geräuschen“ anderer Bilder, etwa der impressionistischen, unterscheidet. Derselbe
Autor schreibt der Faktur ausserordentliche Bedeutung zu, indem er ihre Funktion
auf alles ausdehnt, das uns umgibt, auf die organische und unorganische Welt.
Weder Markoff, noch die anderen Theoretiker gehen bei der Erklärung des Wesens
der Faktur über das Rein-Materielle hinaus; sie treiben vielmehr einen reinen Kultus
des Materials. Die Faktur so betrachtend, machten die französischen, vornehmlich
aber die russischen Maler viele interessante Experimente. Die Apotheosierung des
des Materials, die laboratorischen Untersuchungen seiner Eigenheiten erreichten in
Rußland ihren Höhepunkt (Tatlin, Rodtschenko). Als Resultat all dieser Forschungen
ergab sich eine vollständige Emanzipierung der Faktur von dem Druck anderer
malerischer Faktoren und ihre Erhöhung zum Selbstzweck.
155
Mechano-Faktur
Während der letzten fünfzehn Jahre ungefähr, in deren Verlauf die Malerei
bis in ihre einfachsten Elemente zerlegt wurde, trat ein neuer malerischer
Faktor in die Erscheinung, der eine dominierende Bedeutung gewann: die Faktur.
Darunter versteht man: 1. die Oberfläche des bestrichenen Bildes selbst und zwar:
a) die Art (Richtung) der Pinselführung und des Auftrages der Farbe (als Masse),
b) Dickheit oder Dünnheit der Farbenschicht, c) Mattheit oder Glanz, d) Rauheit oder
Glattheit; 2. den Intensitäts- und Kondensitätsgrad der Farbe, der auch von
dem Stofflichen der Farbe abhängig ist, die sogenannte Patina, kurz — alles, was die
materielle Seite der Malerei ausmacht.
Obwohl die Existenz der Faktur schon seit den Anfängen der Malerei datiert, wurde
ihr niemals die Aufmerksamkeit zuteil, die einem den Wert eines Werkes mitent-
scheidenden Faktor gebührt. Die Faktur existierte außerhalb des schöpferischen Bewußt-
seins, ohne den Geist des Malers zu absorbieren. Sie war etwas Sekundäres, Aus-
helfendes, das man nicht entbehren konnte, aber auch nicht mehr.
Es bedurfte erst einer großen Umwandlung in den bildenden Künsten (Expressionismus,
Kubismus, Futurismus), um die ungeheuren emotionären Möglichkeiten zu enthüllen,
die in der Faktur verborgen sind.
Worin besteht die emotionäre Wirkung der Faktur?
Der russische Fakturtheoretiker Markoff erklärt sie in seinem überaus wichtigen,
doch ziemlich chaotischen Buche „Faktura“ als „Geräusch“, das durch Verschmelzung
verschiedener Eindrücke hervorgerufen wird, die von der gegebenen Faktur des Gegen-
standes ausgehen. Die alten Bilder, zum Beispiel die Ikonen (russische Heiligenbilder),
erzeugen in uns kraft ihrer spezifischen Faktur ein „Geräusch“, das sich von den
„Geräuschen“ anderer Bilder, etwa der impressionistischen, unterscheidet. Derselbe
Autor schreibt der Faktur ausserordentliche Bedeutung zu, indem er ihre Funktion
auf alles ausdehnt, das uns umgibt, auf die organische und unorganische Welt.
Weder Markoff, noch die anderen Theoretiker gehen bei der Erklärung des Wesens
der Faktur über das Rein-Materielle hinaus; sie treiben vielmehr einen reinen Kultus
des Materials. Die Faktur so betrachtend, machten die französischen, vornehmlich
aber die russischen Maler viele interessante Experimente. Die Apotheosierung des
des Materials, die laboratorischen Untersuchungen seiner Eigenheiten erreichten in
Rußland ihren Höhepunkt (Tatlin, Rodtschenko). Als Resultat all dieser Forschungen
ergab sich eine vollständige Emanzipierung der Faktur von dem Druck anderer
malerischer Faktoren und ihre Erhöhung zum Selbstzweck.
155