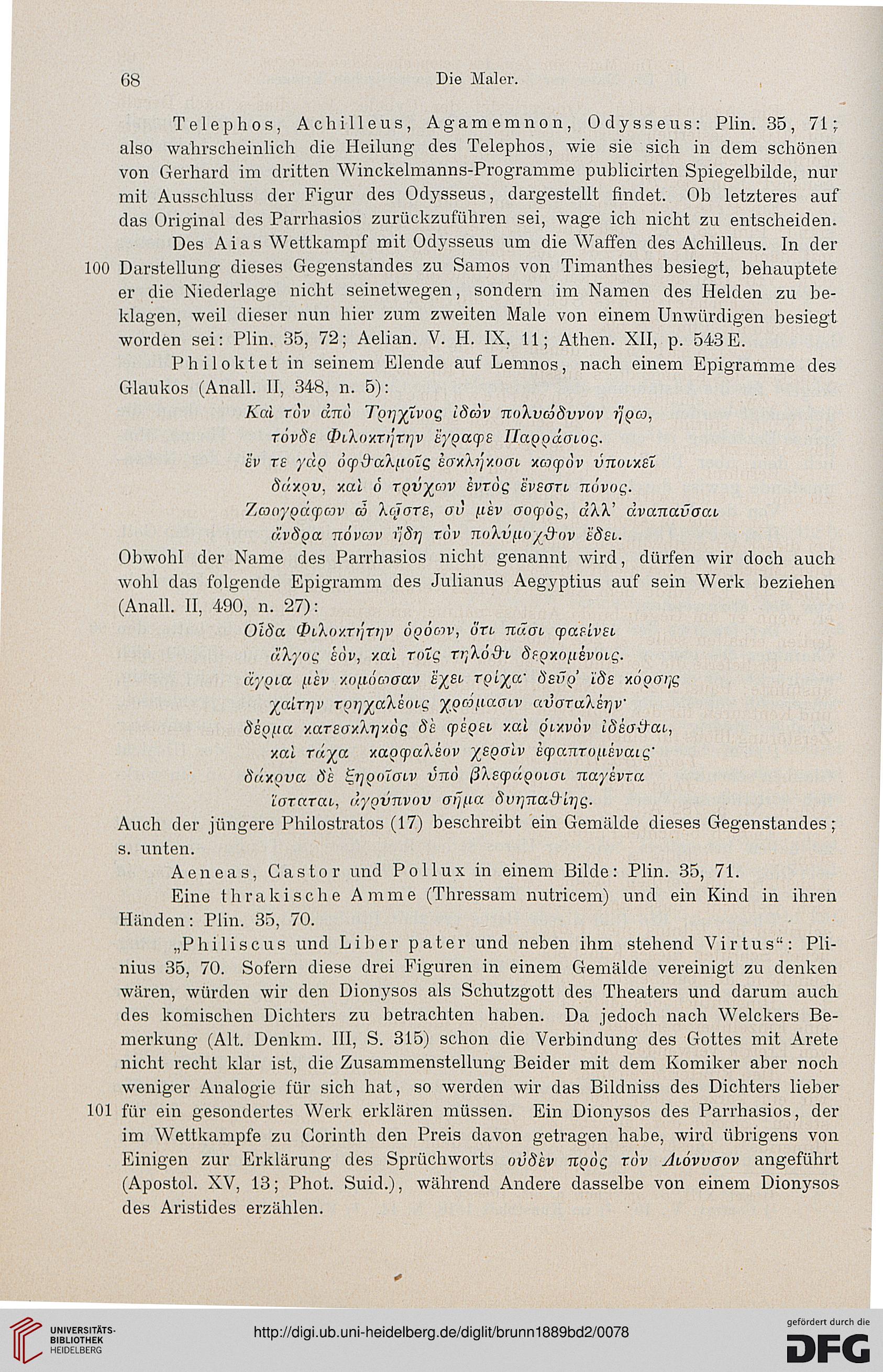Iis
Die Maler.
Telephos, Achilleus, Agamemnon, 0 dysseus: Plin. 35, 71;
also wahrscheinlich die Heilung des Telephos, wie sie sich in dem schönen
von Gerhard im dritten Winckelmanns-Programme publicirten Spiegelbilde, nur
mit Ausschluss der Figur des Odysseus, dargestellt findet. Ob letzteres auf
das Original des Parrhasios zurückzuführen sei, wage ich nicht zu entscheiden.
Des Aias Wettkampf mit Odysseus um die Waffen des Achilleus. In der
100 Darstellung dieses Gegenstandes zu Samos von Timanthes besiegt, behauptete
er die Niederlage nicht seinetwegen, sondern im Namen des Helden zu be-
klagen, weil dieser nun hier zum zweiten Male von einem Unwürdigen besiegt
worden sei: Plin. 35, 72; Aelian. V. H. IX, 11; Athen. XII, p. 543E.
Philoktet in seinem Elende auf Lemnos, nach einem Epigramme des
Glaukos (Anall. II, 348, n. 5):
Kai tov dnd TQTjyXvoc, iScav no\va8vvov rjQco,
r6v8s 'IhXoy.Ti]ri]v b/Qacps TlaQoiaujQ.
ev ts y&q depd ak\.unc, soxhi'y/.om. xcocpdv vnoiY.ü
8(>.yov, xal 6 rQvyciv svrdg svsari uövoQ.
Zcoo-ypacpav w Xojots, au (iev aoepog, dW dvanavaau
avSga novav vdrj tov noXv^uryd-ov Höst.
Obwohl der Name des Parrhasios nicht genannt wird, dürfen wir doch auch
wohl das folgende Epigramm des Julianus Aegyptius auf sein Werk beziehen
(Anall. II, 490, n. 27):
Ol8a i>i\oy.Ti']Ti]v 6q6o)v, oxi näat tpasivsi
a'kyoc, edv, y.ai ring rr^oßu 8fpxofievfng.
ä'/Qia (iev -/.oßoiyiaav s%ei rolyv; ösvg' 18s xooarfi
'/c&Tt)v T')i]-/a%e(iiQ ■/oäfiaaiv avaraXsT]V
8sg[ia y.aTsay.'krjy.cis äs epsgst, xal p'txvciv iöecri/m,
ml rüya. xaocpaKsov X£Qa'LV ^(pccntOjiByaig'
ody.gva 8's Ei]Q<n0iv und ßXeq>a.Q0t.oi naysvra
iornreu, uynvnvov oijßa 8vi]nadh]q.
Auch der jüngere Philostratos (17) beschreibt ein Gemälde dieses Gegenstandes;
s. unten.
Aeneas, Castor und Pollux in einem Bilde: Plin. 35, 71.
Eine thrakische Amme (Thressam nutricem) und ein Kind in ihren
Händen: Plin. 35, 70.
„Philiscus und Li her pater und neben ihm stehend Virtus": Pli-
nius 35, 70. Sofern diese drei Figuren in einem Gemälde vereinigt zu denken
wären, würden wir den Dionysos als Schutzgott des Theaters und darum auch
des komischen Dichters zu betrachten haben. Da jedoch nach Welckers Be-
merkung (Alt. Denkm. III, S. 315) schon die Verbindung des Gottes mit Arete
nicht recht klar ist, die Zusammenstellung Beider mit dem Komiker aber noch
weniger Analogie für sich hat, so werden wir das Bildniss des Dichters lieber
101 für ein gesondertes Werk erklären müssen. Ein Dionysos des Parrhasios, der
im Wettkampfe zu Gorinth den Preis davon getragen habe, wird übrigens von
Einigen zur Erklärung des Sprüchworts oüStv nooQ tov Atdvvaov angeführt
(Apostol. XV, 13; Phot. Suid.), während Andere dasselbe von einem Dionysos
des Aristides erzählen.
Die Maler.
Telephos, Achilleus, Agamemnon, 0 dysseus: Plin. 35, 71;
also wahrscheinlich die Heilung des Telephos, wie sie sich in dem schönen
von Gerhard im dritten Winckelmanns-Programme publicirten Spiegelbilde, nur
mit Ausschluss der Figur des Odysseus, dargestellt findet. Ob letzteres auf
das Original des Parrhasios zurückzuführen sei, wage ich nicht zu entscheiden.
Des Aias Wettkampf mit Odysseus um die Waffen des Achilleus. In der
100 Darstellung dieses Gegenstandes zu Samos von Timanthes besiegt, behauptete
er die Niederlage nicht seinetwegen, sondern im Namen des Helden zu be-
klagen, weil dieser nun hier zum zweiten Male von einem Unwürdigen besiegt
worden sei: Plin. 35, 72; Aelian. V. H. IX, 11; Athen. XII, p. 543E.
Philoktet in seinem Elende auf Lemnos, nach einem Epigramme des
Glaukos (Anall. II, 348, n. 5):
Kai tov dnd TQTjyXvoc, iScav no\va8vvov rjQco,
r6v8s 'IhXoy.Ti]ri]v b/Qacps TlaQoiaujQ.
ev ts y&q depd ak\.unc, soxhi'y/.om. xcocpdv vnoiY.ü
8(>.yov, xal 6 rQvyciv svrdg svsari uövoQ.
Zcoo-ypacpav w Xojots, au (iev aoepog, dW dvanavaau
avSga novav vdrj tov noXv^uryd-ov Höst.
Obwohl der Name des Parrhasios nicht genannt wird, dürfen wir doch auch
wohl das folgende Epigramm des Julianus Aegyptius auf sein Werk beziehen
(Anall. II, 490, n. 27):
Ol8a i>i\oy.Ti']Ti]v 6q6o)v, oxi näat tpasivsi
a'kyoc, edv, y.ai ring rr^oßu 8fpxofievfng.
ä'/Qia (iev -/.oßoiyiaav s%ei rolyv; ösvg' 18s xooarfi
'/c&Tt)v T')i]-/a%e(iiQ ■/oäfiaaiv avaraXsT]V
8sg[ia y.aTsay.'krjy.cis äs epsgst, xal p'txvciv iöecri/m,
ml rüya. xaocpaKsov X£Qa'LV ^(pccntOjiByaig'
ody.gva 8's Ei]Q<n0iv und ßXeq>a.Q0t.oi naysvra
iornreu, uynvnvov oijßa 8vi]nadh]q.
Auch der jüngere Philostratos (17) beschreibt ein Gemälde dieses Gegenstandes;
s. unten.
Aeneas, Castor und Pollux in einem Bilde: Plin. 35, 71.
Eine thrakische Amme (Thressam nutricem) und ein Kind in ihren
Händen: Plin. 35, 70.
„Philiscus und Li her pater und neben ihm stehend Virtus": Pli-
nius 35, 70. Sofern diese drei Figuren in einem Gemälde vereinigt zu denken
wären, würden wir den Dionysos als Schutzgott des Theaters und darum auch
des komischen Dichters zu betrachten haben. Da jedoch nach Welckers Be-
merkung (Alt. Denkm. III, S. 315) schon die Verbindung des Gottes mit Arete
nicht recht klar ist, die Zusammenstellung Beider mit dem Komiker aber noch
weniger Analogie für sich hat, so werden wir das Bildniss des Dichters lieber
101 für ein gesondertes Werk erklären müssen. Ein Dionysos des Parrhasios, der
im Wettkampfe zu Gorinth den Preis davon getragen habe, wird übrigens von
Einigen zur Erklärung des Sprüchworts oüStv nooQ tov Atdvvaov angeführt
(Apostol. XV, 13; Phot. Suid.), während Andere dasselbe von einem Dionysos
des Aristides erzählen.