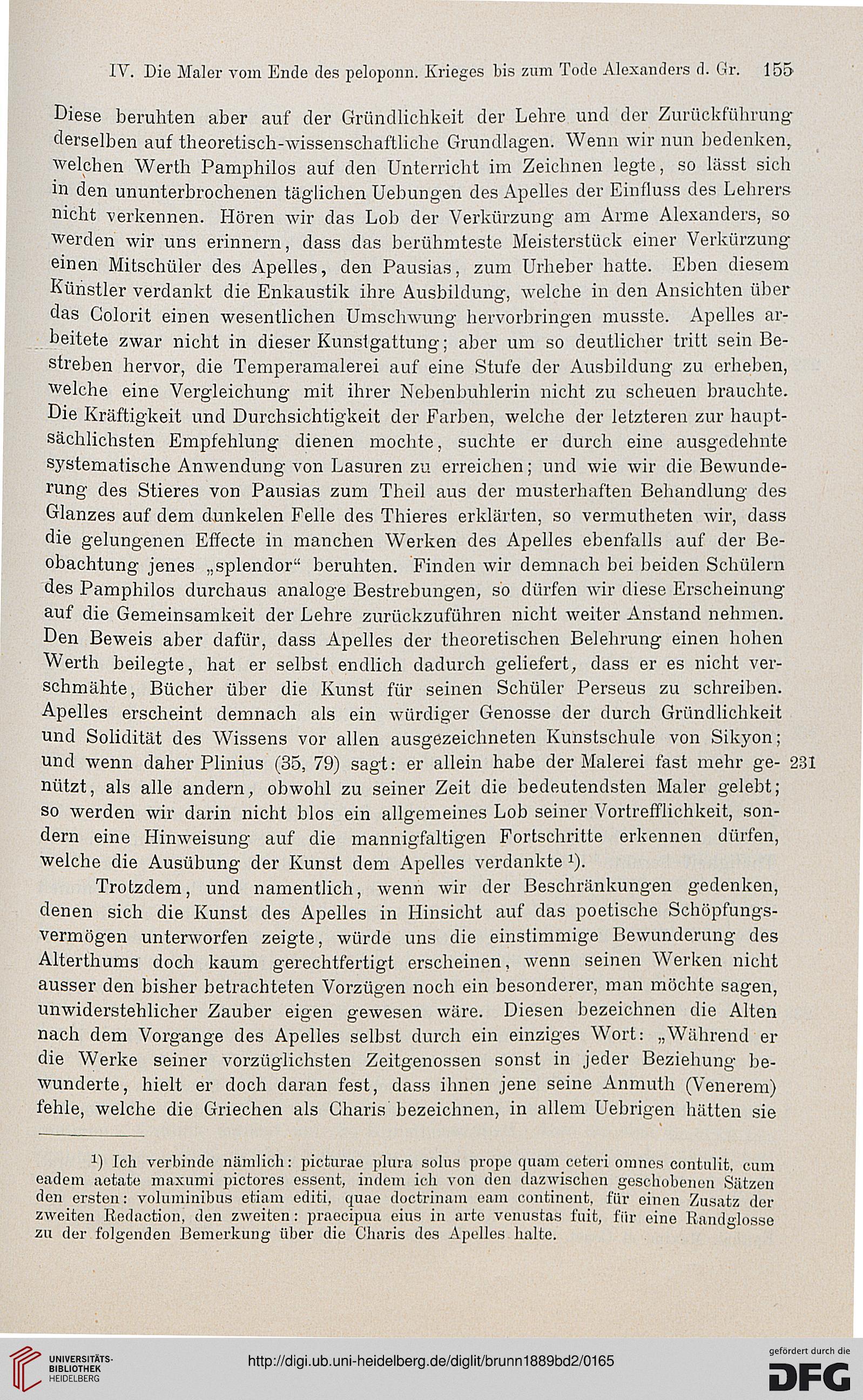IV. Die Maler vom Ende des peloponn. Krieges bis zum Tode Alexanders d. Gr. 155
Diese beruhten aber auf der Gründlichkeit der Lehre und der Zurückführung-
derselben auf theoretisch-wissenschaftliche Grundlagen. Wenn wir nun bedenken,
welchen Werth Pamphilos auf den Unterricht im Zeichnen legte, so lässt sich
in den ununterbrochenen täglichen Uebungen des Apelles der Einfluss des Lehrers
nicht verkennen. Hören wir das Lob der Verkürzung am Arme Alexanders, so
werden wir uns erinnern, dass das berühmteste Meisterstück einer Verkürzung
einen Mitschüler des Apelles, den Pausias, zum Urheber hatte. Eben diesem
Künstler verdankt die Enkaustik ihre Ausbildung, welche in den Ansichten über
das Golorit einen wesentlichen Umschwung hervorbringen musste. Apelles ar-
beitete zwar nicht in dieser Kunstgattung; aber um so deutlicher tritt sein Be-
streben hervor, die Temperamalerei auf eine Stufe der Ausbildung zu erheben,
welche eine Vergleichung mit ihrer Nebenbuhlerin nicht zu scheuen brauchte.
Die Kräftigl teit und Durchsichtigkeit der Farben, welche der letzteren zur haupt-
sächlichsten Empfehlung dienen mochte, suchte er durch eine ausgedehnte
systematische Anwendung von Lasuren zu erreichen; und wie wir die Bewunde-
rung des Stieres von Pausias zum Theil aus der musterhaften Behandlung des
Glanzes auf dem dunkelen Felle des Thieres erklärten, so vermutheten wir, dass
die gelungenen Effecte in manchen W'erken des Apelles ebenfalls auf der Be-
obachtung jenes „splendor" beruhten. Finden wir demnach bei beiden Schülern
des Pamphilos durchaus analoge Bestrebungen, so dürfen wir diese Erscheinung
auf die Gemeinsamkeit der Lehre zurückzuführen nicht weiter Anstand nehmen.
Den Beweis aber dafür, dass Apelles der theoretischen Belehrung einen hohen
Werth beilegte, hat er selbst endlich dadurch geliefert, dass er es nicht ver-
schmähte, Bücher über die Kunst für seinen Schüler Perseus zu schreiben.
Apelles erscheint demnach als ein würdiger Genosse der durch Gründlichkeit
und Solidität des Wissens vor allen ausgezeichneten Kunstschule von Sikyon;
und wenn daher Plinius (35, 79) sagt: er allein habe der Malerei fast mehr ge-
nützt, als alle andern, obwohl zu seiner Zeit die bedeutendsten Maler gelebt;
so werden wir darin nicht blos ein allgemeines Lob seiner Vortrefflichkeit, son-
dern eine Hinweisung auf die mannigfaltigen Fortschritte erkennen dürfen,
welche die Ausübung der Kunst dem Apelles verdankte
Trotzdem, und namentlich, wenn wir der Beschränkungen gedenken,
denen sich die Kunst des Apelles in Hinsicht auf das poetische Schöpfungs-
vermögen unterworfen zeigte, würde uns die einstimmige Bewunderung des
Alterthums doch kaum gerechtfertigt erscheinen, wenn seinen Werken nicht
ausser den bisher betrachteten Vorzügen noch ein besonderer, man möchte sagen,
unwiderstehlicher Zauber eigen gewesen wäre. Diesen bezeichnen die Alten
nach dem Vorgange des Apelles selbst durch ein einziges Wort: „Während er
die Werke seiner vorzüglichsten Zeitgenossen sonst in jeder Beziehung be-
wunderte, hielt er doch daran fest, dass ihnen jene seine Anmuth (Venerem)
fehle, welche die Griechen als Charis bezeichnen, in allem Uebrigen hätten sie
x) Ich verbinde nämlich: picturae plura solus prope quam ceteri omnes contnlit, cum
eadem aetate maxumi pictores essent, indem ich von den dazwischen geschobenen Sätzen
den ersten: voluminibus etiam editi, quae doctrinam eam continent, für einen Zusatz der
zweiten Redaction, den zweiten: praeeipua eius in arte venustas fuit, für eine Randglosse
zu der folgenden Bemerkung über die Charis des Apelles halte.
Diese beruhten aber auf der Gründlichkeit der Lehre und der Zurückführung-
derselben auf theoretisch-wissenschaftliche Grundlagen. Wenn wir nun bedenken,
welchen Werth Pamphilos auf den Unterricht im Zeichnen legte, so lässt sich
in den ununterbrochenen täglichen Uebungen des Apelles der Einfluss des Lehrers
nicht verkennen. Hören wir das Lob der Verkürzung am Arme Alexanders, so
werden wir uns erinnern, dass das berühmteste Meisterstück einer Verkürzung
einen Mitschüler des Apelles, den Pausias, zum Urheber hatte. Eben diesem
Künstler verdankt die Enkaustik ihre Ausbildung, welche in den Ansichten über
das Golorit einen wesentlichen Umschwung hervorbringen musste. Apelles ar-
beitete zwar nicht in dieser Kunstgattung; aber um so deutlicher tritt sein Be-
streben hervor, die Temperamalerei auf eine Stufe der Ausbildung zu erheben,
welche eine Vergleichung mit ihrer Nebenbuhlerin nicht zu scheuen brauchte.
Die Kräftigl teit und Durchsichtigkeit der Farben, welche der letzteren zur haupt-
sächlichsten Empfehlung dienen mochte, suchte er durch eine ausgedehnte
systematische Anwendung von Lasuren zu erreichen; und wie wir die Bewunde-
rung des Stieres von Pausias zum Theil aus der musterhaften Behandlung des
Glanzes auf dem dunkelen Felle des Thieres erklärten, so vermutheten wir, dass
die gelungenen Effecte in manchen W'erken des Apelles ebenfalls auf der Be-
obachtung jenes „splendor" beruhten. Finden wir demnach bei beiden Schülern
des Pamphilos durchaus analoge Bestrebungen, so dürfen wir diese Erscheinung
auf die Gemeinsamkeit der Lehre zurückzuführen nicht weiter Anstand nehmen.
Den Beweis aber dafür, dass Apelles der theoretischen Belehrung einen hohen
Werth beilegte, hat er selbst endlich dadurch geliefert, dass er es nicht ver-
schmähte, Bücher über die Kunst für seinen Schüler Perseus zu schreiben.
Apelles erscheint demnach als ein würdiger Genosse der durch Gründlichkeit
und Solidität des Wissens vor allen ausgezeichneten Kunstschule von Sikyon;
und wenn daher Plinius (35, 79) sagt: er allein habe der Malerei fast mehr ge-
nützt, als alle andern, obwohl zu seiner Zeit die bedeutendsten Maler gelebt;
so werden wir darin nicht blos ein allgemeines Lob seiner Vortrefflichkeit, son-
dern eine Hinweisung auf die mannigfaltigen Fortschritte erkennen dürfen,
welche die Ausübung der Kunst dem Apelles verdankte
Trotzdem, und namentlich, wenn wir der Beschränkungen gedenken,
denen sich die Kunst des Apelles in Hinsicht auf das poetische Schöpfungs-
vermögen unterworfen zeigte, würde uns die einstimmige Bewunderung des
Alterthums doch kaum gerechtfertigt erscheinen, wenn seinen Werken nicht
ausser den bisher betrachteten Vorzügen noch ein besonderer, man möchte sagen,
unwiderstehlicher Zauber eigen gewesen wäre. Diesen bezeichnen die Alten
nach dem Vorgange des Apelles selbst durch ein einziges Wort: „Während er
die Werke seiner vorzüglichsten Zeitgenossen sonst in jeder Beziehung be-
wunderte, hielt er doch daran fest, dass ihnen jene seine Anmuth (Venerem)
fehle, welche die Griechen als Charis bezeichnen, in allem Uebrigen hätten sie
x) Ich verbinde nämlich: picturae plura solus prope quam ceteri omnes contnlit, cum
eadem aetate maxumi pictores essent, indem ich von den dazwischen geschobenen Sätzen
den ersten: voluminibus etiam editi, quae doctrinam eam continent, für einen Zusatz der
zweiten Redaction, den zweiten: praeeipua eius in arte venustas fuit, für eine Randglosse
zu der folgenden Bemerkung über die Charis des Apelles halte.