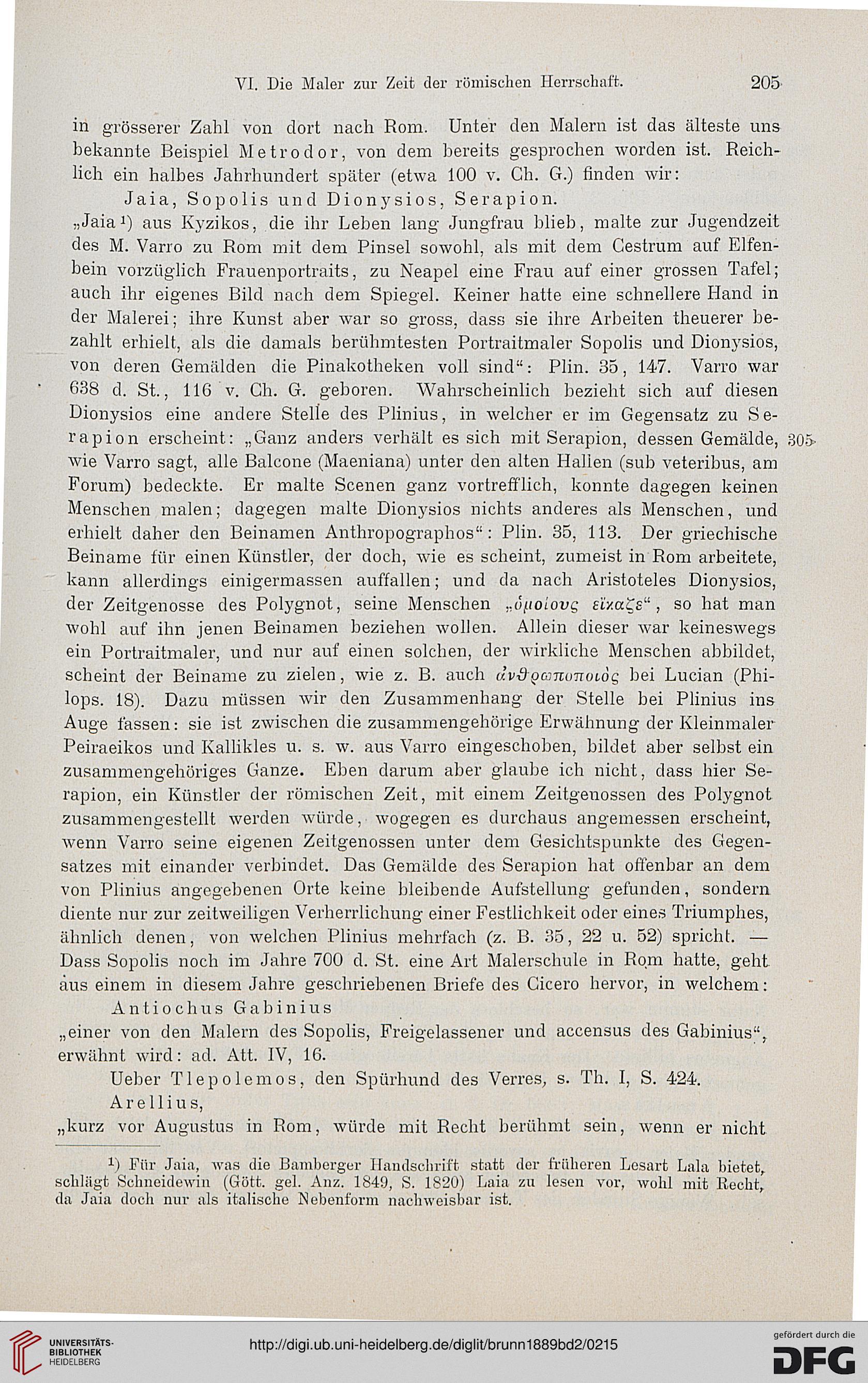VI. Die Maler zur Zeit der römischen Herrschaft.
205
in grösserer Zahl von dort nach Rom. Unter den Malern ist das älteste uns
bekannte Beispiel Metrod or, von dem bereits gesprochen worden ist. Reich-
lich ein halbes Jahrhundert später (etwa 100 v. Ch. G.) finden wir:
Jaia, Sopolis und Dionysios, Serapion.
„Jaia1) aus Kyzikos, die ihr Leben lang Jungfrau blieb, malte zur Jugendzeit
des M. Varro zu Rom mit dem Pinsel sowohl, als mit dem Oestrum auf Elfen-
bein vorzüglich Frauenportraits, zu Neapel eine Frau auf einer grossen Tafel;
auch ihr eigenes Bild nach dem Spiegel. Keiner hatte eine schnellere Hand in
der Malerei; ihre Kunst aber war so gross, dass sie ihre Arbeiten theuerer be-
zahlt erhielt, als die damals berühmtesten Portraitmaler Sopolis und Dionysios,
von deren Gemälden die Pinakotheken voll sind": Plin. 35, 147. Varro war
638 d. St., 116 v. Ch. G. geboren. Wahrscheinlich bezieht sich auf diesen
Dionysios eine andere Stelle des Plinius, in welcher er im Gegensatz zu S e-
rapion erscheint: „Ganz anders verhält es sich mit Serapion, dessen Gemälde,
wie Varro sagt, alle Balcone (Maeniana) unter den alten Hallen (sub veteribus, am
Forum) bedeckte. Er malte Scenen ganz vortrefflich, konnte dagegen keinen
Menschen malen; dagegen malte Dionysios nichts anderes als Menschen, und
erhielt daher den Beinamen Anthropographos" : Plin. 35, 113. Der griechische
Beiname für einen Künstler, der doch, wie es scheint, zumeist in Rom arbeitete,
kann allerdings einigermassen auffallen; und da nach Aristoteles Dionysios,
der Zeitgenosse des Polygnot, seine Menschen ..öfioiovg axctcs" , so hat man
wohl auf ihn jenen Beinamen beziehen wollen. Allein dieser war keineswegs
ein Portraitmaler, und nur auf einen solchen, der wirkliche Menschen abbildet,
scheint der Beiname zu zielen, wie z. B. auch ävdgamimuLÖg bei Lucian (Phi-
lops. 18). Dazu müssen wir den Zusammenhang der Stelle bei Plinius ins
Auge fassen: sie ist zwischen die zusammengehörige Erwähnung der Kleinmaler
Peiraeikos und Kallikles u. s. w. aus Varro eingeschoben, bildet aber selbst ein
zusammengehöriges Ganze. Eben darum aber glaube ich nicht, dass hier Se-
rapion, ein Künstler der römischen Zeit, mit einem Zeitgenossen des Polygnot
zusammengestellt werden würde, wogegen es durchaus angemessen erscheint,
wenn Varro seine eigenen Zeitgenossen unter dem Gesichtspunkte des Gegen-
satzes mit einander verbindet. Das Gemälde des Serapion hat offenbar an dem
von Plinius angegebenen Orte keine bleibende Aufstellung gefunden, sondern
diente nur zur zeitweiligen Verherrlichung einer Festlichkeit oder eines Triumphes,
ähnlich denen, von welchen Plinius mehrfach (z. B. 35, 22 u. 52) spricht. —
Dass Sopolis noch im Jahre 700 d. St. eine Art Malerschule in Rom hatte, geht
aus einem in diesem Jahre geschriebenen Briefe des Cicero hervor, in welchem:
Antiochus Gabinius
„einer von den Malern des Sopolis, Freigelassener und accensus des Gabinius",
erwähnt wird: ad. Att. IV, 16.
Ueber Tlepolemos, den Spürhund des Verres, s. Th. I, S. 424.
Are Iii us,
„kurz vor Augustus in Rom, würde mit Recht berühmt sein, wenn er nicht
*) Für Jaia, was die Bamberger Handschrift statt der früheren Losart Lala bietet,
schlügt Schneidewin (Gütt. gel. Anz. 1849, S. 1820) Laia zu lesen vor, wohl mit Recht,
da Jaia doch nur als italische Nebenform nachweisbar ist.
205
in grösserer Zahl von dort nach Rom. Unter den Malern ist das älteste uns
bekannte Beispiel Metrod or, von dem bereits gesprochen worden ist. Reich-
lich ein halbes Jahrhundert später (etwa 100 v. Ch. G.) finden wir:
Jaia, Sopolis und Dionysios, Serapion.
„Jaia1) aus Kyzikos, die ihr Leben lang Jungfrau blieb, malte zur Jugendzeit
des M. Varro zu Rom mit dem Pinsel sowohl, als mit dem Oestrum auf Elfen-
bein vorzüglich Frauenportraits, zu Neapel eine Frau auf einer grossen Tafel;
auch ihr eigenes Bild nach dem Spiegel. Keiner hatte eine schnellere Hand in
der Malerei; ihre Kunst aber war so gross, dass sie ihre Arbeiten theuerer be-
zahlt erhielt, als die damals berühmtesten Portraitmaler Sopolis und Dionysios,
von deren Gemälden die Pinakotheken voll sind": Plin. 35, 147. Varro war
638 d. St., 116 v. Ch. G. geboren. Wahrscheinlich bezieht sich auf diesen
Dionysios eine andere Stelle des Plinius, in welcher er im Gegensatz zu S e-
rapion erscheint: „Ganz anders verhält es sich mit Serapion, dessen Gemälde,
wie Varro sagt, alle Balcone (Maeniana) unter den alten Hallen (sub veteribus, am
Forum) bedeckte. Er malte Scenen ganz vortrefflich, konnte dagegen keinen
Menschen malen; dagegen malte Dionysios nichts anderes als Menschen, und
erhielt daher den Beinamen Anthropographos" : Plin. 35, 113. Der griechische
Beiname für einen Künstler, der doch, wie es scheint, zumeist in Rom arbeitete,
kann allerdings einigermassen auffallen; und da nach Aristoteles Dionysios,
der Zeitgenosse des Polygnot, seine Menschen ..öfioiovg axctcs" , so hat man
wohl auf ihn jenen Beinamen beziehen wollen. Allein dieser war keineswegs
ein Portraitmaler, und nur auf einen solchen, der wirkliche Menschen abbildet,
scheint der Beiname zu zielen, wie z. B. auch ävdgamimuLÖg bei Lucian (Phi-
lops. 18). Dazu müssen wir den Zusammenhang der Stelle bei Plinius ins
Auge fassen: sie ist zwischen die zusammengehörige Erwähnung der Kleinmaler
Peiraeikos und Kallikles u. s. w. aus Varro eingeschoben, bildet aber selbst ein
zusammengehöriges Ganze. Eben darum aber glaube ich nicht, dass hier Se-
rapion, ein Künstler der römischen Zeit, mit einem Zeitgenossen des Polygnot
zusammengestellt werden würde, wogegen es durchaus angemessen erscheint,
wenn Varro seine eigenen Zeitgenossen unter dem Gesichtspunkte des Gegen-
satzes mit einander verbindet. Das Gemälde des Serapion hat offenbar an dem
von Plinius angegebenen Orte keine bleibende Aufstellung gefunden, sondern
diente nur zur zeitweiligen Verherrlichung einer Festlichkeit oder eines Triumphes,
ähnlich denen, von welchen Plinius mehrfach (z. B. 35, 22 u. 52) spricht. —
Dass Sopolis noch im Jahre 700 d. St. eine Art Malerschule in Rom hatte, geht
aus einem in diesem Jahre geschriebenen Briefe des Cicero hervor, in welchem:
Antiochus Gabinius
„einer von den Malern des Sopolis, Freigelassener und accensus des Gabinius",
erwähnt wird: ad. Att. IV, 16.
Ueber Tlepolemos, den Spürhund des Verres, s. Th. I, S. 424.
Are Iii us,
„kurz vor Augustus in Rom, würde mit Recht berühmt sein, wenn er nicht
*) Für Jaia, was die Bamberger Handschrift statt der früheren Losart Lala bietet,
schlügt Schneidewin (Gütt. gel. Anz. 1849, S. 1820) Laia zu lesen vor, wohl mit Recht,
da Jaia doch nur als italische Nebenform nachweisbar ist.