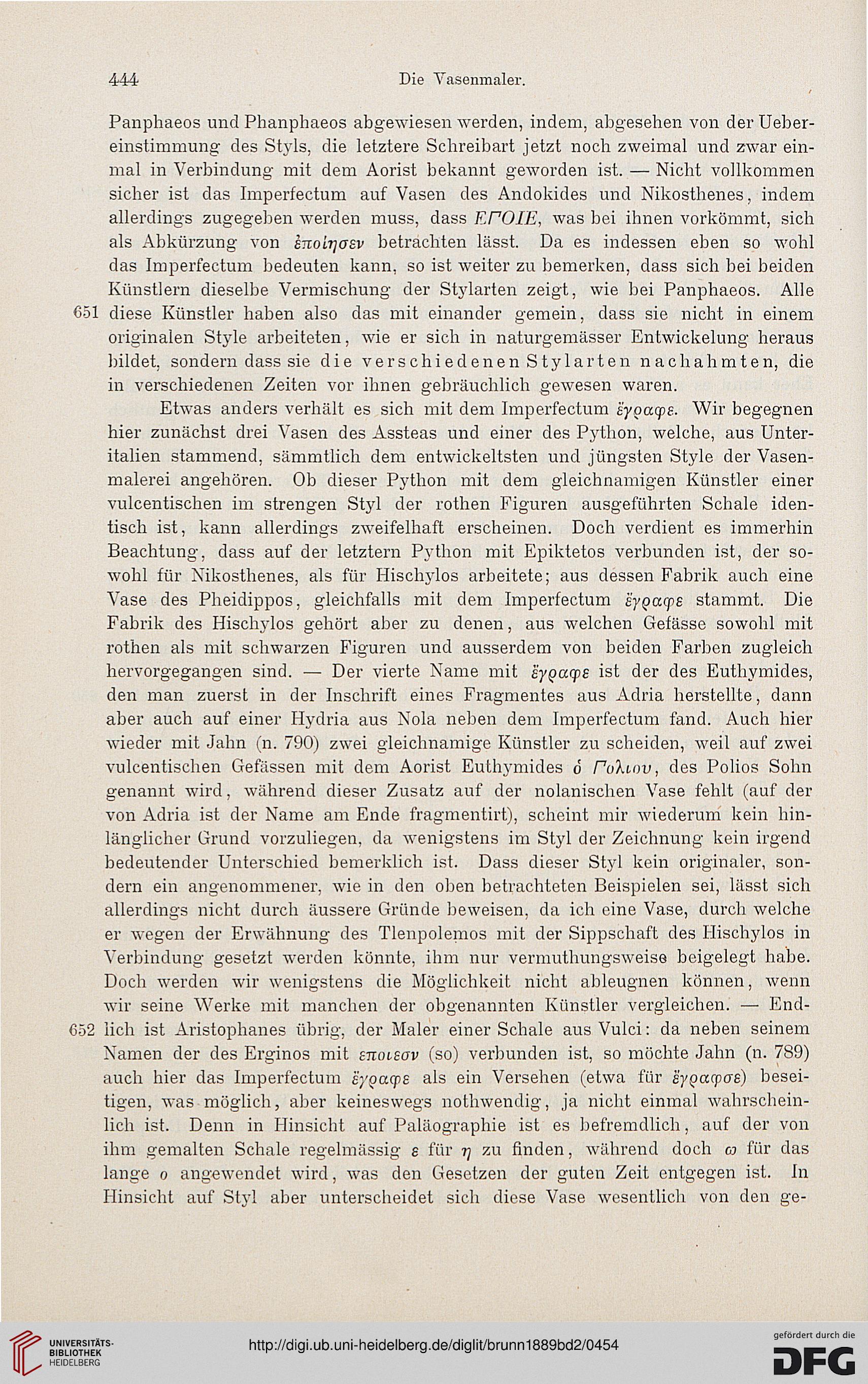444
Die Vasenmaler.
Panphaeos und Phanphaeos abgewiesen werden, indem, abgesehen von der Ueber-
einstimmung des Styls, die letztere Schreibart jetzt noch zweimal und zwar ein-
mal in Verbindung mit dem Aorist bekannt geworden ist. — Nicht vollkommen
sicher ist das Imperfectum auf Vasen des Andokides und Nikosthenes, indem
allerdings zugegeben werden muss, dass KPOIE, was bei ihnen vorkömmt, sich
als Abkürzung von enoLrjasv betrachten lässt. Da es indessen eben so wohl
das Imperfectum bedeuten kann, so ist weiter zu bemerken, dass sich bei beiden
Künstlern dieselbe Vermischung der Stylarten zeigt, wie bei Panphaeos. Alle
651 diese Künstler haben also das mit einander gemein, dass sie nicht in einem
originalen Style arbeiteten, wie er sich in naturgemässer Entwickelung heraus
bildet, sondern dass sie die verschiedenen Stylarten nachahmten, die
in verschiedenen Zeiten vor ihnen gebräuchlich gewesen waren.
Etwas anders verhält es sich mit dem Imperfectum tyoacpe. Wir begegnen
hier zunächst drei Vasen des Assteas und einer des P3'thon, welche, aus Unter-
italien stammend, sämmtlich dem entwickeltsten und jüngsten Style der Vasen-
malerei angehören. Ob dieser Python mit dem gleichnamigen Künstler einer
vulcentischen im strengen Styl der rothen Figuren ausgeführten Schale iden-
tisch ist, kann allerdings zweifelhaft erscheinen. Doch verdient es immerhin
Beachtung, dass auf der letztem Python mit Epiktetos verbunden ist, der so-
wohl für Nikosthenes, als für Hischylos arbeitete; aus dessen Fabrik auch eine
Vase des Pheidippos, gleichfalls mit dem Imperfectum eypacpe stammt. Die
Fabrik des Hischylos gehört aber zu denen, aus welchen Gefässe sowohl mit
rothen als mit schwarzen Figuren und ausserdem von beiden Farben zugleich
hervorgegangen sind. — Der vierte Name mit iygaqis ist der des Euthymides,
den man zuerst in der Inschrift eines Fragmentes aus Adria herstellte, dann
aber auch auf einer Hydria aus Nola neben dem Imperfectum fand. Auch hier
wieder mit Jahn (n. 790) zwei gleichnamige Künstler zu scheiden, weil auf zwei
vulcentischen Gefässen mit dem Aorist Euthymides 6 foXiou, des Polios Sohn
genannt wird, während dieser Zusatz auf der nolanischen Vase fehlt (auf der
von Adria ist der Name am Ende fragmentirt), scheint mir wiederum kein hin-
länglicher Grund vorzuliegen, da wenigstens im Styl der Zeichnung kein irgend
bedeutender Unterschied bemerklich ist. Dass dieser St3rl kein originaler, son-
dern ein angenommener, wie in den oben betrachteten Beispielen sei, lässt sich
allerdings nicht durch äussere Gründe beweisen, da ich eine Vase, durch welche
er wegen der Erwähnung des Tlenpolemos mit der Sippschaft des Hischylos in
Verbindung gesetzt werden könnte, ihm nur vermuthungsweise beigelegt habe.
Doch werden wir wenigstens die Möglichkeit nicht ableugnen können, wenn
wir seine Werke mit manchen der obgenannten Künstler vergleichen. —■ End-
652 lieh ist Aristophanes übrig, der Maler einer Schale aus Vulci: da neben seinem
Namen der des Erginos mit enoieov (so) verbunden ist, so möchte Jahn (n. 7S9)
auch hier das Imperfectum eyoacps als ein Versehen (etwa für eyQacpae) besei-
tigen, was möglich, aber keineswegs nothwendig, ja nicht einmal wahrschein-
lich ist. Denn in Hinsicht auf Paläographie ist es befremdlich, auf der von
ihm gemalten Schale regelmässig e für r\ zu finden, während doch co für das
lange o angewendet wird, was den Gesetzen der guten Zeit entgegen ist. In
Hinsicht auf Styl aber unterscheidet sich diese Vase wesentlich von den ge-
Die Vasenmaler.
Panphaeos und Phanphaeos abgewiesen werden, indem, abgesehen von der Ueber-
einstimmung des Styls, die letztere Schreibart jetzt noch zweimal und zwar ein-
mal in Verbindung mit dem Aorist bekannt geworden ist. — Nicht vollkommen
sicher ist das Imperfectum auf Vasen des Andokides und Nikosthenes, indem
allerdings zugegeben werden muss, dass KPOIE, was bei ihnen vorkömmt, sich
als Abkürzung von enoLrjasv betrachten lässt. Da es indessen eben so wohl
das Imperfectum bedeuten kann, so ist weiter zu bemerken, dass sich bei beiden
Künstlern dieselbe Vermischung der Stylarten zeigt, wie bei Panphaeos. Alle
651 diese Künstler haben also das mit einander gemein, dass sie nicht in einem
originalen Style arbeiteten, wie er sich in naturgemässer Entwickelung heraus
bildet, sondern dass sie die verschiedenen Stylarten nachahmten, die
in verschiedenen Zeiten vor ihnen gebräuchlich gewesen waren.
Etwas anders verhält es sich mit dem Imperfectum tyoacpe. Wir begegnen
hier zunächst drei Vasen des Assteas und einer des P3'thon, welche, aus Unter-
italien stammend, sämmtlich dem entwickeltsten und jüngsten Style der Vasen-
malerei angehören. Ob dieser Python mit dem gleichnamigen Künstler einer
vulcentischen im strengen Styl der rothen Figuren ausgeführten Schale iden-
tisch ist, kann allerdings zweifelhaft erscheinen. Doch verdient es immerhin
Beachtung, dass auf der letztem Python mit Epiktetos verbunden ist, der so-
wohl für Nikosthenes, als für Hischylos arbeitete; aus dessen Fabrik auch eine
Vase des Pheidippos, gleichfalls mit dem Imperfectum eypacpe stammt. Die
Fabrik des Hischylos gehört aber zu denen, aus welchen Gefässe sowohl mit
rothen als mit schwarzen Figuren und ausserdem von beiden Farben zugleich
hervorgegangen sind. — Der vierte Name mit iygaqis ist der des Euthymides,
den man zuerst in der Inschrift eines Fragmentes aus Adria herstellte, dann
aber auch auf einer Hydria aus Nola neben dem Imperfectum fand. Auch hier
wieder mit Jahn (n. 790) zwei gleichnamige Künstler zu scheiden, weil auf zwei
vulcentischen Gefässen mit dem Aorist Euthymides 6 foXiou, des Polios Sohn
genannt wird, während dieser Zusatz auf der nolanischen Vase fehlt (auf der
von Adria ist der Name am Ende fragmentirt), scheint mir wiederum kein hin-
länglicher Grund vorzuliegen, da wenigstens im Styl der Zeichnung kein irgend
bedeutender Unterschied bemerklich ist. Dass dieser St3rl kein originaler, son-
dern ein angenommener, wie in den oben betrachteten Beispielen sei, lässt sich
allerdings nicht durch äussere Gründe beweisen, da ich eine Vase, durch welche
er wegen der Erwähnung des Tlenpolemos mit der Sippschaft des Hischylos in
Verbindung gesetzt werden könnte, ihm nur vermuthungsweise beigelegt habe.
Doch werden wir wenigstens die Möglichkeit nicht ableugnen können, wenn
wir seine Werke mit manchen der obgenannten Künstler vergleichen. —■ End-
652 lieh ist Aristophanes übrig, der Maler einer Schale aus Vulci: da neben seinem
Namen der des Erginos mit enoieov (so) verbunden ist, so möchte Jahn (n. 7S9)
auch hier das Imperfectum eyoacps als ein Versehen (etwa für eyQacpae) besei-
tigen, was möglich, aber keineswegs nothwendig, ja nicht einmal wahrschein-
lich ist. Denn in Hinsicht auf Paläographie ist es befremdlich, auf der von
ihm gemalten Schale regelmässig e für r\ zu finden, während doch co für das
lange o angewendet wird, was den Gesetzen der guten Zeit entgegen ist. In
Hinsicht auf Styl aber unterscheidet sich diese Vase wesentlich von den ge-