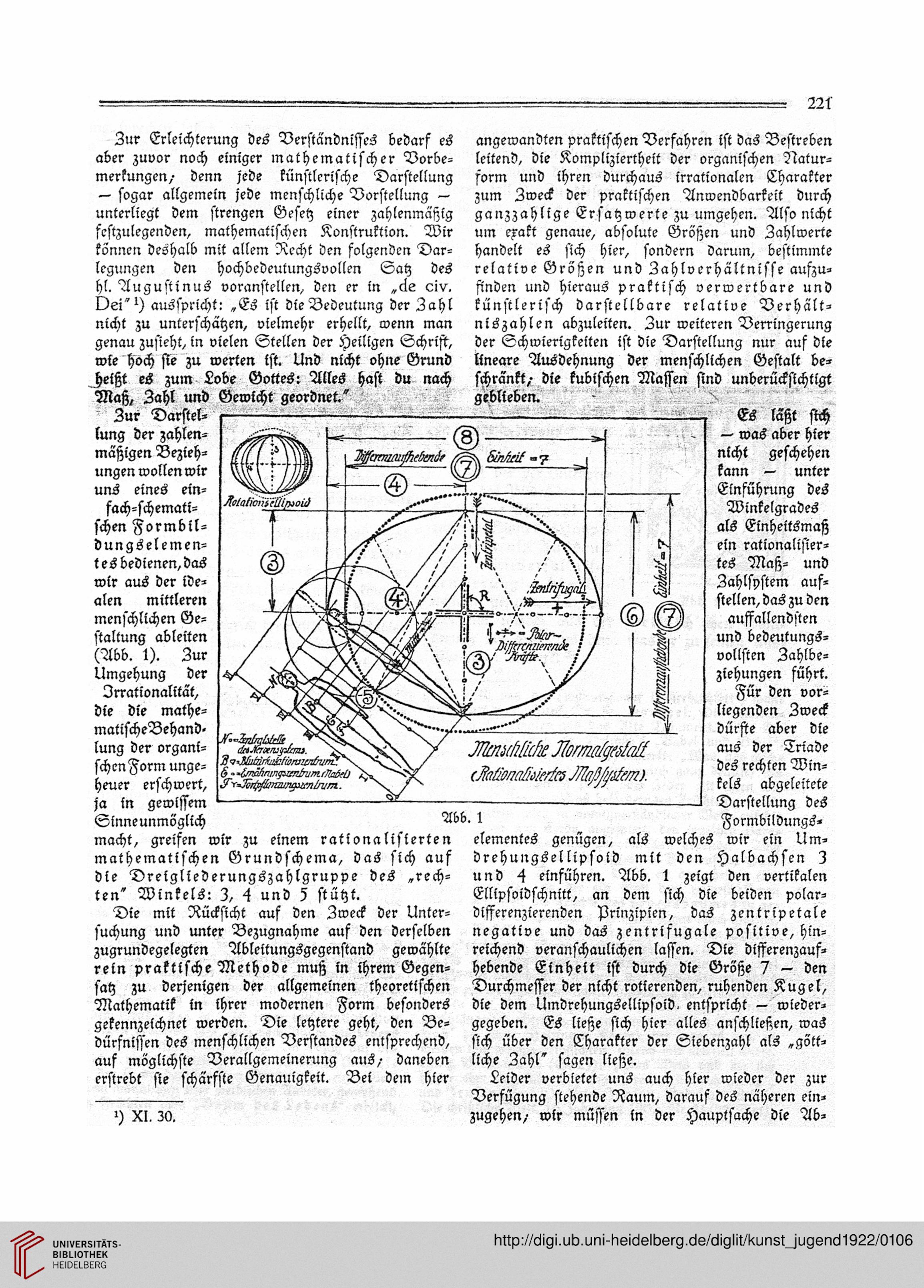221
Zur Erleichterung des Verständniffes bedarf es
aber zuvor noch einiger mathematischer Vorbe-
merkungen,- denn jede künstlerische Darstellung
— sogar allgemekn jede menschliche Vorstellung —
unterliegt dem strengen Geseh einer zahlenmästkg
fcstzulegenden, mathematischen Konstruktion. Wir
könncn deshalb mit allem Necht den folgenden Dar-
legungen den hochbedeutungsvollen Satz des
hl. Augustinus voranstellen, den er kn eiv.
ausspricht: »Es ist dieBedeutung der Zahl
nicht zu unterschätzen, vielmehr erhellt, wenn man
genau zusieht, kn vielen Stellen der Heiligen Schrist,
wie hoch sie zu werten kst. Und nicht ohne Grund
heißt es zum Lobe Gottes: Alles hast du nach
Maß, Zahl und Gewkcht geordnet."
2ur Darstel-
lung der zahlen-
mäßigen Bezieh-
ungenwollenwir
uns eines ein-
fach-schemati-
schen Formbil-
dungselemen-
tesbedienen,das
wlr aus der ide-
alen mittleren
menschlichen Ge-
staltung ableiten
(Abb. 1). Zur
Umgehung der
Zrrationalität,
die dke mathe-
matischeBehand-
lung der organi-
schcnForm unge-
heuer erschwert,
ja in gewissem
Sinneunmöglich
macht, greifen wir zu einem rationalisierten
mathematischen Grundschema, das sich auf
die Dreigliederungszahlgruppe des »rech-
ten" Winkels: 3, 4 und 5 stützt.
Die mit Rückstcht auf den Zweck der Unter-
suchung und unter Bezugnahme auf den derselben
zugrundegelegten Ableitungsgegenstand gewählte
rein praktische Methode muß in threm Gegen-
satz zu derjenigen der allgemeinen theoretischen
Mathematik in ihrer modernen Form besonders
gekennzeichnet werden. Die letztere geht, den Be-
dürfniffen des menschlkchen Verstandes entsprcchend,
auf möglichste Verallgemeinerung aus,- daneben
erstrebt sie schärffte Genauigkeit. Bei dem hier
-) XI. 30.
angewandten praktischen Verfahren ist das Bestreben
leitend, die Kompliziertheit der organischen ?latur-
sorm und ihren durchaus krrationalen Lharakter
zum Zweck der praktischen Anwendbarkcit durch
ganzzahlige Ersatzwerte zu umgehen. Also nicht
um epakt genaue, absolute Größen und Zahlwerte
handclt es sich hier, sondern Sarum, bestimmte
relative Größen und Zahlverhältnisse aufzu-
finden und hieraus praktisch verwertbare und
künstlerisch darstellbare relatioe Verhält-
niszahlen abzuleiten. Zur weiteren Verringerung
der Schwierigkeiten ist die Darstellung nur auf die
lineare Ausdehnung der menschlichen Gestalt be-
schränkt,- die kubischen Maffen sind unberücksichtlgt
Es läßt stch
— was aber hker
nkcht geschehen
kann — unker
Einsührung des
Winkelgrades
als Eknheitsmaß
ein rationalisier-
tes Maß- und
Zahlsystem auf-
stellen,daszuden
auffallendsten
und bedeutungs-
vollsten Zahlbe-
ziehungen führt.
Für den vor-
liegenden Zweck
dürfte aber dke
aus der Trkade
des rechken Win-
kels abgeleitete
Darstellung des
Formbildungs-
elementes genügen, als welches wir ein Um-
drehungsellipsoid mit den Halbachscn 3
und 4 einführen. Abb. 1 zeigt den vertikalen
Ellipsoidschnitt, an dem sich die beiden polar-
differenzierenden Prknzipken, das zentrkpetale
negative und das zentrifugale positive, hin-
reichend veranschaulichen lassen. Die differenzauf-
hebende Einheit ist durch dke Größe 7 — den
Durchmesser der nkcht rotierenden, ruhenden Kugel,
die dem Umdrehungsellipsoid. entsprichk — wieder-
gegeben. Es ließe sich hier alles anschliesien, waS
sich über den Eharakter der Siebenzahl als „gött-
liche Zahl' sagen ließe.
Leider verbietet uns auch hier wkeder der zur
Verfügung stehende Raum, darauf des näheren cin-
zugehen,- wkr müffen ln der Hauptsache die Ab-
Abb. 1
Zur Erleichterung des Verständniffes bedarf es
aber zuvor noch einiger mathematischer Vorbe-
merkungen,- denn jede künstlerische Darstellung
— sogar allgemekn jede menschliche Vorstellung —
unterliegt dem strengen Geseh einer zahlenmästkg
fcstzulegenden, mathematischen Konstruktion. Wir
könncn deshalb mit allem Necht den folgenden Dar-
legungen den hochbedeutungsvollen Satz des
hl. Augustinus voranstellen, den er kn eiv.
ausspricht: »Es ist dieBedeutung der Zahl
nicht zu unterschätzen, vielmehr erhellt, wenn man
genau zusieht, kn vielen Stellen der Heiligen Schrist,
wie hoch sie zu werten kst. Und nicht ohne Grund
heißt es zum Lobe Gottes: Alles hast du nach
Maß, Zahl und Gewkcht geordnet."
2ur Darstel-
lung der zahlen-
mäßigen Bezieh-
ungenwollenwir
uns eines ein-
fach-schemati-
schen Formbil-
dungselemen-
tesbedienen,das
wlr aus der ide-
alen mittleren
menschlichen Ge-
staltung ableiten
(Abb. 1). Zur
Umgehung der
Zrrationalität,
die dke mathe-
matischeBehand-
lung der organi-
schcnForm unge-
heuer erschwert,
ja in gewissem
Sinneunmöglich
macht, greifen wir zu einem rationalisierten
mathematischen Grundschema, das sich auf
die Dreigliederungszahlgruppe des »rech-
ten" Winkels: 3, 4 und 5 stützt.
Die mit Rückstcht auf den Zweck der Unter-
suchung und unter Bezugnahme auf den derselben
zugrundegelegten Ableitungsgegenstand gewählte
rein praktische Methode muß in threm Gegen-
satz zu derjenigen der allgemeinen theoretischen
Mathematik in ihrer modernen Form besonders
gekennzeichnet werden. Die letztere geht, den Be-
dürfniffen des menschlkchen Verstandes entsprcchend,
auf möglichste Verallgemeinerung aus,- daneben
erstrebt sie schärffte Genauigkeit. Bei dem hier
-) XI. 30.
angewandten praktischen Verfahren ist das Bestreben
leitend, die Kompliziertheit der organischen ?latur-
sorm und ihren durchaus krrationalen Lharakter
zum Zweck der praktischen Anwendbarkcit durch
ganzzahlige Ersatzwerte zu umgehen. Also nicht
um epakt genaue, absolute Größen und Zahlwerte
handclt es sich hier, sondern Sarum, bestimmte
relative Größen und Zahlverhältnisse aufzu-
finden und hieraus praktisch verwertbare und
künstlerisch darstellbare relatioe Verhält-
niszahlen abzuleiten. Zur weiteren Verringerung
der Schwierigkeiten ist die Darstellung nur auf die
lineare Ausdehnung der menschlichen Gestalt be-
schränkt,- die kubischen Maffen sind unberücksichtlgt
Es läßt stch
— was aber hker
nkcht geschehen
kann — unker
Einsührung des
Winkelgrades
als Eknheitsmaß
ein rationalisier-
tes Maß- und
Zahlsystem auf-
stellen,daszuden
auffallendsten
und bedeutungs-
vollsten Zahlbe-
ziehungen führt.
Für den vor-
liegenden Zweck
dürfte aber dke
aus der Trkade
des rechken Win-
kels abgeleitete
Darstellung des
Formbildungs-
elementes genügen, als welches wir ein Um-
drehungsellipsoid mit den Halbachscn 3
und 4 einführen. Abb. 1 zeigt den vertikalen
Ellipsoidschnitt, an dem sich die beiden polar-
differenzierenden Prknzipken, das zentrkpetale
negative und das zentrifugale positive, hin-
reichend veranschaulichen lassen. Die differenzauf-
hebende Einheit ist durch dke Größe 7 — den
Durchmesser der nkcht rotierenden, ruhenden Kugel,
die dem Umdrehungsellipsoid. entsprichk — wieder-
gegeben. Es ließe sich hier alles anschliesien, waS
sich über den Eharakter der Siebenzahl als „gött-
liche Zahl' sagen ließe.
Leider verbietet uns auch hier wkeder der zur
Verfügung stehende Raum, darauf des näheren cin-
zugehen,- wkr müffen ln der Hauptsache die Ab-
Abb. 1