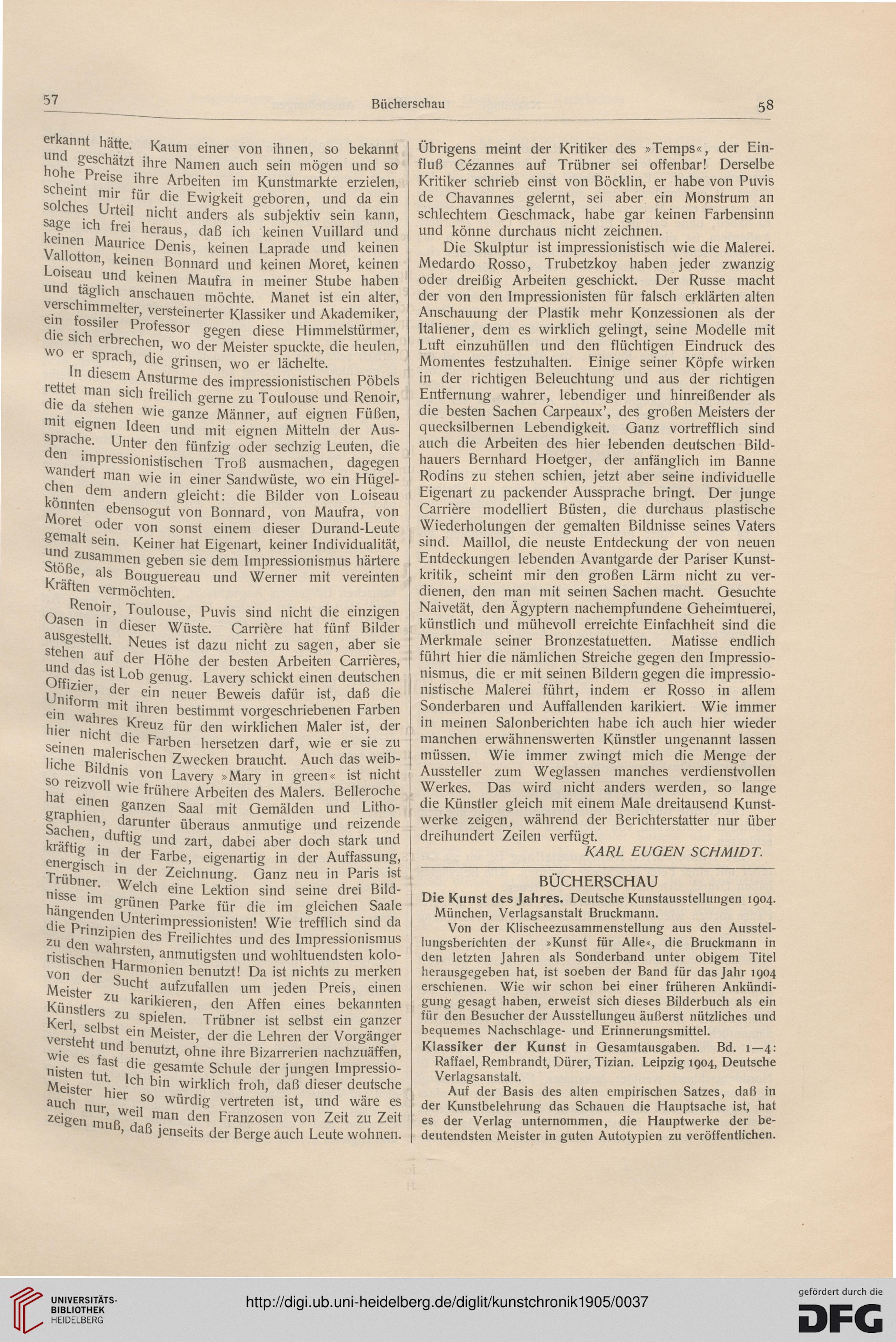57
Bücherschau
58
erkannt hätte. Kaum einer von ihnen, so bekannt
und geschätzt ihre Namen auch sein mögen und so
hohe Preise ihre Arbeiten im Kunstmarkte erzielen,
scheint mir für die Ewigkeit geboren, und da ein
solches Urteil nicht anders als subjektiv sein kann,
sage ich frei heraus, daß ich keinen Vuillard und
keinen Maurice Denis, keinen Laprade und keinen
Vallotton, keinen Bonnard und keinen Moret, keinen
Loiseau und keinen Maufra in meiner Stube haben
und täglich anschauen möchte. Manet ist ein alter,
verschimmelter, versteinerter Klassiker und Akademiker,
ein fossiler Professor gegen diese Himmelstürmer,
die sich erbrechen, wo der Meister spuckte, die heulen,
wo er sprach, die grinsen, wo er lächelte.
In diesem Anstürme des impressionistischen Pöbels
rettet man sich freilich gerne zu Toulouse und Renoir,
die da stehen wie ganze Männer, auf eignen Füßen,
mit eignen Ideen und mit eignen Mitteln der Aus-
sprache. Unter den fünfzig oder sechzig Leuten, die
den impressionistischen Troß ausmachen, dagegen
wandert man wie in einer Sandwüste, wo ein Hügel-
chen dem andern gleicht: die Bilder von Loiseau
könnten ebensogut von Bonnard, von Maufra, von
Moret oder von sonst einem dieser Durand-Leute
gemalt sein. Keiner hat Eigenart, keiner Individualität,
und zusammen geben sie dem Impressionismus härtere
Stöße, als Bouguereau und Werner mit vereinten
Kräften vermöchten.
Renoir, Toulouse, Puvis sind nicht die einzigen
Oasen in dieser Wüste. Carriere hat fünf Bilder
ausgestellt. Neues ist dazu nicht zu sagen, aber sie
stehen auf der Höhe der besten Arbeiten Carneres,
und das ist Lob genug. Lavery schickt einen deutschen
Offizier, der ein neuer Beweis dafür ist, daß die
Uniform mit ihren bestimmt vorgeschriebenen Farben
ein wahres Kreuz für den wirklichen Maler ist, der
'"er nicht die Farben hersetzen darf, wie er sie zu
seinen malerischen Zwecken braucht. Auch das weib-
liche RiM-:-
ich-e Bildnis
eizvoll wii
einen ganzen Saaf~mif Gemälden und Litho-
so rei m VOn lavery »Mary in green« ist nicht
hat W'e frühere Arbeiten des Malers. Belleroche
11,1 ^^'r^'und'^eizende
graphien, darunter überaus anmutig und
Sachen, duftig und zart, dabei aber AuffaSSung,
kräftig in der Farbe, eigenartig m ^ paris ist
energisch in der Zeichnung. Oanz n ^ ßUd_
Trübner. Welch eine Lektion Sinei se hen Saale
nisse im grünen Parke für die im ^ da
hängenden Unterimpressionisten', wie ionismus
die Prinzipien des Freilichtes und des im n kolo.
zu den wahrsten, anmutigsten und ^onu ^ merken
ristischen Harmonien benutzt! Da ist n ^ einen
von der Sucht aufzufallen um )edennes be'kannten
Meister zu karikieren, den Affen et ^ o.anzer
Künstlers zu spielen. Trübner ist seirjb y *-nger
Kerl, selbst ein Meister, der die Lehren u nachzuäffen>
versteht und benutzt, ohne ihre Bizarrene^ lmpressio.
wie es fast die gesamte Schule der jui g deutsche
nisten tut. Ich bin wirklich froh, aao ^ ^ es
Meister hier so würdig vertreten ist, ^ Zeit
auch nur, weil man den Franzosen voi ,uiell.
zeigen muß, daß jenseits der Berge auch
Übrigens meint der Kritiker des »Temps«, der Ein-
fluß Cezannes auf Trübner sei offenbar! Derselbe
Kritiker schrieb einst von Böcklin, er habe von Puvis
de Chavannes gelernt, sei aber ein Monstrum an
schlechtem Geschmack, habe gar keinen Farbensinn
und könne durchaus nicht zeichnen.
Die Skulptur ist impressionistisch wie die Malerei.
Medardo Rosso, Trubetzkoy haben jeder zwanzig
oder dreißig Arbeiten geschickt. Der Russe macht
der von den Impressionisten für falsch erklärten alten
Anschauung der Plastik mehr Konzessionen als der
Italiener, dem es wirklich gelingt, seine Modelle mit
Luft einzuhüllen und den flüchtigen Eindruck des
Momentes festzuhalten. Einige seiner Köpfe wirken
in der richtigen Beleuchtung und aus der richtigen
Entfernung wahrer, lebendiger und hinreißender als
die besten Sachen Carpeaux', des großen Meisters der
quecksilbernen Lebendigkeit. Ganz vortrefflich sind
auch die Arbeiten des hier lebenden deutschen Bild-
hauers Bernhard Hoetger, der anfänglich im Banne
Rodins zu stehen schien, jetzt aber seine individuelle
Eigenart zu packender Aussprache bringt. Der junge
Carriere modelliert Büsten, die durchaus plastische
Wiederholungen der gemalten Bildnisse seines Vaters
sind. Maillol, die neuste Entdeckung der von neuen
Entdeckungen lebenden Avantgarde der Pariser Kunst-
kritik, scheint mir den großen Lärm nicht zu ver-
dienen, den man mit seinen Sachen macht. Gesuchte
Naivetät, den Ägyptern nachempfundene Geheimtuerei,
künstlich und mühevoll erreichte Einfachheit sind die
Merkmale seiner Bronzestatuetten. Matisse endlich
führt hier die nämlichen Streiche gegen den Impressio-
nismus, die er mit seinen Bildern gegen die impressio-
nistische Malerei führt, indem er Rosso in allem
Sonderbaren und Auffallenden karikiert. Wie immer
in meinen Salonberichten habe ich auch hier wieder
manchen erwähnenswerten Künstler ungenannt lassen
müssen. Wie immer zwingt mich die Menge der
Aussteller zum Weglassen manches verdienstvollen
Werkes. Das wird nicht anders werden, so lange
die Künstler gleich mit einem Male dreitausend Kunst-
werke zeigen, während der Berichterstatter nur über
dreihundert Zeilen verfügt.
KARL EUGEN SCHMIDT.
BÜCHERSCHAU
Die Kunst des Jahres. Deutsche Kunstausstellungen 1904.
München, Verlagsanstalt Bruckmann.
Von der Klischeezusammenstellung aus den Ausstel-
lungsberichten der »Kunst für Alle«, die Bruckmann in
den letzten Jahren als Sonderband unter obigem Titel
herausgegeben hat, ist soeben der Band für das Jahr 1904
erschienen. Wie wir schon bei einer früheren Ankündi-
gung gesagt haben, erweist sich dieses Bilderbuch als ein
für den Besucher der Ausstellungen äußerst nützliches und
bequemes Nachschlage- und Erinnerungsmittel.
Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben. Bd. 1—4:
Raffael, Rembrandt, Dürer, Tizian. Leipzig 1904, Deutsche
Verlagsanstalt.
Auf der Basis des alten empirischen Satzes, daß in
der Kunstbelehrung das Schauen die Hauptsache ist, hat
es der Verlag unternommen, die Hauptwerke der be-
deutendsten Meister in guten Autotypien zu veröffentlichen.
Bücherschau
58
erkannt hätte. Kaum einer von ihnen, so bekannt
und geschätzt ihre Namen auch sein mögen und so
hohe Preise ihre Arbeiten im Kunstmarkte erzielen,
scheint mir für die Ewigkeit geboren, und da ein
solches Urteil nicht anders als subjektiv sein kann,
sage ich frei heraus, daß ich keinen Vuillard und
keinen Maurice Denis, keinen Laprade und keinen
Vallotton, keinen Bonnard und keinen Moret, keinen
Loiseau und keinen Maufra in meiner Stube haben
und täglich anschauen möchte. Manet ist ein alter,
verschimmelter, versteinerter Klassiker und Akademiker,
ein fossiler Professor gegen diese Himmelstürmer,
die sich erbrechen, wo der Meister spuckte, die heulen,
wo er sprach, die grinsen, wo er lächelte.
In diesem Anstürme des impressionistischen Pöbels
rettet man sich freilich gerne zu Toulouse und Renoir,
die da stehen wie ganze Männer, auf eignen Füßen,
mit eignen Ideen und mit eignen Mitteln der Aus-
sprache. Unter den fünfzig oder sechzig Leuten, die
den impressionistischen Troß ausmachen, dagegen
wandert man wie in einer Sandwüste, wo ein Hügel-
chen dem andern gleicht: die Bilder von Loiseau
könnten ebensogut von Bonnard, von Maufra, von
Moret oder von sonst einem dieser Durand-Leute
gemalt sein. Keiner hat Eigenart, keiner Individualität,
und zusammen geben sie dem Impressionismus härtere
Stöße, als Bouguereau und Werner mit vereinten
Kräften vermöchten.
Renoir, Toulouse, Puvis sind nicht die einzigen
Oasen in dieser Wüste. Carriere hat fünf Bilder
ausgestellt. Neues ist dazu nicht zu sagen, aber sie
stehen auf der Höhe der besten Arbeiten Carneres,
und das ist Lob genug. Lavery schickt einen deutschen
Offizier, der ein neuer Beweis dafür ist, daß die
Uniform mit ihren bestimmt vorgeschriebenen Farben
ein wahres Kreuz für den wirklichen Maler ist, der
'"er nicht die Farben hersetzen darf, wie er sie zu
seinen malerischen Zwecken braucht. Auch das weib-
liche RiM-:-
ich-e Bildnis
eizvoll wii
einen ganzen Saaf~mif Gemälden und Litho-
so rei m VOn lavery »Mary in green« ist nicht
hat W'e frühere Arbeiten des Malers. Belleroche
11,1 ^^'r^'und'^eizende
graphien, darunter überaus anmutig und
Sachen, duftig und zart, dabei aber AuffaSSung,
kräftig in der Farbe, eigenartig m ^ paris ist
energisch in der Zeichnung. Oanz n ^ ßUd_
Trübner. Welch eine Lektion Sinei se hen Saale
nisse im grünen Parke für die im ^ da
hängenden Unterimpressionisten', wie ionismus
die Prinzipien des Freilichtes und des im n kolo.
zu den wahrsten, anmutigsten und ^onu ^ merken
ristischen Harmonien benutzt! Da ist n ^ einen
von der Sucht aufzufallen um )edennes be'kannten
Meister zu karikieren, den Affen et ^ o.anzer
Künstlers zu spielen. Trübner ist seirjb y *-nger
Kerl, selbst ein Meister, der die Lehren u nachzuäffen>
versteht und benutzt, ohne ihre Bizarrene^ lmpressio.
wie es fast die gesamte Schule der jui g deutsche
nisten tut. Ich bin wirklich froh, aao ^ ^ es
Meister hier so würdig vertreten ist, ^ Zeit
auch nur, weil man den Franzosen voi ,uiell.
zeigen muß, daß jenseits der Berge auch
Übrigens meint der Kritiker des »Temps«, der Ein-
fluß Cezannes auf Trübner sei offenbar! Derselbe
Kritiker schrieb einst von Böcklin, er habe von Puvis
de Chavannes gelernt, sei aber ein Monstrum an
schlechtem Geschmack, habe gar keinen Farbensinn
und könne durchaus nicht zeichnen.
Die Skulptur ist impressionistisch wie die Malerei.
Medardo Rosso, Trubetzkoy haben jeder zwanzig
oder dreißig Arbeiten geschickt. Der Russe macht
der von den Impressionisten für falsch erklärten alten
Anschauung der Plastik mehr Konzessionen als der
Italiener, dem es wirklich gelingt, seine Modelle mit
Luft einzuhüllen und den flüchtigen Eindruck des
Momentes festzuhalten. Einige seiner Köpfe wirken
in der richtigen Beleuchtung und aus der richtigen
Entfernung wahrer, lebendiger und hinreißender als
die besten Sachen Carpeaux', des großen Meisters der
quecksilbernen Lebendigkeit. Ganz vortrefflich sind
auch die Arbeiten des hier lebenden deutschen Bild-
hauers Bernhard Hoetger, der anfänglich im Banne
Rodins zu stehen schien, jetzt aber seine individuelle
Eigenart zu packender Aussprache bringt. Der junge
Carriere modelliert Büsten, die durchaus plastische
Wiederholungen der gemalten Bildnisse seines Vaters
sind. Maillol, die neuste Entdeckung der von neuen
Entdeckungen lebenden Avantgarde der Pariser Kunst-
kritik, scheint mir den großen Lärm nicht zu ver-
dienen, den man mit seinen Sachen macht. Gesuchte
Naivetät, den Ägyptern nachempfundene Geheimtuerei,
künstlich und mühevoll erreichte Einfachheit sind die
Merkmale seiner Bronzestatuetten. Matisse endlich
führt hier die nämlichen Streiche gegen den Impressio-
nismus, die er mit seinen Bildern gegen die impressio-
nistische Malerei führt, indem er Rosso in allem
Sonderbaren und Auffallenden karikiert. Wie immer
in meinen Salonberichten habe ich auch hier wieder
manchen erwähnenswerten Künstler ungenannt lassen
müssen. Wie immer zwingt mich die Menge der
Aussteller zum Weglassen manches verdienstvollen
Werkes. Das wird nicht anders werden, so lange
die Künstler gleich mit einem Male dreitausend Kunst-
werke zeigen, während der Berichterstatter nur über
dreihundert Zeilen verfügt.
KARL EUGEN SCHMIDT.
BÜCHERSCHAU
Die Kunst des Jahres. Deutsche Kunstausstellungen 1904.
München, Verlagsanstalt Bruckmann.
Von der Klischeezusammenstellung aus den Ausstel-
lungsberichten der »Kunst für Alle«, die Bruckmann in
den letzten Jahren als Sonderband unter obigem Titel
herausgegeben hat, ist soeben der Band für das Jahr 1904
erschienen. Wie wir schon bei einer früheren Ankündi-
gung gesagt haben, erweist sich dieses Bilderbuch als ein
für den Besucher der Ausstellungen äußerst nützliches und
bequemes Nachschlage- und Erinnerungsmittel.
Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben. Bd. 1—4:
Raffael, Rembrandt, Dürer, Tizian. Leipzig 1904, Deutsche
Verlagsanstalt.
Auf der Basis des alten empirischen Satzes, daß in
der Kunstbelehrung das Schauen die Hauptsache ist, hat
es der Verlag unternommen, die Hauptwerke der be-
deutendsten Meister in guten Autotypien zu veröffentlichen.