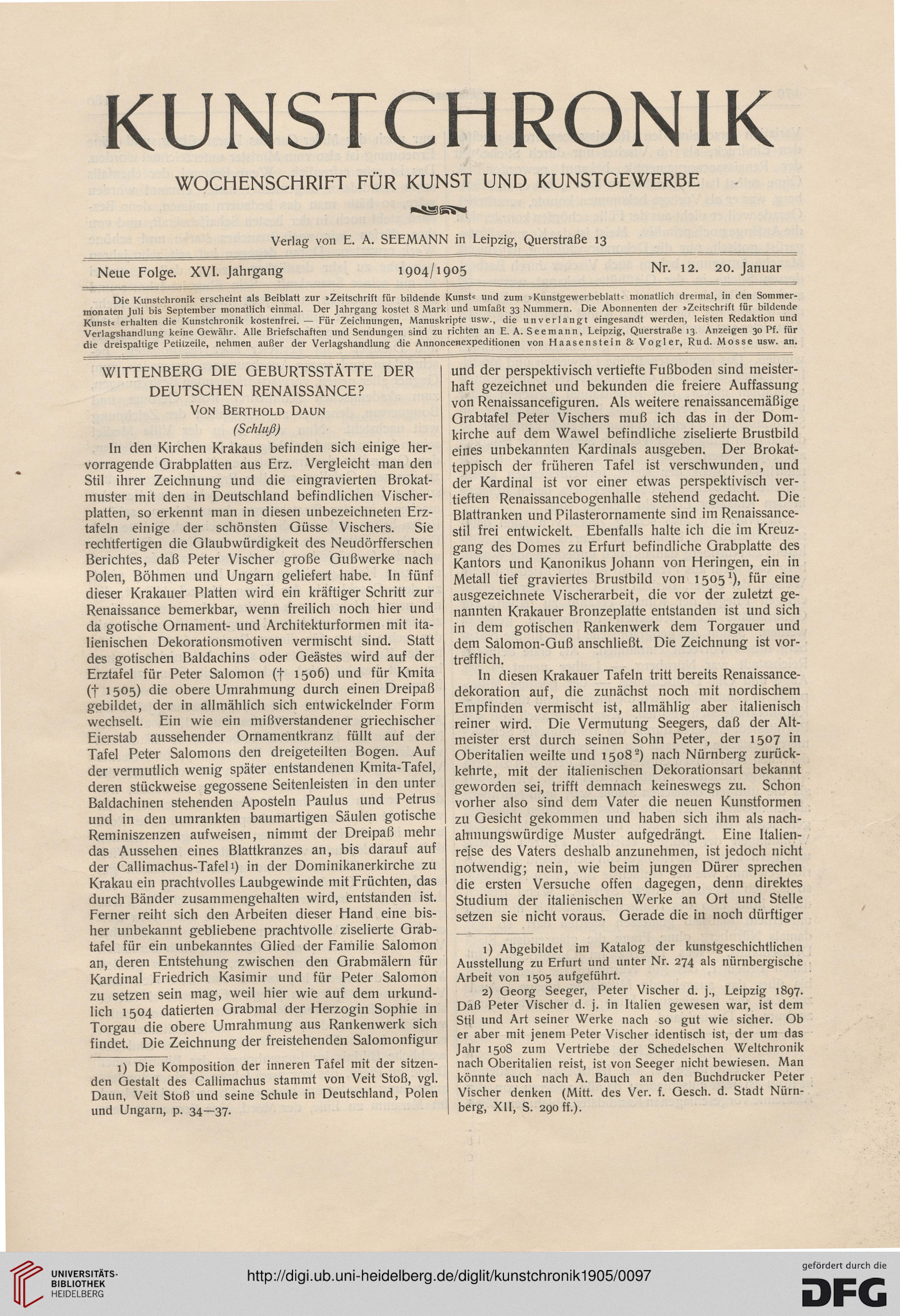KUNSTCHRONIK
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig, Querstraße 13
Neue Folge. XVI. Jahrgang 1904/1905 Nr. 12. 20. Januar
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur »Zeitschrift für bildende Kunst« und zum »Kunstgewerbeblalt« monatlich dreimal, in den Sommer-
monaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfaßt 33 Nummern. Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende
Kunst« erhalten die Kunstchronik kostenfrei. — Für Zeichnungen, Manuskripte usw., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und
Verlagshandlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an e. A. Seemann, Leipzig, Querstraße 13. Anzeigen 30 Pf. für
die dreispaltige Petilzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse usw. an.
WITTENBERG DIE GEBURTSSTÄTTE DER
DEUTSCHEN RENAISSANCE?
Von Berthold Daun
(Schluß)
In den Kirchen Krakaus befinden sich einige her-
vorragende Grabplatten aus Erz. Vergleicht man den
Stil ihrer Zeichnung und die eingravierten Brokat-
muster mit den in Deutschland befindlichen Vischer-
platten, so erkennt man in diesen unbezeichneten Erz-
tafeln einige der schönsten Güsse Vischers. Sie
rechtfertigen die Glaubwürdigkeit des Neudörfferschen
Berichtes, daß Peter Vischer große Gußwerke nach
Polen, Böhmen und Ungarn geliefert habe. In fünf
dieser Krakauer Platten wird ein kräftiger Schritt zur
Renaissance bemerkbar, wenn freilich noch hier und
da gotische Ornament- und Architekturformen mit ita-
lienischen Dekorationsmotiven vermischt sind. Statt
des gotischen Baldachins oder Geästes wird auf der
Erztafel für Peter Salomon (| 1506) und für Kmita
(t 15°5) die obere Umrahmung durch einen Dreipaß
gebildet, der in allmählich sich entwickelnder Form
wechselt. Ein wie ein mißverstandener griechischer
Eierstab aussehender Ornamentkranz füllt auf der
Tafel Peter Salomons den dreigeteilten Bogen. Auf
der vermutlich wenig später entstandenen Kmita-Tafel,
deren stückweise gegossene Seitenleisten in den unter
Baldachinen stehenden Aposteln Paulus und Petrus
und in den umrankten baumartigen Säulen gotische
Reminiszenzen aufweisen, nimmt der Dreipaß mehr
das Aussehen eines Blattkranzes an, bis darauf auf
der Callimachus-Tafeli) in der Dominikanerkirche zu
Krakau ein prachtvolles Laubgewinde mit Früchten, das
durch Bänder zusammengehalten wird, entstanden ist.
Ferner reiht sich den Arbeiten dieser Hand eine bis-
her unbekannt gebliebene prachtvolle ziselierte Grab-
tafel für ein unbekanntes Glied der Familie Salomon
an, deren Entstehung zwischen den Grabmälern für
Kardinal Friedrich Kasimir und für Peter Salomon
zu setzen sein mag, weil hier wie auf dem urkund-
lich 1504 datierten Grabmal der Herzogin Sophie in
Torgau die obere Umrahmung aus Rankenwerk sich
findet. Die Zeichnung der freistehenden Salomonfigur
1) Die Komposition der inneren Tafel mit der sitzen-
den Gestalt des Cailimachus stammt von Veit Stoß, vgl.
Daun, Veit Stoß und seine Schule in Deutschland, Polen
und Ungarn, p. 34—37.
und der perspektivisch vertiefte Fußboden sind meister-
haft gezeichnet und bekunden die freiere Auffassung
von Renaissancefiguren. Als weitere renaissancemäßige
Grabtafel Peter Vischers muß ich das in der Dom-
kirche auf dem Wawel befindliche ziselierte Brustbild
eines unbekannten Kardinals ausgeben. Der Brokat-
teppisch der früheren Tafel ist verschwunden, und
der Kardinal ist vor einer etwas perspektivisch ver-
tieften Renaissancebogenhalle stehend gedacht. Die
Blattranken und Pilasterornamente sind im Renaissance-
stil frei entwickelt. Ebenfalls halte ich die im Kreuz-
gang des Domes zu Erfurt befindliche Grabplatte des
Kantors und Kanonikus Johann von Heringen, ein in
Metall tief graviertes Brustbild von 15051), für eine
ausgezeichnete Vischerarbeit, die vor der zuletzt ge-
nannten Krakauer Bronzeplatte entstanden ist und sich
in dem gotischen Rankenwerk dem Torgauer und
dem Salomon-Guß anschließt. Die Zeichnung ist vor-
trefflich.
In diesen Krakauer Tafeln tritt bereits Renaissance-
dekoration auf, die zunächst noch mit nordischem
Empfinden vermischt ist, allmählig aber italienisch
reiner wird. Die Vermutung Seegers, daß der Alt-
meister erst durch seinen Sohn Peter, der 1507 in
Oberitalien weilte und 15082) nach Nürnberg zurück-
kehrte, mit der italienischen Dekorationsart bekannt
geworden sei, trifft demnach keineswegs zu. Schon
vorher also sind dem Vater die neuen Kunstformen
zu Gesicht gekommen und haben sich ihm als nach-
ahmungswürdige Muster aufgedrängt. Eine Italien-
reise des Vaters deshalb anzunehmen, ist jedoch nicht
notwendig; nein, wie beim jungen Dürer sprechen
die ersten Versuche offen dagegen, denn direktes
Studium der italienischen Werke an Ort und Stelle
setzen sie nicht voraus. Gerade die in noch dürftiger
1) Abgebildet im Katalog der kunstgeschichtlichen
Ausstellung zu Erfurt und unter Nr. 274 als nürnbergische
Arbeit von 1505 aufgeführt.
2) Georg Seeger, Peter Vischer d. j., Leipzig 1897.
Daß Peter Vischer d. j. in Italien gewesen war, ist dem
Stil und Art seiner Werke nach so gut wie sicher. Ob
er aber mit jenem Peter Vischer identisch ist, der um das
Jahr 1508 zum Vertriebe der Schedeischen Weltchronik
nach Oberitalien reist, ist von Seeger nicht bewiesen. Man
könnte auch nach A. Bauch an den Buchdrucker Peter
Vischer denken (Mitt. des Ver. f. Gesch. d. Stadt Nürn-
berg, XII, S. 290ff.).
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig, Querstraße 13
Neue Folge. XVI. Jahrgang 1904/1905 Nr. 12. 20. Januar
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur »Zeitschrift für bildende Kunst« und zum »Kunstgewerbeblalt« monatlich dreimal, in den Sommer-
monaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfaßt 33 Nummern. Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende
Kunst« erhalten die Kunstchronik kostenfrei. — Für Zeichnungen, Manuskripte usw., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und
Verlagshandlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an e. A. Seemann, Leipzig, Querstraße 13. Anzeigen 30 Pf. für
die dreispaltige Petilzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse usw. an.
WITTENBERG DIE GEBURTSSTÄTTE DER
DEUTSCHEN RENAISSANCE?
Von Berthold Daun
(Schluß)
In den Kirchen Krakaus befinden sich einige her-
vorragende Grabplatten aus Erz. Vergleicht man den
Stil ihrer Zeichnung und die eingravierten Brokat-
muster mit den in Deutschland befindlichen Vischer-
platten, so erkennt man in diesen unbezeichneten Erz-
tafeln einige der schönsten Güsse Vischers. Sie
rechtfertigen die Glaubwürdigkeit des Neudörfferschen
Berichtes, daß Peter Vischer große Gußwerke nach
Polen, Böhmen und Ungarn geliefert habe. In fünf
dieser Krakauer Platten wird ein kräftiger Schritt zur
Renaissance bemerkbar, wenn freilich noch hier und
da gotische Ornament- und Architekturformen mit ita-
lienischen Dekorationsmotiven vermischt sind. Statt
des gotischen Baldachins oder Geästes wird auf der
Erztafel für Peter Salomon (| 1506) und für Kmita
(t 15°5) die obere Umrahmung durch einen Dreipaß
gebildet, der in allmählich sich entwickelnder Form
wechselt. Ein wie ein mißverstandener griechischer
Eierstab aussehender Ornamentkranz füllt auf der
Tafel Peter Salomons den dreigeteilten Bogen. Auf
der vermutlich wenig später entstandenen Kmita-Tafel,
deren stückweise gegossene Seitenleisten in den unter
Baldachinen stehenden Aposteln Paulus und Petrus
und in den umrankten baumartigen Säulen gotische
Reminiszenzen aufweisen, nimmt der Dreipaß mehr
das Aussehen eines Blattkranzes an, bis darauf auf
der Callimachus-Tafeli) in der Dominikanerkirche zu
Krakau ein prachtvolles Laubgewinde mit Früchten, das
durch Bänder zusammengehalten wird, entstanden ist.
Ferner reiht sich den Arbeiten dieser Hand eine bis-
her unbekannt gebliebene prachtvolle ziselierte Grab-
tafel für ein unbekanntes Glied der Familie Salomon
an, deren Entstehung zwischen den Grabmälern für
Kardinal Friedrich Kasimir und für Peter Salomon
zu setzen sein mag, weil hier wie auf dem urkund-
lich 1504 datierten Grabmal der Herzogin Sophie in
Torgau die obere Umrahmung aus Rankenwerk sich
findet. Die Zeichnung der freistehenden Salomonfigur
1) Die Komposition der inneren Tafel mit der sitzen-
den Gestalt des Cailimachus stammt von Veit Stoß, vgl.
Daun, Veit Stoß und seine Schule in Deutschland, Polen
und Ungarn, p. 34—37.
und der perspektivisch vertiefte Fußboden sind meister-
haft gezeichnet und bekunden die freiere Auffassung
von Renaissancefiguren. Als weitere renaissancemäßige
Grabtafel Peter Vischers muß ich das in der Dom-
kirche auf dem Wawel befindliche ziselierte Brustbild
eines unbekannten Kardinals ausgeben. Der Brokat-
teppisch der früheren Tafel ist verschwunden, und
der Kardinal ist vor einer etwas perspektivisch ver-
tieften Renaissancebogenhalle stehend gedacht. Die
Blattranken und Pilasterornamente sind im Renaissance-
stil frei entwickelt. Ebenfalls halte ich die im Kreuz-
gang des Domes zu Erfurt befindliche Grabplatte des
Kantors und Kanonikus Johann von Heringen, ein in
Metall tief graviertes Brustbild von 15051), für eine
ausgezeichnete Vischerarbeit, die vor der zuletzt ge-
nannten Krakauer Bronzeplatte entstanden ist und sich
in dem gotischen Rankenwerk dem Torgauer und
dem Salomon-Guß anschließt. Die Zeichnung ist vor-
trefflich.
In diesen Krakauer Tafeln tritt bereits Renaissance-
dekoration auf, die zunächst noch mit nordischem
Empfinden vermischt ist, allmählig aber italienisch
reiner wird. Die Vermutung Seegers, daß der Alt-
meister erst durch seinen Sohn Peter, der 1507 in
Oberitalien weilte und 15082) nach Nürnberg zurück-
kehrte, mit der italienischen Dekorationsart bekannt
geworden sei, trifft demnach keineswegs zu. Schon
vorher also sind dem Vater die neuen Kunstformen
zu Gesicht gekommen und haben sich ihm als nach-
ahmungswürdige Muster aufgedrängt. Eine Italien-
reise des Vaters deshalb anzunehmen, ist jedoch nicht
notwendig; nein, wie beim jungen Dürer sprechen
die ersten Versuche offen dagegen, denn direktes
Studium der italienischen Werke an Ort und Stelle
setzen sie nicht voraus. Gerade die in noch dürftiger
1) Abgebildet im Katalog der kunstgeschichtlichen
Ausstellung zu Erfurt und unter Nr. 274 als nürnbergische
Arbeit von 1505 aufgeführt.
2) Georg Seeger, Peter Vischer d. j., Leipzig 1897.
Daß Peter Vischer d. j. in Italien gewesen war, ist dem
Stil und Art seiner Werke nach so gut wie sicher. Ob
er aber mit jenem Peter Vischer identisch ist, der um das
Jahr 1508 zum Vertriebe der Schedeischen Weltchronik
nach Oberitalien reist, ist von Seeger nicht bewiesen. Man
könnte auch nach A. Bauch an den Buchdrucker Peter
Vischer denken (Mitt. des Ver. f. Gesch. d. Stadt Nürn-
berg, XII, S. 290ff.).