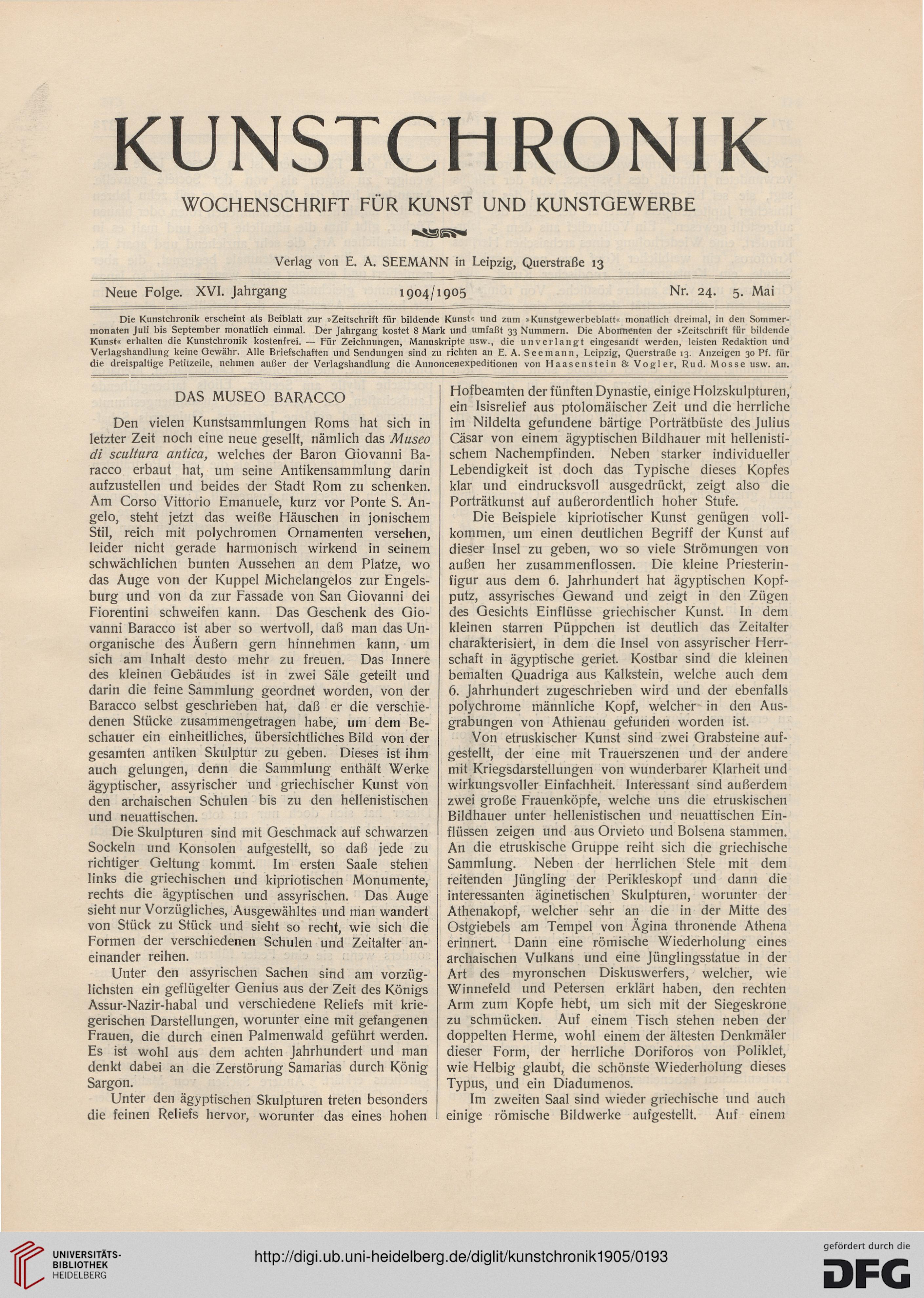KUNSTCHRONIK
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig, Querstraße 13
Neue Folge. XVI. Jahrgang 1904/1905 Nr. 24. 5. Mai
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur »Zeitschrift für bildende Kunst« und zum »Kunstgewerbeblatt« monatlich dreimal, in den Sommer-
monaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfaßt 33 Nummern. Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende
Kunst« erhalten die Kunstchronik kostenfrei. — Für Zeichnungen, Manuskripte usw., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und
Verlagshandlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Leipzig, Querstraße 13. Anzeigen 30 Pf. für
die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse usw. an.
DAS MUSEO BARACCO
Den vielen Kunstsammlungen Roms hat sich in
letzter Zeit noch eine neue gesellt, nämlich das Museo
di scaltura antica, welches der Baron Giovanni Ba-
racco erbaut hat, um seine Antikensammlung darin
aufzustellen und beides der Stadt Rom zu schenken.
Am Corso Vittorio Emanuele, kurz vor Ponte S. An-
gelo, steht j'etzt das weiße Häuschen in jonischem
Stil, reich mit polychromen Ornamenten versehen,
leider nicht gerade harmonisch wirkend in seinem
schwächlichen bunten Aussehen an dem Platze, wo
das Auge von der Kuppel Michelangelos zur Engels-
burg und von da zur Fassade von San Giovanni dei
Fiorentini schweifen kann. Das Geschenk des Gio-
vanni Baracco ist aber so wertvoll, daß man das Un-
organische des Äußern gern hinnehmen kann, um
sich am Inhalt desto mehr zu freuen. Das Innere
des kleinen Gebäudes ist in zwei Säle geteilt und
darin die feine Sammlung geordnet worden, von der
Baracco selbst geschrieben hat, daß er die verschie-
denen Stücke zusammengetragen habe, um dem Be-
schauer ein einheitliches, übersichtliches Bild von der
gesamten antiken Skulptur zu geben. Dieses ist ihm
auch gelungen, denn die Sammlung enthält Werke
ägyptischer, assyrischer und griechischer Kunst von
den archaischen Schulen bis zu den hellenistischen
und neuattischen.
Die Skulpturen sind mit Geschmack auf schwarzen
Sockeln und Konsolen aufgestellt, so daß jede zu
richtiger Geltung kommt. Im ersten Saale stehen
links die griechischen und kipriotischen Monumente,
rechts die ägyptischen und assyrischen. Das Auge
sieht nur Vorzügliches, Ausgewähltes und man wandert
von Stück zu Stück und sieht so recht, wie sich die
Formen der verschiedenen Schulen und Zeitalter an-
einander reihen.
Unter den assyrischen Sachen sind am vorzüg-
lichsten ein geflügelter Genius aus der Zeit des Königs
Assur-Nazir-habal und verschiedene Reliefs mit krie-
gerischen Darstellungen, worunter eine mit gefangenen
Frauen, die durch einen Palmenwald geführt werden.
Es ist wohl aus dem achten Jahrhundert und man
denkt dabei an die Zerstörung Samarias durch König
Sargon.
Unter den ägyptischen Skulpturen treten besonders
die feinen Reliefs hervor, worunter das eines hohen
Hofbeamten der fünften Dynastie, einige Holzskulpturen,
ein Isisrelief aus ptolomäischer Zeit und die herrliche
im Nildelta gefundene bärtige Porträtbüste des Julius
Cäsar von einem ägyptischen Bildhauer mit hellenisti-
schem Nachempfinden. Neben starker individueller
Lebendigkeit ist doch das Typische dieses Kopfes
klar und eindrucksvoll ausgedrückt, zeigt also die
Porträtkunst auf außerordentlich hoher Stufe.
Die Beispiele kipriotischer Kunst genügen voll-
kommen, um einen deutlichen Begriff der Kunst auf
dieser Insel zu geben, wo so viele Strömungen von
außen her zusammenflössen. Die kleine Priesterin-
figur aus dem 6. Jahrhundert hat ägyptischen Kopf-
putz, assyrisches Gewand und zeigt in den Zügen
des Gesichts Einflüsse griechischer Kunst. In dem
kleinen starren Püppchen ist deutlich das Zeitalter
charakterisiert, in dem die Insel von assyrischer Herr-
schaft in ägyptische geriet. Kostbar sind die kleinen
bemalten Quadriga aus Kalkstein, welche auch dem
6. Jahrhundert zugeschrieben wird und der ebenfalls
polychrome männliche Kopf, welcher in den Aus-
grabungen von Athienau gefunden worden ist.
Von etruskischer Kunst sind zwei Grabsteine auf-
gestellt, der eine mit Trauerszenen und der andere
mit Kriegsdarstellungen von wunderbarer Klarheit und
wirkungsvoller Einfachheit. Interessant sind außerdem
zwei große Frauenköpfe, welche uns die etruskischen
Bildhauer unter hellenistischen und neuattischen Ein-
flüssen zeigen und aus Orvieto und Bolsena stammen.
An die etruskische Gruppe reiht sich die griechische
Sammlung. Neben der herrlichen Stele mit dem
reitenden Jüngling der Perikleskopf und dann die
interessanten äginetischen Skulpturen, worunter der
Athenakopf, welcher sehr an die in der Mitte des
Ostgiebels am Tempel von Ägina thronende Athena
erinnert. Dann eine römische Wiederholung eines
archaischen Vulkans und eine Jünglingsstatue in der
Art des myronschen Diskuswerfers, welcher, wie
Winnefeld und Petersen erklärt haben, den rechten
Arm zum Kopfe hebt, um sich mit der Siegeskrone
zu schmücken. Auf einem Tisch stehen neben der
doppelten Herme, wohl einem der ältesten Denkmäler
dieser Form, der herrliche Doriforos von Poliklet,
wie Heibig glaubt, die schönste Wiederholung dieses
Typus, und ein Diadumenos.
Im zweiten Saal sind wieder griechische und auch
einige römische Bildwerke aufgestellt. Auf einem
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig, Querstraße 13
Neue Folge. XVI. Jahrgang 1904/1905 Nr. 24. 5. Mai
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur »Zeitschrift für bildende Kunst« und zum »Kunstgewerbeblatt« monatlich dreimal, in den Sommer-
monaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfaßt 33 Nummern. Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende
Kunst« erhalten die Kunstchronik kostenfrei. — Für Zeichnungen, Manuskripte usw., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und
Verlagshandlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Leipzig, Querstraße 13. Anzeigen 30 Pf. für
die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse usw. an.
DAS MUSEO BARACCO
Den vielen Kunstsammlungen Roms hat sich in
letzter Zeit noch eine neue gesellt, nämlich das Museo
di scaltura antica, welches der Baron Giovanni Ba-
racco erbaut hat, um seine Antikensammlung darin
aufzustellen und beides der Stadt Rom zu schenken.
Am Corso Vittorio Emanuele, kurz vor Ponte S. An-
gelo, steht j'etzt das weiße Häuschen in jonischem
Stil, reich mit polychromen Ornamenten versehen,
leider nicht gerade harmonisch wirkend in seinem
schwächlichen bunten Aussehen an dem Platze, wo
das Auge von der Kuppel Michelangelos zur Engels-
burg und von da zur Fassade von San Giovanni dei
Fiorentini schweifen kann. Das Geschenk des Gio-
vanni Baracco ist aber so wertvoll, daß man das Un-
organische des Äußern gern hinnehmen kann, um
sich am Inhalt desto mehr zu freuen. Das Innere
des kleinen Gebäudes ist in zwei Säle geteilt und
darin die feine Sammlung geordnet worden, von der
Baracco selbst geschrieben hat, daß er die verschie-
denen Stücke zusammengetragen habe, um dem Be-
schauer ein einheitliches, übersichtliches Bild von der
gesamten antiken Skulptur zu geben. Dieses ist ihm
auch gelungen, denn die Sammlung enthält Werke
ägyptischer, assyrischer und griechischer Kunst von
den archaischen Schulen bis zu den hellenistischen
und neuattischen.
Die Skulpturen sind mit Geschmack auf schwarzen
Sockeln und Konsolen aufgestellt, so daß jede zu
richtiger Geltung kommt. Im ersten Saale stehen
links die griechischen und kipriotischen Monumente,
rechts die ägyptischen und assyrischen. Das Auge
sieht nur Vorzügliches, Ausgewähltes und man wandert
von Stück zu Stück und sieht so recht, wie sich die
Formen der verschiedenen Schulen und Zeitalter an-
einander reihen.
Unter den assyrischen Sachen sind am vorzüg-
lichsten ein geflügelter Genius aus der Zeit des Königs
Assur-Nazir-habal und verschiedene Reliefs mit krie-
gerischen Darstellungen, worunter eine mit gefangenen
Frauen, die durch einen Palmenwald geführt werden.
Es ist wohl aus dem achten Jahrhundert und man
denkt dabei an die Zerstörung Samarias durch König
Sargon.
Unter den ägyptischen Skulpturen treten besonders
die feinen Reliefs hervor, worunter das eines hohen
Hofbeamten der fünften Dynastie, einige Holzskulpturen,
ein Isisrelief aus ptolomäischer Zeit und die herrliche
im Nildelta gefundene bärtige Porträtbüste des Julius
Cäsar von einem ägyptischen Bildhauer mit hellenisti-
schem Nachempfinden. Neben starker individueller
Lebendigkeit ist doch das Typische dieses Kopfes
klar und eindrucksvoll ausgedrückt, zeigt also die
Porträtkunst auf außerordentlich hoher Stufe.
Die Beispiele kipriotischer Kunst genügen voll-
kommen, um einen deutlichen Begriff der Kunst auf
dieser Insel zu geben, wo so viele Strömungen von
außen her zusammenflössen. Die kleine Priesterin-
figur aus dem 6. Jahrhundert hat ägyptischen Kopf-
putz, assyrisches Gewand und zeigt in den Zügen
des Gesichts Einflüsse griechischer Kunst. In dem
kleinen starren Püppchen ist deutlich das Zeitalter
charakterisiert, in dem die Insel von assyrischer Herr-
schaft in ägyptische geriet. Kostbar sind die kleinen
bemalten Quadriga aus Kalkstein, welche auch dem
6. Jahrhundert zugeschrieben wird und der ebenfalls
polychrome männliche Kopf, welcher in den Aus-
grabungen von Athienau gefunden worden ist.
Von etruskischer Kunst sind zwei Grabsteine auf-
gestellt, der eine mit Trauerszenen und der andere
mit Kriegsdarstellungen von wunderbarer Klarheit und
wirkungsvoller Einfachheit. Interessant sind außerdem
zwei große Frauenköpfe, welche uns die etruskischen
Bildhauer unter hellenistischen und neuattischen Ein-
flüssen zeigen und aus Orvieto und Bolsena stammen.
An die etruskische Gruppe reiht sich die griechische
Sammlung. Neben der herrlichen Stele mit dem
reitenden Jüngling der Perikleskopf und dann die
interessanten äginetischen Skulpturen, worunter der
Athenakopf, welcher sehr an die in der Mitte des
Ostgiebels am Tempel von Ägina thronende Athena
erinnert. Dann eine römische Wiederholung eines
archaischen Vulkans und eine Jünglingsstatue in der
Art des myronschen Diskuswerfers, welcher, wie
Winnefeld und Petersen erklärt haben, den rechten
Arm zum Kopfe hebt, um sich mit der Siegeskrone
zu schmücken. Auf einem Tisch stehen neben der
doppelten Herme, wohl einem der ältesten Denkmäler
dieser Form, der herrliche Doriforos von Poliklet,
wie Heibig glaubt, die schönste Wiederholung dieses
Typus, und ein Diadumenos.
Im zweiten Saal sind wieder griechische und auch
einige römische Bildwerke aufgestellt. Auf einem