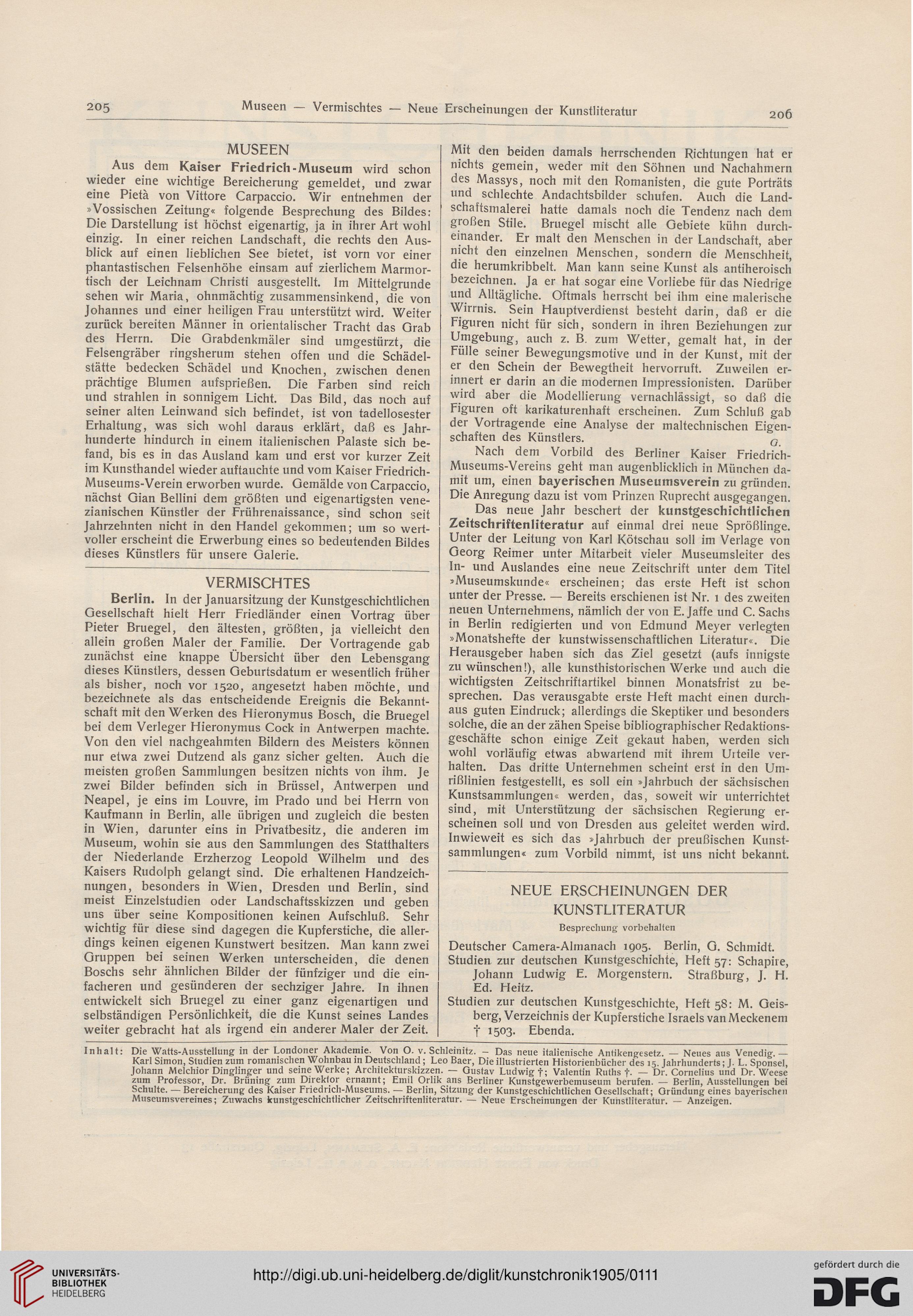205
Museen — Vermischtes — Neue
Erscheinungen der Kunstliteratur
206
MUSEEN
Aus dem Kaiser Friedrich-Museum wird schon
wieder eine wichtige Bereicherung gemeldet, und zwar
eine Pietä von Vittore Carpaccio. Wir entnehmen der
»Vossischen Zeitung« folgende Besprechung des Bildes:
Die Darstellung ist höchst eigenartig, ja in ihrer Art wohl
einzig. In einer reichen Landschaft, die rechts den Aus-
blick auf einen lieblichen See bietet, ist vorn vor einer
phantastischen Felsenhöhe einsam auf zierlichem Marmor-
tisch der Leichnam Christi ausgestellt. Im Mittelgrunde
sehen wir Maria, ohnmächtig zusammensinkend, die von
Johannes und einer heiligen Frau unterstützt wird. Weiter
zurück bereiten Männer in orientalischer Tracht das Grab
des Herrn. Die Grabdenkmäler sind umgestürzt, die
Felsengräber ringsherum stehen offen und die Schädel-
stätte bedecken Schädel und Knochen, zwischen denen
prächtige Blumen aufsprießen. Die Farben sind reich
und strahlen in sonnigem Licht. Das Bild, das noch auf
seiner alten Leinwand sich befindet, ist von tadellosester
Erhaltung, was sich wohl daraus erklärt, daß es Jahr-
hunderte hindurch in einem italienischen Palaste sich be-
fand, bis es in das Ausland kam und erst vor kurzer Zeit
im Kunsthandel wieder auftauchte und vom Kaiser Friedrich-
Museums-Verein erworben wurde. Gemälde von Carpaccio,
nächst Gian Bellini dem größten und eigenartigsten vene-
zianischen Künstler der Frührenaissance, sind schon seit
Jahrzehnten nicht in den Handel gekommen; um so wert-
voller erscheint die Erwerbung eines so bedeutenden Bildes
dieses Künstlers für unsere Galerie.
VERMISCHTES
Berlin. In der Januarsitzung der Kunstgeschichtlichen
Gesellschaft hielt Herr Friedländer einen Vortrag über
Pieter Bruegel, den ältesten, größten, ja vielleicht den
allein großen Maler der Familie. Der Vortragende gab
zunächst eine knappe Übersicht über den Lebensgang
dieses Künstlers, dessen Geburtsdatum er wesentlich früher
als bisher, noch vor 1520, angesetzt haben möchte, und
bezeichnete als das entscheidende Ereignis die Bekannt-
schaft mit den Werken des Hieronymus Bosch, die Bruegel
bei dem Verleger Hieronymus Cock in Antwerpen machte.
Von den viel nachgeahmten Bildern des Meisters können
nur etwa zwei Dutzend als ganz sicher gelten. Auch die
meisten großen Sammlungen besitzen nichts von ihm. Je
zwei Bilder befinden sich in Brüssel, Antwerpen und
Neapel, je eins im Louvre, im Prado und bei Herrn von
Kaufmann in Berlin, alle übrigen und zugleich die besten
in Wien, darunter eins in Privatbesitz, die anderen im
Museum, wohin sie aus den Sammlungen des Statthalters
der Niederlande Erzherzog Leopold Wilhelm und des
Kaisers Rudolph gelangt sind. Die erhaltenen Handzeich-
nungen, besonders in Wien, Dresden und Berlin, sind
meist Einzelstudien oder Landschaftsskizzen und geben
uns über seine Kompositionen keinen Aufschluß. Sehr
wichtig für diese sind dagegen die Kupferstiche, die aller-
dings keinen eigenen Kunstwert besitzen. Man kann zwei
Gruppen bei seinen Werken unterscheiden, die denen
Boschs sehr ähnlichen Bilder der fünfziger und die ein-
facheren und gesünderen der sechziger Jahre. In ihnen
entwickelt sich Bruegel zu einer ganz eigenartigen und
selbständigen Persönlichkeit, die die Kunst seines Landes
weiter gebracht hat als irgend ein anderer Maler der Zeit.
Mit den beiden damals herrschenden Richtungen hat er
nichts gemein, weder mit den Söhnen und Nachahmern
des Massys, noch mit den Romanisten, die gute Porträts
und schlechte Andachtsbilder schufen. Auch die Land-
schaftsmalerei hatte damals noch die Tendenz nach dem
großen Stile. Bruegel mischt alle Gebiete kühn durch-
einander. Er malt den Menschen in der Landschaft, aber
nicht den einzelnen Menschen, sondern die Menschheit,
die herumkribbelt. Man kann seine Kunst als antiheroisch
bezeichnen. Ja er hat sogar eine Vorliebe für das Niedrige
und Alltägliche. Oftmals herrscht bei ihm eine malerische
Wirrnis. Sein Hauptverdienst besteht darin, daß er die
Figuren nicht für sich, sondern in ihren Beziehungen zur
Umgebung, auch z. B. zum Wetter, gemalt hat, in der
Fülle seiner Bewegungsmotive und in der Kunst, mit der
er den Schein der Bewegtheit hervorruft. Zuweilen er-
innert er darin an die modernen Impressionisten. Darüber
wird aber die Modellierung vernachlässigt, so daß die
Figuren oft karikaturenhaft erscheinen. Zum Schluß gab
der Vortragende eine Analyse der maltechnischen Eigen-
schaften des Künstlers. q.
Nach dem Vorbild des Berliner Kaiser Friedrich-
Museums-Vereins geht man augenblicklich in München da-
mit um, einen bayerischen Museumsverein zu gründen.
Die Anregung dazu ist vom Prinzen Ruprecht ausgegangen.
Das neue Jahr beschert der kunstgeschichtlichen
Zeitschriftenliteratur auf einmal drei neue Sprößlinge.
Unter der Leitung von Karl Kötschau soll im Verlage von
Georg Reimer unter Mitarbeit vieler Museumsleiter des
In- und Auslandes eine neue Zeitschrift unter dem Titel
> Museumskunde« erscheinen; das erste Heft ist schon
unter der Presse. — Bereits erschienen ist Nr. 1 des zweiten
neuen Unternehmens, nämlich der von E. Jaffe und C. Sachs
in Berlin redigierten und von Edmund Meyer verlegten
»Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur«. Die
Herausgeber haben sich das Ziel gesetzt (aufs innigste
zu wünschen!), alle kunsthistorischen Werke und auch die
wichtigsten Zeitschriftartikel binnen Monatsfrist zu be-
sprechen. Das verausgabte erste Heft macht einen durch-
aus guten Eindruck; allerdings die Skeptiker und besonders
solche, die an der zähen Speise bibliographischer Redaktions-
geschäfte schon einige Zeit gekaut haben, werden sich
wohl vorläufig etwas abwartend mit ihrem Urteile ver-
halten. Das dritte Unternehmen scheint erst in den Um-
rißlinien festgestellt, es soll ein »Jahrbuch der sächsischen
Kunstsammlungen« werden, das, soweit wir unterrichtet
sind, mit Unterstützung der sächsischen Regierung er-
scheinen soll und von Dresden aus geleitet werden wird.
Inwieweit es sich das >Jahrbuch der preußischen Kunst-
sammlungen« zum Vorbild nimmt, ist uns nicht bekannt.
NEUE ERSCHEINUNGEN DER
KUNSTLITERATUR
Besprechung vorbehalten
Deutscher Camera-Almanach 1905. Berlin, G. Schmidt.
Studien zur deutschen Kunstgeschichte, Heft 57: Schapiie,
Johann Ludwig E. Morgenstern. Straßburg, J. H.
Ed. Heitz.
Studien zur deutschen Kunstgeschichte, Heft 58: M. Geis-
berg, Verzeichnis der Kupferstiche Israels van Meckenem
t 1503. Ebenda.
Inhalt: Die Watts-Ausstellung in der Londoner Akademie. Von O. v. Schleinitz. - Das neue italienische Antikengesetz. — Neues aus Venedig. —
Karl Simon, Studien zum romanischen Wohnbau in Deutschland ; Leo Baer, Die illustrierten Historienbücher des 15. Jahrhunderts; J- L. Sponsel,
Johann Melchior Dinglinger und seine Werke; Archilekturskizzen. — Gustav Ludwig t; Valentin Ruths f- — Dr. Cornelius und Dr. Weese
zum Professor, Dr. Brüning zum Direktor ernannt; Emil Orlik ans Berliner Kunstgewerbemuseum berufen. — Berlin, Ausstellungen bei
Schulte. — Bereicherung des Kaiser Friedrich-Museums. — Berlin, Sitzung der Kunstgeschichtlichen Oesellschaft; Oründung eines bayerischen
Museumsvereines; Zuwachs kunstgeschichtlicher Zeitschriftenliteratur. — Neue Erscheinungen der Kunstliteratur. — Anzeigen.
Museen — Vermischtes — Neue
Erscheinungen der Kunstliteratur
206
MUSEEN
Aus dem Kaiser Friedrich-Museum wird schon
wieder eine wichtige Bereicherung gemeldet, und zwar
eine Pietä von Vittore Carpaccio. Wir entnehmen der
»Vossischen Zeitung« folgende Besprechung des Bildes:
Die Darstellung ist höchst eigenartig, ja in ihrer Art wohl
einzig. In einer reichen Landschaft, die rechts den Aus-
blick auf einen lieblichen See bietet, ist vorn vor einer
phantastischen Felsenhöhe einsam auf zierlichem Marmor-
tisch der Leichnam Christi ausgestellt. Im Mittelgrunde
sehen wir Maria, ohnmächtig zusammensinkend, die von
Johannes und einer heiligen Frau unterstützt wird. Weiter
zurück bereiten Männer in orientalischer Tracht das Grab
des Herrn. Die Grabdenkmäler sind umgestürzt, die
Felsengräber ringsherum stehen offen und die Schädel-
stätte bedecken Schädel und Knochen, zwischen denen
prächtige Blumen aufsprießen. Die Farben sind reich
und strahlen in sonnigem Licht. Das Bild, das noch auf
seiner alten Leinwand sich befindet, ist von tadellosester
Erhaltung, was sich wohl daraus erklärt, daß es Jahr-
hunderte hindurch in einem italienischen Palaste sich be-
fand, bis es in das Ausland kam und erst vor kurzer Zeit
im Kunsthandel wieder auftauchte und vom Kaiser Friedrich-
Museums-Verein erworben wurde. Gemälde von Carpaccio,
nächst Gian Bellini dem größten und eigenartigsten vene-
zianischen Künstler der Frührenaissance, sind schon seit
Jahrzehnten nicht in den Handel gekommen; um so wert-
voller erscheint die Erwerbung eines so bedeutenden Bildes
dieses Künstlers für unsere Galerie.
VERMISCHTES
Berlin. In der Januarsitzung der Kunstgeschichtlichen
Gesellschaft hielt Herr Friedländer einen Vortrag über
Pieter Bruegel, den ältesten, größten, ja vielleicht den
allein großen Maler der Familie. Der Vortragende gab
zunächst eine knappe Übersicht über den Lebensgang
dieses Künstlers, dessen Geburtsdatum er wesentlich früher
als bisher, noch vor 1520, angesetzt haben möchte, und
bezeichnete als das entscheidende Ereignis die Bekannt-
schaft mit den Werken des Hieronymus Bosch, die Bruegel
bei dem Verleger Hieronymus Cock in Antwerpen machte.
Von den viel nachgeahmten Bildern des Meisters können
nur etwa zwei Dutzend als ganz sicher gelten. Auch die
meisten großen Sammlungen besitzen nichts von ihm. Je
zwei Bilder befinden sich in Brüssel, Antwerpen und
Neapel, je eins im Louvre, im Prado und bei Herrn von
Kaufmann in Berlin, alle übrigen und zugleich die besten
in Wien, darunter eins in Privatbesitz, die anderen im
Museum, wohin sie aus den Sammlungen des Statthalters
der Niederlande Erzherzog Leopold Wilhelm und des
Kaisers Rudolph gelangt sind. Die erhaltenen Handzeich-
nungen, besonders in Wien, Dresden und Berlin, sind
meist Einzelstudien oder Landschaftsskizzen und geben
uns über seine Kompositionen keinen Aufschluß. Sehr
wichtig für diese sind dagegen die Kupferstiche, die aller-
dings keinen eigenen Kunstwert besitzen. Man kann zwei
Gruppen bei seinen Werken unterscheiden, die denen
Boschs sehr ähnlichen Bilder der fünfziger und die ein-
facheren und gesünderen der sechziger Jahre. In ihnen
entwickelt sich Bruegel zu einer ganz eigenartigen und
selbständigen Persönlichkeit, die die Kunst seines Landes
weiter gebracht hat als irgend ein anderer Maler der Zeit.
Mit den beiden damals herrschenden Richtungen hat er
nichts gemein, weder mit den Söhnen und Nachahmern
des Massys, noch mit den Romanisten, die gute Porträts
und schlechte Andachtsbilder schufen. Auch die Land-
schaftsmalerei hatte damals noch die Tendenz nach dem
großen Stile. Bruegel mischt alle Gebiete kühn durch-
einander. Er malt den Menschen in der Landschaft, aber
nicht den einzelnen Menschen, sondern die Menschheit,
die herumkribbelt. Man kann seine Kunst als antiheroisch
bezeichnen. Ja er hat sogar eine Vorliebe für das Niedrige
und Alltägliche. Oftmals herrscht bei ihm eine malerische
Wirrnis. Sein Hauptverdienst besteht darin, daß er die
Figuren nicht für sich, sondern in ihren Beziehungen zur
Umgebung, auch z. B. zum Wetter, gemalt hat, in der
Fülle seiner Bewegungsmotive und in der Kunst, mit der
er den Schein der Bewegtheit hervorruft. Zuweilen er-
innert er darin an die modernen Impressionisten. Darüber
wird aber die Modellierung vernachlässigt, so daß die
Figuren oft karikaturenhaft erscheinen. Zum Schluß gab
der Vortragende eine Analyse der maltechnischen Eigen-
schaften des Künstlers. q.
Nach dem Vorbild des Berliner Kaiser Friedrich-
Museums-Vereins geht man augenblicklich in München da-
mit um, einen bayerischen Museumsverein zu gründen.
Die Anregung dazu ist vom Prinzen Ruprecht ausgegangen.
Das neue Jahr beschert der kunstgeschichtlichen
Zeitschriftenliteratur auf einmal drei neue Sprößlinge.
Unter der Leitung von Karl Kötschau soll im Verlage von
Georg Reimer unter Mitarbeit vieler Museumsleiter des
In- und Auslandes eine neue Zeitschrift unter dem Titel
> Museumskunde« erscheinen; das erste Heft ist schon
unter der Presse. — Bereits erschienen ist Nr. 1 des zweiten
neuen Unternehmens, nämlich der von E. Jaffe und C. Sachs
in Berlin redigierten und von Edmund Meyer verlegten
»Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur«. Die
Herausgeber haben sich das Ziel gesetzt (aufs innigste
zu wünschen!), alle kunsthistorischen Werke und auch die
wichtigsten Zeitschriftartikel binnen Monatsfrist zu be-
sprechen. Das verausgabte erste Heft macht einen durch-
aus guten Eindruck; allerdings die Skeptiker und besonders
solche, die an der zähen Speise bibliographischer Redaktions-
geschäfte schon einige Zeit gekaut haben, werden sich
wohl vorläufig etwas abwartend mit ihrem Urteile ver-
halten. Das dritte Unternehmen scheint erst in den Um-
rißlinien festgestellt, es soll ein »Jahrbuch der sächsischen
Kunstsammlungen« werden, das, soweit wir unterrichtet
sind, mit Unterstützung der sächsischen Regierung er-
scheinen soll und von Dresden aus geleitet werden wird.
Inwieweit es sich das >Jahrbuch der preußischen Kunst-
sammlungen« zum Vorbild nimmt, ist uns nicht bekannt.
NEUE ERSCHEINUNGEN DER
KUNSTLITERATUR
Besprechung vorbehalten
Deutscher Camera-Almanach 1905. Berlin, G. Schmidt.
Studien zur deutschen Kunstgeschichte, Heft 57: Schapiie,
Johann Ludwig E. Morgenstern. Straßburg, J. H.
Ed. Heitz.
Studien zur deutschen Kunstgeschichte, Heft 58: M. Geis-
berg, Verzeichnis der Kupferstiche Israels van Meckenem
t 1503. Ebenda.
Inhalt: Die Watts-Ausstellung in der Londoner Akademie. Von O. v. Schleinitz. - Das neue italienische Antikengesetz. — Neues aus Venedig. —
Karl Simon, Studien zum romanischen Wohnbau in Deutschland ; Leo Baer, Die illustrierten Historienbücher des 15. Jahrhunderts; J- L. Sponsel,
Johann Melchior Dinglinger und seine Werke; Archilekturskizzen. — Gustav Ludwig t; Valentin Ruths f- — Dr. Cornelius und Dr. Weese
zum Professor, Dr. Brüning zum Direktor ernannt; Emil Orlik ans Berliner Kunstgewerbemuseum berufen. — Berlin, Ausstellungen bei
Schulte. — Bereicherung des Kaiser Friedrich-Museums. — Berlin, Sitzung der Kunstgeschichtlichen Oesellschaft; Oründung eines bayerischen
Museumsvereines; Zuwachs kunstgeschichtlicher Zeitschriftenliteratur. — Neue Erscheinungen der Kunstliteratur. — Anzeigen.