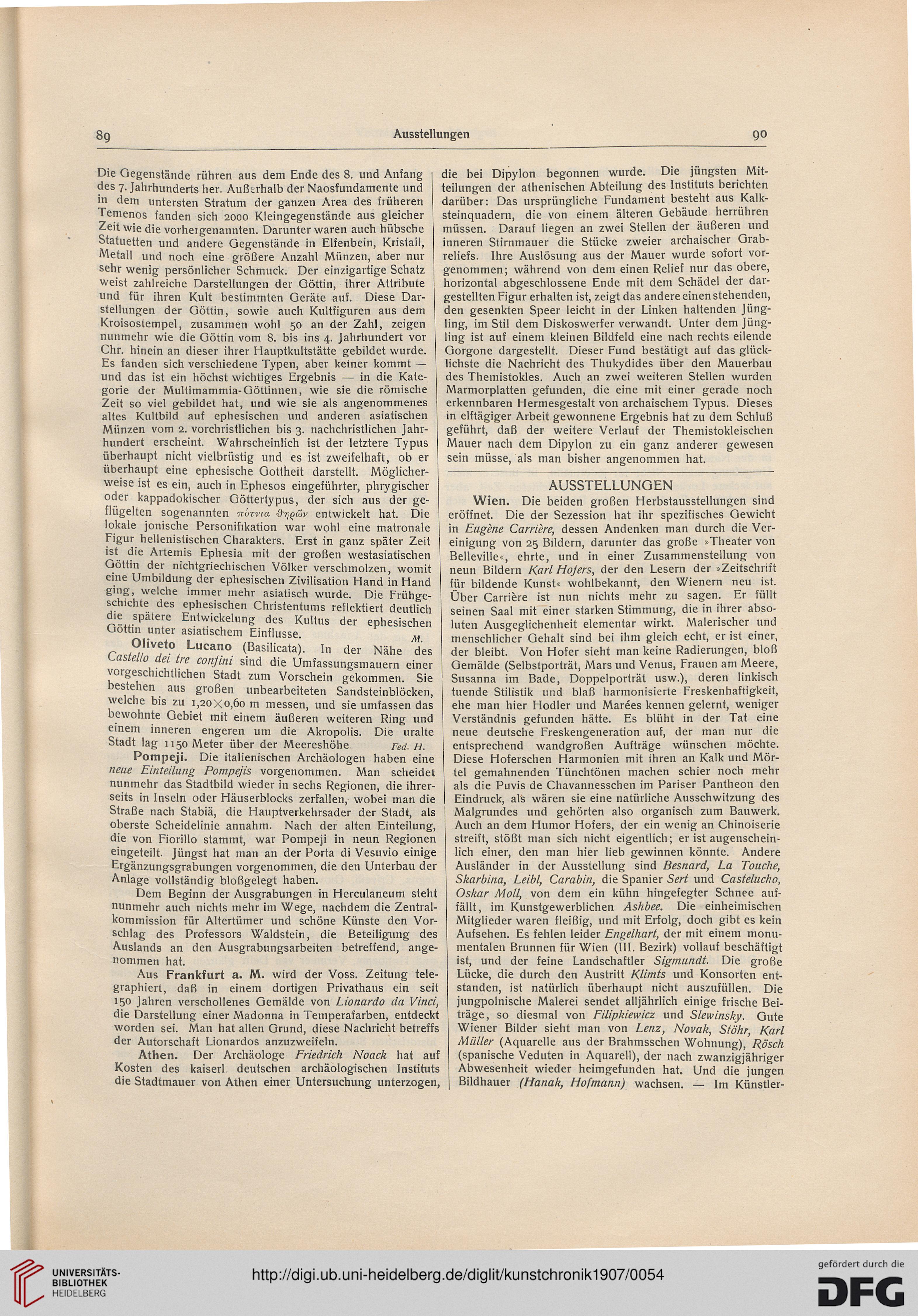8g
Ausstellungen
90
Die Gegenstände rühren aus dem Ende des 8. und Anfang
des 7. Jahrhunderts her. Außerhalb der Naosfundamente und
in dem untersten Stratum der ganzen Area des früheren
Temenos fanden sich 2000 Kleingegenstände aus gleicher
Zeit wie die vorhergenannten. Darunter waren auch hübsche
Statuetten und andere Gegenstände in Elfenbein, Kristall,
Metall und noch eine größere Anzahl Münzen, aber nur
sehr wenig persönlicher Schmuck. Der einzigartige Schatz
weist zahlreiche Darstellungen der Göttin, ihrer Attribute
und für ihren Kult bestimmten Geräte auf. Diese Dar-
stellungen der Göttin, sowie auch Kultfiguren aus dem
Kroisostempel, zusammen wohl 50 an der Zahl, zeigen
nunmehr wie die Göttin vom 8. bis ins 4. Jahrhundert vor
Chr. hinein an dieser ihrer Hauptkultstätte gebildet wurde.
Es fanden sich verschiedene Typen, aber keiner kommt —
und das ist ein höchst wichtiges Ergebnis — in die Kate-
gorie der Multimammia-Göttinnen, wie sie die römische
Zeit so viel gebildet hat, und wie sie als angenommenes
altes Kultbild auf ephesischen und anderen asiatischen
Münzen vom 2. vorchristlichen bis 3. nachchristlichen Jahr-
hundert erscheint. Wahrscheinlich ist der letztere Typus
überhaupt nicht vielbrüstig und es ist zweifelhaft, ob er
überhaupt eine ephesische Gottheit darstellt. Möglicher-
weise ist es ein, auch in Ephesos eingeführter, phrygischer
oder kappadokischer Göttertypus, der sich aus der ge-
flügelten sogenannten irozvia {t^ojv entwickelt hat. Die
lokale jonische Personifikation war wohl eine mattonale
Figur hellenistischen Charakters. Erst in ganz später Zeit
ist die Artemis Ephesia mit der großen westasiatischen
Göttin der nichtgriechischen Völker verschmolzen, womit
eine Umbildung der ephesischen Zivilisation Hand in Hand
ging, welche immer mehr asiatisch wurde. Die Frühge-
schichte des ephesischen Christentums reflektiert deutlich
die spätere Entwickelung des Kultus der ephesischen
Gottin unter asiatischem Einflüsse. M
r„ /?/HV!t0. Lucan° (Basilic*ta). In der Nähe des
^astello dei tre confini sind die Umfassungsmauern einer
vorgeschichtlichen Stadt zum Vorschein gekommen. Sie
bestehen aus großen unbearbeiteten Sandsteinblöcken,
welche bis zu 1,20X0,60 m messen, und sie umfassen das
bewohnte Gebiet mit einem äußeren weiteren Ring und
einem inneren engeren um die Akropolis. Die uralte
Stadt lag 1150 Meter über der Meereshöhe Fed. h.
Pompeji. Die italienischen Archäologen haben eine
neue Einteilung Pompejis vorgenommen. Man scheidet
nunmehr das Stadtbild wieder in sechs Regionen, die ihrer-
seits in Inseln oder Häuserblocks zerfallen, wobei man die
Straße nach Stabiä, die Hauptverkehrsader der Stadt, als
oberste Scheidelinie annahm. Nach der alten Einteilung,
die von Fiorillo stammt, war Pompeji in neun Regionen
eingeteilt. Jüngst hat man an der Porta di Vesuvio einige
Ergänzungsgrabungen vorgenommen, die den Unterbau der
Anlage vollständig bloßgelegt haben.
Dem Beginn der Ausgrabungen in Herculaneum steht
nunmehr auch nichts mehr im Wege, nachdem die Zentral-
kommission für Altertümer und schöne Künste den Vor-
schlag des Professors Waldstein, die Beteiligung des
Auslands an den Ausgrabungsarbeiten betreffend, ange-
nommen hat.
Aus Frankfurt a. M. wird der Voss. Zeitung tele-
graphiert, daß in einem dortigen Privathaus ein seit
150 Jahren verschollenes Gemälde von Lionardo da Vinci,
die Darstellung einer Madonna in Temperafarben, entdeckt
worden sei. Man hat allen Grund, diese Nachricht betreffs
der Autorschaft Lionardos anzuzweifeln.
Athen. Der Archäologe Friedrich Noack hat auf
Kosten des kaiserl. deutschen archäologischen Instituts
die Stadtmauer von Athen einer Untersuchung unterzogen,
die bei Dipylon begonnen wurde. Die jüngsten Mit-
teilungen der athenischen Abteilung des Instituts berichten
darüber: Das ursprüngliche Fundament besteht aus Kalk-
steinquadern, die von einem älteren Gebäude herrühren
müssen. Darauf liegen an zwei Stellen der äußeren und
inneren Stirnmauer die Stücke zweier archaischer Grab-
reliefs. Ihre Auslösung aus der Mauer wurde sofort vor-
genommen; während von dem einen Relief nur das obere,
horizontal abgeschlossene Ende mit dem Schädel der dar-
gestellten Figur erhalten ist, zeigt das andere einen stehenden,
den gesenkten Speer leicht in der Linken haltenden Jüng-
ling, im Stil dem Diskoswerfer verwandt. Unter dem Jüng-
ling ist auf einem kleinen Bildfeld eine nach rechts eilende
Gorgone dargestellt. Dieser Fund bestätigt auf das glück-
lichste die Nachricht des Thukydides über den Mauerbau
des Themistokles. Auch an zwei weiteren Stellen wurden
Marmorplatten gefunden, die eine mit einer gerade noch
erkennbaren Hermesgestalt von archaischem Typus. Dieses
in elftägiger Arbeit gewonnene Ergebnis hat zu dem Schluß
geführt, daß der weitere Verlauf der Themistokleischen
Mauer nach dem Dipylon zu ein ganz anderer gewesen
sein müsse, als man bisher angenommen hat.
AUSSTELLUNGEN
Wien. Die beiden großen Herbstausstellungen sind
eröffnet. Die der Sezession hat ihr spezifisches Gewicht
in Eugene Carriire, dessen Andenken man durch die Ver-
einigung von 25 Bildern, darunter das große »Theater von
Belleville«, ehrte, und in einer Zusammenstellung von
neun Bildern Karl Mofers, der den Lesern der »Zeitschrift
für bildende Kunst« wohlbekannt, den Wienern neu ist.
Über Carriere ist nun nichts mehr zu sagen. Er füllt
seinen Saal mit einer starken Stimmung, die in ihrer abso-
luten Ausgeglichenheit elementar wirkt. Malerischer und
menschlicher Gehalt sind bei ihm gleich echt, er ist einer,
der bleibt. Von Hofer sieht man keine Radierungen, bloß
Gemälde (Selbstporträt, Mars und Venus, Frauen am Meere,
Susanna im Bade, Doppelporträt usw.), deren linkisch
tuende Stilistik und blaß harmonisierte Freskenhaftigkeit,
ehe man hier Hodler und Marees kennen gelernt, weniger
Verständnis gefunden hätte. Es blüht in der Tat eine
neue deutsche Freskengeneration auf, der man nur die
entsprechend wandgroßen Aufträge wünschen möchte.
Diese Hoferschen Harmonien mit ihren an Kalk und Mör-
tel gemahnenden Tünchtönen machen schier noch mehr
als die Puvis de Chavannesschen im Pariser Pantheon den
Eindruck, als wären sie eine natürliche Ausschwitzung des
Malgrundes und gehörten also organisch zum Bauwerk.
Auch an dem Humor Hofers, der ein wenig an Chinoiserie
streift, stößt man sich nicht eigentlich; er ist augenschein-
lich einer, den man hier lieb gewinnen könnte. Andere
Ausländer in der Ausstellung sind Besnard, La Touche,
Skarbina, Leibi, Carabin, die Spanier Sert und Castelucho,
Oskar Moll, von dem ein kühn hingefegter Schnee auf-
fällt, im Kunstgewerblichen Ashbee. Die einheimischen
Mitglieder waren fleißig, und mit Erfolg, doch gibt es kein
Aufsehen. Es fehlen leider Engelhart, der mit einem monu-
mentalen Brunnen für Wien (III. Bezirk) vollauf beschäftigt
ist, und der feine Landschaftler Sigmundt. Die große
Lücke, die durch den Austritt Klimts und Konsorten ent-
standen, ist natürlich überhaupt nicht auszufüllen. Die
jungpolnische Malerei sendet alljährlich einige frische Bei-
träge, so diesmal von Filipkiewicz und Slewinsky. Gute
Wiener Bilder sieht man von Lenz, Novak, Stöhr, Karl
Müller (Aquarelle aus der Brahmsschen Wohnung), Rösch
(spanische Veduten in Aquarell), der nach zwanzigjähriger
Abwesenheit wieder heimgefunden hat. Und die jungen
Bildhauer (Hanak, Hofmann) wachsen. — Im Künstler-
Ausstellungen
90
Die Gegenstände rühren aus dem Ende des 8. und Anfang
des 7. Jahrhunderts her. Außerhalb der Naosfundamente und
in dem untersten Stratum der ganzen Area des früheren
Temenos fanden sich 2000 Kleingegenstände aus gleicher
Zeit wie die vorhergenannten. Darunter waren auch hübsche
Statuetten und andere Gegenstände in Elfenbein, Kristall,
Metall und noch eine größere Anzahl Münzen, aber nur
sehr wenig persönlicher Schmuck. Der einzigartige Schatz
weist zahlreiche Darstellungen der Göttin, ihrer Attribute
und für ihren Kult bestimmten Geräte auf. Diese Dar-
stellungen der Göttin, sowie auch Kultfiguren aus dem
Kroisostempel, zusammen wohl 50 an der Zahl, zeigen
nunmehr wie die Göttin vom 8. bis ins 4. Jahrhundert vor
Chr. hinein an dieser ihrer Hauptkultstätte gebildet wurde.
Es fanden sich verschiedene Typen, aber keiner kommt —
und das ist ein höchst wichtiges Ergebnis — in die Kate-
gorie der Multimammia-Göttinnen, wie sie die römische
Zeit so viel gebildet hat, und wie sie als angenommenes
altes Kultbild auf ephesischen und anderen asiatischen
Münzen vom 2. vorchristlichen bis 3. nachchristlichen Jahr-
hundert erscheint. Wahrscheinlich ist der letztere Typus
überhaupt nicht vielbrüstig und es ist zweifelhaft, ob er
überhaupt eine ephesische Gottheit darstellt. Möglicher-
weise ist es ein, auch in Ephesos eingeführter, phrygischer
oder kappadokischer Göttertypus, der sich aus der ge-
flügelten sogenannten irozvia {t^ojv entwickelt hat. Die
lokale jonische Personifikation war wohl eine mattonale
Figur hellenistischen Charakters. Erst in ganz später Zeit
ist die Artemis Ephesia mit der großen westasiatischen
Göttin der nichtgriechischen Völker verschmolzen, womit
eine Umbildung der ephesischen Zivilisation Hand in Hand
ging, welche immer mehr asiatisch wurde. Die Frühge-
schichte des ephesischen Christentums reflektiert deutlich
die spätere Entwickelung des Kultus der ephesischen
Gottin unter asiatischem Einflüsse. M
r„ /?/HV!t0. Lucan° (Basilic*ta). In der Nähe des
^astello dei tre confini sind die Umfassungsmauern einer
vorgeschichtlichen Stadt zum Vorschein gekommen. Sie
bestehen aus großen unbearbeiteten Sandsteinblöcken,
welche bis zu 1,20X0,60 m messen, und sie umfassen das
bewohnte Gebiet mit einem äußeren weiteren Ring und
einem inneren engeren um die Akropolis. Die uralte
Stadt lag 1150 Meter über der Meereshöhe Fed. h.
Pompeji. Die italienischen Archäologen haben eine
neue Einteilung Pompejis vorgenommen. Man scheidet
nunmehr das Stadtbild wieder in sechs Regionen, die ihrer-
seits in Inseln oder Häuserblocks zerfallen, wobei man die
Straße nach Stabiä, die Hauptverkehrsader der Stadt, als
oberste Scheidelinie annahm. Nach der alten Einteilung,
die von Fiorillo stammt, war Pompeji in neun Regionen
eingeteilt. Jüngst hat man an der Porta di Vesuvio einige
Ergänzungsgrabungen vorgenommen, die den Unterbau der
Anlage vollständig bloßgelegt haben.
Dem Beginn der Ausgrabungen in Herculaneum steht
nunmehr auch nichts mehr im Wege, nachdem die Zentral-
kommission für Altertümer und schöne Künste den Vor-
schlag des Professors Waldstein, die Beteiligung des
Auslands an den Ausgrabungsarbeiten betreffend, ange-
nommen hat.
Aus Frankfurt a. M. wird der Voss. Zeitung tele-
graphiert, daß in einem dortigen Privathaus ein seit
150 Jahren verschollenes Gemälde von Lionardo da Vinci,
die Darstellung einer Madonna in Temperafarben, entdeckt
worden sei. Man hat allen Grund, diese Nachricht betreffs
der Autorschaft Lionardos anzuzweifeln.
Athen. Der Archäologe Friedrich Noack hat auf
Kosten des kaiserl. deutschen archäologischen Instituts
die Stadtmauer von Athen einer Untersuchung unterzogen,
die bei Dipylon begonnen wurde. Die jüngsten Mit-
teilungen der athenischen Abteilung des Instituts berichten
darüber: Das ursprüngliche Fundament besteht aus Kalk-
steinquadern, die von einem älteren Gebäude herrühren
müssen. Darauf liegen an zwei Stellen der äußeren und
inneren Stirnmauer die Stücke zweier archaischer Grab-
reliefs. Ihre Auslösung aus der Mauer wurde sofort vor-
genommen; während von dem einen Relief nur das obere,
horizontal abgeschlossene Ende mit dem Schädel der dar-
gestellten Figur erhalten ist, zeigt das andere einen stehenden,
den gesenkten Speer leicht in der Linken haltenden Jüng-
ling, im Stil dem Diskoswerfer verwandt. Unter dem Jüng-
ling ist auf einem kleinen Bildfeld eine nach rechts eilende
Gorgone dargestellt. Dieser Fund bestätigt auf das glück-
lichste die Nachricht des Thukydides über den Mauerbau
des Themistokles. Auch an zwei weiteren Stellen wurden
Marmorplatten gefunden, die eine mit einer gerade noch
erkennbaren Hermesgestalt von archaischem Typus. Dieses
in elftägiger Arbeit gewonnene Ergebnis hat zu dem Schluß
geführt, daß der weitere Verlauf der Themistokleischen
Mauer nach dem Dipylon zu ein ganz anderer gewesen
sein müsse, als man bisher angenommen hat.
AUSSTELLUNGEN
Wien. Die beiden großen Herbstausstellungen sind
eröffnet. Die der Sezession hat ihr spezifisches Gewicht
in Eugene Carriire, dessen Andenken man durch die Ver-
einigung von 25 Bildern, darunter das große »Theater von
Belleville«, ehrte, und in einer Zusammenstellung von
neun Bildern Karl Mofers, der den Lesern der »Zeitschrift
für bildende Kunst« wohlbekannt, den Wienern neu ist.
Über Carriere ist nun nichts mehr zu sagen. Er füllt
seinen Saal mit einer starken Stimmung, die in ihrer abso-
luten Ausgeglichenheit elementar wirkt. Malerischer und
menschlicher Gehalt sind bei ihm gleich echt, er ist einer,
der bleibt. Von Hofer sieht man keine Radierungen, bloß
Gemälde (Selbstporträt, Mars und Venus, Frauen am Meere,
Susanna im Bade, Doppelporträt usw.), deren linkisch
tuende Stilistik und blaß harmonisierte Freskenhaftigkeit,
ehe man hier Hodler und Marees kennen gelernt, weniger
Verständnis gefunden hätte. Es blüht in der Tat eine
neue deutsche Freskengeneration auf, der man nur die
entsprechend wandgroßen Aufträge wünschen möchte.
Diese Hoferschen Harmonien mit ihren an Kalk und Mör-
tel gemahnenden Tünchtönen machen schier noch mehr
als die Puvis de Chavannesschen im Pariser Pantheon den
Eindruck, als wären sie eine natürliche Ausschwitzung des
Malgrundes und gehörten also organisch zum Bauwerk.
Auch an dem Humor Hofers, der ein wenig an Chinoiserie
streift, stößt man sich nicht eigentlich; er ist augenschein-
lich einer, den man hier lieb gewinnen könnte. Andere
Ausländer in der Ausstellung sind Besnard, La Touche,
Skarbina, Leibi, Carabin, die Spanier Sert und Castelucho,
Oskar Moll, von dem ein kühn hingefegter Schnee auf-
fällt, im Kunstgewerblichen Ashbee. Die einheimischen
Mitglieder waren fleißig, und mit Erfolg, doch gibt es kein
Aufsehen. Es fehlen leider Engelhart, der mit einem monu-
mentalen Brunnen für Wien (III. Bezirk) vollauf beschäftigt
ist, und der feine Landschaftler Sigmundt. Die große
Lücke, die durch den Austritt Klimts und Konsorten ent-
standen, ist natürlich überhaupt nicht auszufüllen. Die
jungpolnische Malerei sendet alljährlich einige frische Bei-
träge, so diesmal von Filipkiewicz und Slewinsky. Gute
Wiener Bilder sieht man von Lenz, Novak, Stöhr, Karl
Müller (Aquarelle aus der Brahmsschen Wohnung), Rösch
(spanische Veduten in Aquarell), der nach zwanzigjähriger
Abwesenheit wieder heimgefunden hat. Und die jungen
Bildhauer (Hanak, Hofmann) wachsen. — Im Künstler-