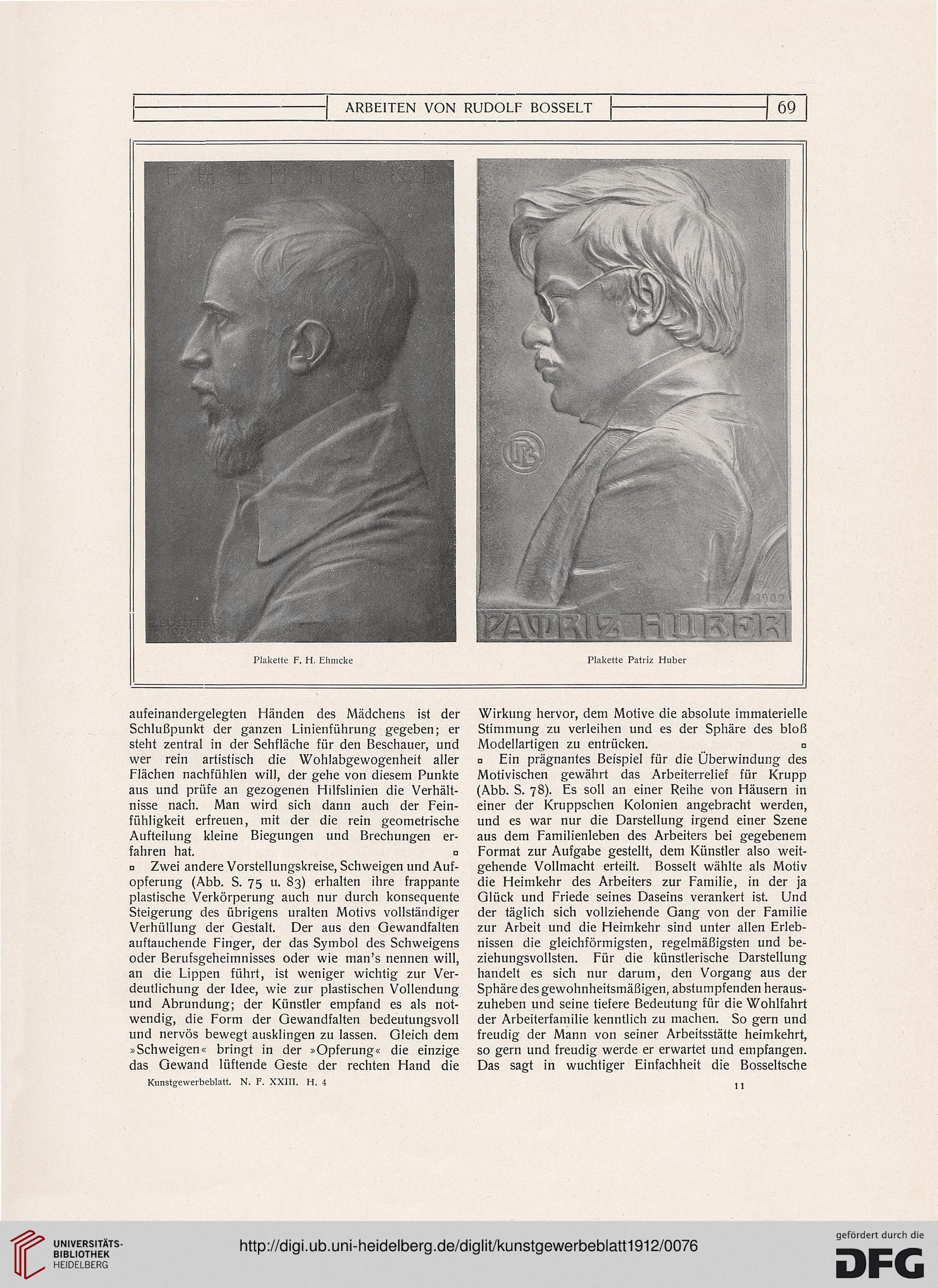AKdlI I C.IN VvJIN KULMJLr tSCJbotlL I
69
aufeinandergelegten Händen des Mädchens ist der
Schlußpunkt der ganzen Linienführung gegeben; er
steht zentral in der Sehfläche für den Beschauer, und
wer rein artistisch die Wohlabgewogenheit aller
Flächen nachfühlen will, der gehe von diesem Punkte
aus und prüfe an gezogenen Hilfslinien die Verhält-
nisse nach. Man wird sich dann auch der Fein-
fühligkeit erfreuen, mit der die rein geometrische
Aufteilung kleine Biegungen und Brechungen er-
fahren hat. o
□ Zwei andere Vorstellungskreise, Schweigen und Auf-
opferung (Abb. S. 75 u. 83) erhalten ihre frappante
plastische Verkörperung auch nur durch konsequente
Steigerung des übrigens uralten Motivs vollständiger
Verhüllung der Gestalt. Der aus den Gewandfalten
auftauchende Finger, der das Symbol des Schweigens
oder Berufsgeheimnisses oder wie man’s nennen will,
an die Lippen führt, ist weniger wichtig zur Ver-
deutlichung der Idee, wie zur plastischen Vollendung
und Abrundung; der Künstler empfand es als not-
wendig, die Form der Gewandfalten bedeutungsvoll
und nervös bewegt ausklingen zu lassen. Gleich dem
»Schweigen« bringt in der »Opferung« die einzige
das Gewand lüftende Geste der rechten Hand die
Kunstgewerbeblatt. N. F. XXIII. H. 4
Wirkung hervor, dem Motive die absolute immaterielle
Stimmung zu verleihen und es der Sphäre des bloß
Modellartigen zu entrücken. □
o Ein prägnantes Beispiel für die Überwindung des
Motivischen gewährt das Arbeiterrelief für Krupp
(Abb. S. 78). Es soll an einer Reihe von Häusern in
einer der Kruppschen Kolonien angebracht werden,
und es war nur die Darstellung irgend einer Szene
aus dem Familienleben des Arbeiters bei gegebenem
Format zur Aufgabe gestellt, dem Künstler also weit-
gehende Vollmacht erteilt. Bosselt wählte als Motiv
die Heimkehr des Arbeiters zur Familie, in der ja
Glück und Friede seines Daseins verankert ist. Und
der täglich sich vollziehende Gang von der Familie
zur Arbeit und die Heimkehr sind unter allen Erleb-
nissen die gleichförmigsten, regelmäßigsten und be-
ziehungsvollsten. Für die künstlerische Darstellung
handelt es sich nur darum, den Vorgang aus der
Sphäre des gewohnheitsmäßigen, abstumpfenden heraus-
zuheben und seine tiefere Bedeutung für die Wohlfahrt
der Arbeiterfamilie kenntlich zu machen. So gern und
freudig der Mann von seiner Arbeitsstätte heimkehrt,
so gern und freudig werde er erwartet und empfangen.
Das sagt in wuchtiger Einfachheit die Bosseltsche
11
69
aufeinandergelegten Händen des Mädchens ist der
Schlußpunkt der ganzen Linienführung gegeben; er
steht zentral in der Sehfläche für den Beschauer, und
wer rein artistisch die Wohlabgewogenheit aller
Flächen nachfühlen will, der gehe von diesem Punkte
aus und prüfe an gezogenen Hilfslinien die Verhält-
nisse nach. Man wird sich dann auch der Fein-
fühligkeit erfreuen, mit der die rein geometrische
Aufteilung kleine Biegungen und Brechungen er-
fahren hat. o
□ Zwei andere Vorstellungskreise, Schweigen und Auf-
opferung (Abb. S. 75 u. 83) erhalten ihre frappante
plastische Verkörperung auch nur durch konsequente
Steigerung des übrigens uralten Motivs vollständiger
Verhüllung der Gestalt. Der aus den Gewandfalten
auftauchende Finger, der das Symbol des Schweigens
oder Berufsgeheimnisses oder wie man’s nennen will,
an die Lippen führt, ist weniger wichtig zur Ver-
deutlichung der Idee, wie zur plastischen Vollendung
und Abrundung; der Künstler empfand es als not-
wendig, die Form der Gewandfalten bedeutungsvoll
und nervös bewegt ausklingen zu lassen. Gleich dem
»Schweigen« bringt in der »Opferung« die einzige
das Gewand lüftende Geste der rechten Hand die
Kunstgewerbeblatt. N. F. XXIII. H. 4
Wirkung hervor, dem Motive die absolute immaterielle
Stimmung zu verleihen und es der Sphäre des bloß
Modellartigen zu entrücken. □
o Ein prägnantes Beispiel für die Überwindung des
Motivischen gewährt das Arbeiterrelief für Krupp
(Abb. S. 78). Es soll an einer Reihe von Häusern in
einer der Kruppschen Kolonien angebracht werden,
und es war nur die Darstellung irgend einer Szene
aus dem Familienleben des Arbeiters bei gegebenem
Format zur Aufgabe gestellt, dem Künstler also weit-
gehende Vollmacht erteilt. Bosselt wählte als Motiv
die Heimkehr des Arbeiters zur Familie, in der ja
Glück und Friede seines Daseins verankert ist. Und
der täglich sich vollziehende Gang von der Familie
zur Arbeit und die Heimkehr sind unter allen Erleb-
nissen die gleichförmigsten, regelmäßigsten und be-
ziehungsvollsten. Für die künstlerische Darstellung
handelt es sich nur darum, den Vorgang aus der
Sphäre des gewohnheitsmäßigen, abstumpfenden heraus-
zuheben und seine tiefere Bedeutung für die Wohlfahrt
der Arbeiterfamilie kenntlich zu machen. So gern und
freudig der Mann von seiner Arbeitsstätte heimkehrt,
so gern und freudig werde er erwartet und empfangen.
Das sagt in wuchtiger Einfachheit die Bosseltsche
11