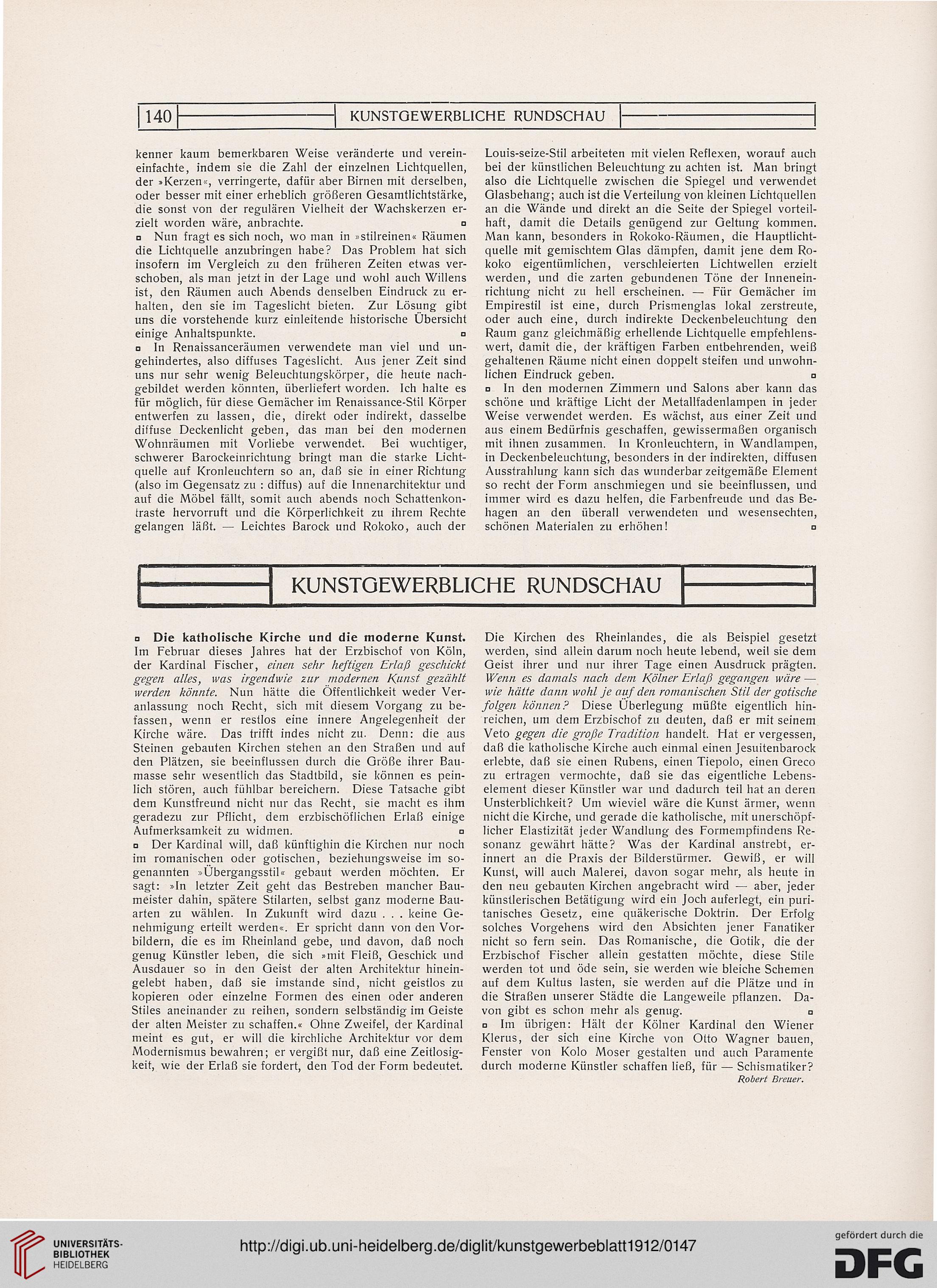KUNSTGEWERBLICHE RUNDSCHAU
140
kenner kaum bemerkbaren Weise veränderte und verein-
einfachte, indem sie die Zahl der einzelnen Lichtquellen,
der »Kerzen«, verringerte, dafür aber Birnen mit derselben,
oder besser mit einer erheblich größeren Gesamtlichtstärke,
die sonst von der regulären Vielheit der Wachskerzen er-
zielt worden wäre, anbrachte. o
□ Nun fragt es sich noch, wo man in »stilreinen« Räumen
die Lichtquelle anzubringen habe? Das Problem hat sich
insofern im Vergleich zu den früheren Zeiten etwas ver-
schoben, als man jetzt in der Lage und wohl auch Willens
ist, den Räumen auch Abends denselben Eindruck zu er-
halten, den sie im Tageslicht bieten. Zur Lösung gibt
uns die vorstehende kurz einleitende historische Übersicht
einige Anhaltspunkte. q
□ In Renaissanceräumen verwendete man viel und un-
gehindertes, also diffuses Tageslicht. Aus jener Zeit sind
uns nur sehr wenig Beleuchtungskörper, die heute nach-
gebildet werden könnten, überliefert worden. Ich halte es
für möglich, für diese Gemächer im Renaissance-Stil Körper
entwerfen zu lassen, die, direkt oder indirekt, dasselbe
diffuse Deckenlicht geben, das man bei den modernen
Wohnräumen mit Vorliebe verwendet. Bei wuchtiger,
schwerer Barockeinrichtung bringt man die starke Licht-
quelle auf Kronleuchtern so an, daß sie in einer Richtung
(also im Gegensatz zu : diffus) auf die Innenarchitektur und
auf die Möbel fällt, somit auch abends noch Schattenkon-
traste hervorruft und die Körperlichkeit zu ihrem Rechte
gelangen läßt. — Leichtes Barock und Rokoko, auch der
□ Die katholische Kirche und die moderne Kunst.
Im Februar dieses Jahres hat der Erzbischof von Köln,
der Kardinal Fischer, einen sehr heftigen Erlaß geschickt
gegen alles, was irgendwie zur modernen Kunst gezählt
werden könnte. Nun hätte die Öffentlichkeit weder Ver-
anlassung noch Recht, sich mit diesem Vorgang zu be-
fassen, wenn er restlos eine innere Angelegenheit der
Kirche wäre. Das trifft indes nicht zu. Denn: die aus
Steinen gebauten Kirchen stehen an den Straßen und auf
den Plätzen, sie beeinflussen durch die Größe ihrer Bau-
masse sehr wesentlich das Stadtbild, sie können es pein-
lich stören, auch fühlbar bereichern. Diese Tatsache gibt
dem Kunstfreund nicht nur das Recht, sie macht es ihm
geradezu zur Pflicht, dem erzbischöflichen Erlaß einige
Aufmerksamkeit zu widmen. a
□ Der Kardinal will, daß künftighin die Kirchen nur noch
im romanischen oder gotischen, beziehungsweise im so-
genannten »Übergangsstil« gebaut werden möchten. Er
sagt: »In letzter Zeit geht das Bestreben mancher Bau-
meister dahin, spätere Stilarten, selbst ganz moderne Bau-
arten zu wählen. In Zukunft wird dazu . . . keine Ge-
nehmigung erteilt werden«. Er spricht dann von den Vor-
bildern, die es im Rheinland gebe, und davon, daß noch
genug Künstler leben, die sich »mit Fleiß, Geschick und
Ausdauer so in den Geist der alten Architektur hinein-
gelebt haben, daß sie imstande sind, nicht geistlos zu
kopieren oder einzelne Formen des einen oder anderen
Stiles aneinander zu reihen, sondern selbständig im Geiste
der alten Meister zu schaffen.« Ohne Zweifel, der Kardinal
meint es gut, er will die kirchliche Architektur vor dem
Modernismus bewahren; er vergißt nur, daß eine Zeitlosig-
keit, wie der Erlaß sie fordert, den Tod der Form bedeutet.
Louis-seize-Stil arbeiteten mit vielen Reflexen, worauf auch
bei der künstlichen Beleuchtung zu achten ist. Man bringt
also die Lichtquelle zwischen die Spiegel und verwendet
Glasbehang; auch ist die Verteilung von kleinen Lichtquellen
an die Wände und direkt an die Seite der Spiegel vorteil-
haft, damit die Details genügend zur Geltung kommen.
Man kann, besonders in Rokoko-Räumen, die Hauptlicht-
quelle mit gemischtem Glas dämpfen, damit jene dem Ro-
koko eigentümlichen, verschleierten Lichtwellen erzielt
werden, und die zarten gebundenen Töne der Innenein-
richtung nicht zu hell erscheinen. — Für Gemächer im
Empirestil ist eine, durch Prismenglas lokal zerstreute,
oder auch eine, durch indirekte Deckenbeleuchtung den
Raum ganz gleichmäßig erhellende Lichtquelle empfehlens-
wert, damit die, der kräftigen Farben entbehrenden, weiß
gehaltenen Räume nicht einen doppelt steifen und unwohn-
lichen Eindruck geben. □
a In den modernen Zimmern und Salons aber kann das
schöne und kräftige Licht der Metallfadenlampen in jeder
Weise verwendet werden. Es wächst, aus einer Zeit und
aus einem Bedürfnis geschaffen, gewissermaßen organisch
mit ihnen zusammen. In Kronleuchtern, in Wandlampen,
in Deckenbeleuchtung, besonders in der indirekten, diffusen
Ausstrahlung kann sich das wunderbar zeitgemäße Element
so recht der Form anschmiegen und sie beeinflussen, und
immer wird es dazu helfen, die Farbenfreude und das Be-
hagen an den überall verwendeten und wesensechten,
schönen Materialen zu erhöhen! □
Die Kirchen des Rheinlandes, die als Beispiel gesetzt
werden, sind allein darum noch heute lebend, weil sie dem
Geist ihrer und nur ihrer Tage einen Ausdruck prägten.
Wenn es damals nach dem Kölner Erlaß gegangen wäre —
wie hätte dann wohl je auf den romanischen Stil der gotische
folgen können? Diese Überlegung müßte eigentlich hin-
reichen, um dem Erzbischof zu deuten, daß er mit seinem
Veto gegen die große Tradition handelt. Hat er vergessen,
daß die katholische Kirche auch einmal einen Jesuitenbarock
erlebte, daß sie einen Rubens, einen Tiepolo, einen Greco
zu ertragen vermochte, daß sie das eigentliche Lebens-
element dieser Künstler war und dadurch teil hat an deren
Unsterblichkeit? Um wieviel wäre die Kunst ärmer, wenn
nicht die Kirche, und gerade die katholische, mit unerschöpf-
licher Elastizität jeder Wandlung des Formempfindens Re-
sonanz gewährt hätte? Was der Kardinal anstrebt, er-
innert an die Praxis der Bilderstürmer. Gewiß, er will
Kunst, will auch Malerei, davon sogar mehr, als heute in
den neu gebauten Kirchen angebracht wird — aber, jeder
künstlerischen Betätigung wird ein Joch auferlegt, ein puri-
tanisches Gesetz, eine quäkerische Doktrin. Der Erfolg
solches Vorgehens wird den Absichten jener Fanatiker
nicht so fern sein. Das Romanische, die Gotik, die der
Erzbischof Fischer allein gestatten möchte, diese Stile
werden tot und öde sein, sie werden wie bleiche Schemen
auf dem Kultus lasten, sie werden auf die Plätze und in
die Straßen unserer Städte die Langeweile pflanzen. Da-
von gibt es schon mehr als genug. □
□ Im übrigen: Hält der Kölner Kardinal den Wiener
Klerus, der sich eine Kirche von Otto Wagner bauen,
Fenster von Kolo Moser gestalten und auch Paramente
durch moderne Künstler schaffen ließ, für — Schismatiker?
Robert Breuer.
KUNSTGEWERBLICHE RUNDSCHAU
3
140
kenner kaum bemerkbaren Weise veränderte und verein-
einfachte, indem sie die Zahl der einzelnen Lichtquellen,
der »Kerzen«, verringerte, dafür aber Birnen mit derselben,
oder besser mit einer erheblich größeren Gesamtlichtstärke,
die sonst von der regulären Vielheit der Wachskerzen er-
zielt worden wäre, anbrachte. o
□ Nun fragt es sich noch, wo man in »stilreinen« Räumen
die Lichtquelle anzubringen habe? Das Problem hat sich
insofern im Vergleich zu den früheren Zeiten etwas ver-
schoben, als man jetzt in der Lage und wohl auch Willens
ist, den Räumen auch Abends denselben Eindruck zu er-
halten, den sie im Tageslicht bieten. Zur Lösung gibt
uns die vorstehende kurz einleitende historische Übersicht
einige Anhaltspunkte. q
□ In Renaissanceräumen verwendete man viel und un-
gehindertes, also diffuses Tageslicht. Aus jener Zeit sind
uns nur sehr wenig Beleuchtungskörper, die heute nach-
gebildet werden könnten, überliefert worden. Ich halte es
für möglich, für diese Gemächer im Renaissance-Stil Körper
entwerfen zu lassen, die, direkt oder indirekt, dasselbe
diffuse Deckenlicht geben, das man bei den modernen
Wohnräumen mit Vorliebe verwendet. Bei wuchtiger,
schwerer Barockeinrichtung bringt man die starke Licht-
quelle auf Kronleuchtern so an, daß sie in einer Richtung
(also im Gegensatz zu : diffus) auf die Innenarchitektur und
auf die Möbel fällt, somit auch abends noch Schattenkon-
traste hervorruft und die Körperlichkeit zu ihrem Rechte
gelangen läßt. — Leichtes Barock und Rokoko, auch der
□ Die katholische Kirche und die moderne Kunst.
Im Februar dieses Jahres hat der Erzbischof von Köln,
der Kardinal Fischer, einen sehr heftigen Erlaß geschickt
gegen alles, was irgendwie zur modernen Kunst gezählt
werden könnte. Nun hätte die Öffentlichkeit weder Ver-
anlassung noch Recht, sich mit diesem Vorgang zu be-
fassen, wenn er restlos eine innere Angelegenheit der
Kirche wäre. Das trifft indes nicht zu. Denn: die aus
Steinen gebauten Kirchen stehen an den Straßen und auf
den Plätzen, sie beeinflussen durch die Größe ihrer Bau-
masse sehr wesentlich das Stadtbild, sie können es pein-
lich stören, auch fühlbar bereichern. Diese Tatsache gibt
dem Kunstfreund nicht nur das Recht, sie macht es ihm
geradezu zur Pflicht, dem erzbischöflichen Erlaß einige
Aufmerksamkeit zu widmen. a
□ Der Kardinal will, daß künftighin die Kirchen nur noch
im romanischen oder gotischen, beziehungsweise im so-
genannten »Übergangsstil« gebaut werden möchten. Er
sagt: »In letzter Zeit geht das Bestreben mancher Bau-
meister dahin, spätere Stilarten, selbst ganz moderne Bau-
arten zu wählen. In Zukunft wird dazu . . . keine Ge-
nehmigung erteilt werden«. Er spricht dann von den Vor-
bildern, die es im Rheinland gebe, und davon, daß noch
genug Künstler leben, die sich »mit Fleiß, Geschick und
Ausdauer so in den Geist der alten Architektur hinein-
gelebt haben, daß sie imstande sind, nicht geistlos zu
kopieren oder einzelne Formen des einen oder anderen
Stiles aneinander zu reihen, sondern selbständig im Geiste
der alten Meister zu schaffen.« Ohne Zweifel, der Kardinal
meint es gut, er will die kirchliche Architektur vor dem
Modernismus bewahren; er vergißt nur, daß eine Zeitlosig-
keit, wie der Erlaß sie fordert, den Tod der Form bedeutet.
Louis-seize-Stil arbeiteten mit vielen Reflexen, worauf auch
bei der künstlichen Beleuchtung zu achten ist. Man bringt
also die Lichtquelle zwischen die Spiegel und verwendet
Glasbehang; auch ist die Verteilung von kleinen Lichtquellen
an die Wände und direkt an die Seite der Spiegel vorteil-
haft, damit die Details genügend zur Geltung kommen.
Man kann, besonders in Rokoko-Räumen, die Hauptlicht-
quelle mit gemischtem Glas dämpfen, damit jene dem Ro-
koko eigentümlichen, verschleierten Lichtwellen erzielt
werden, und die zarten gebundenen Töne der Innenein-
richtung nicht zu hell erscheinen. — Für Gemächer im
Empirestil ist eine, durch Prismenglas lokal zerstreute,
oder auch eine, durch indirekte Deckenbeleuchtung den
Raum ganz gleichmäßig erhellende Lichtquelle empfehlens-
wert, damit die, der kräftigen Farben entbehrenden, weiß
gehaltenen Räume nicht einen doppelt steifen und unwohn-
lichen Eindruck geben. □
a In den modernen Zimmern und Salons aber kann das
schöne und kräftige Licht der Metallfadenlampen in jeder
Weise verwendet werden. Es wächst, aus einer Zeit und
aus einem Bedürfnis geschaffen, gewissermaßen organisch
mit ihnen zusammen. In Kronleuchtern, in Wandlampen,
in Deckenbeleuchtung, besonders in der indirekten, diffusen
Ausstrahlung kann sich das wunderbar zeitgemäße Element
so recht der Form anschmiegen und sie beeinflussen, und
immer wird es dazu helfen, die Farbenfreude und das Be-
hagen an den überall verwendeten und wesensechten,
schönen Materialen zu erhöhen! □
Die Kirchen des Rheinlandes, die als Beispiel gesetzt
werden, sind allein darum noch heute lebend, weil sie dem
Geist ihrer und nur ihrer Tage einen Ausdruck prägten.
Wenn es damals nach dem Kölner Erlaß gegangen wäre —
wie hätte dann wohl je auf den romanischen Stil der gotische
folgen können? Diese Überlegung müßte eigentlich hin-
reichen, um dem Erzbischof zu deuten, daß er mit seinem
Veto gegen die große Tradition handelt. Hat er vergessen,
daß die katholische Kirche auch einmal einen Jesuitenbarock
erlebte, daß sie einen Rubens, einen Tiepolo, einen Greco
zu ertragen vermochte, daß sie das eigentliche Lebens-
element dieser Künstler war und dadurch teil hat an deren
Unsterblichkeit? Um wieviel wäre die Kunst ärmer, wenn
nicht die Kirche, und gerade die katholische, mit unerschöpf-
licher Elastizität jeder Wandlung des Formempfindens Re-
sonanz gewährt hätte? Was der Kardinal anstrebt, er-
innert an die Praxis der Bilderstürmer. Gewiß, er will
Kunst, will auch Malerei, davon sogar mehr, als heute in
den neu gebauten Kirchen angebracht wird — aber, jeder
künstlerischen Betätigung wird ein Joch auferlegt, ein puri-
tanisches Gesetz, eine quäkerische Doktrin. Der Erfolg
solches Vorgehens wird den Absichten jener Fanatiker
nicht so fern sein. Das Romanische, die Gotik, die der
Erzbischof Fischer allein gestatten möchte, diese Stile
werden tot und öde sein, sie werden wie bleiche Schemen
auf dem Kultus lasten, sie werden auf die Plätze und in
die Straßen unserer Städte die Langeweile pflanzen. Da-
von gibt es schon mehr als genug. □
□ Im übrigen: Hält der Kölner Kardinal den Wiener
Klerus, der sich eine Kirche von Otto Wagner bauen,
Fenster von Kolo Moser gestalten und auch Paramente
durch moderne Künstler schaffen ließ, für — Schismatiker?
Robert Breuer.
KUNSTGEWERBLICHE RUNDSCHAU
3