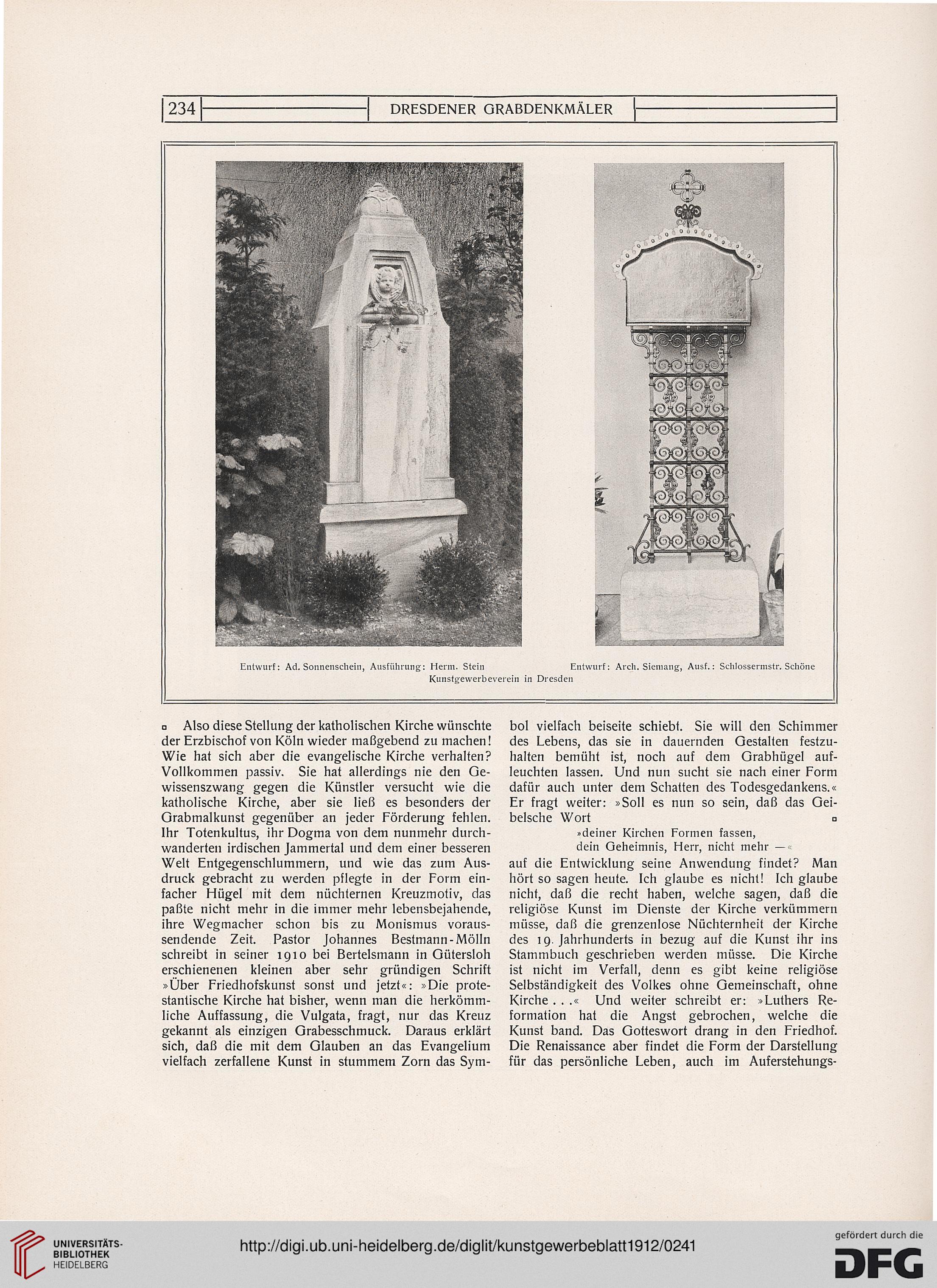DRESDENER GRABDENKMÄLER
OQ A
Entwurf: Ad. Sonnenschein, Ausführung: Herrn. Stein
Entwurf: Arch. Siemang, Ausf.: Schlossermstr. Schöne
Kunstgewerbeverein in Dresden
□ Also diese Stellung der katholischen Kirche wünschte
der Erzbischof von Köln wieder maßgebend zu machen!
Wie hat sich aber die evangelische Kirche verhalten?
Vollkommen passiv. Sie hat allerdings nie den Ge-
wissenszwang gegen die Künstler versucht wie die
katholische Kirche, aber sie ließ es besonders der
Grabmalkunst gegenüber an jeder Förderung fehlen.
Ihr Totenkultus, ihr Dogma von dem nunmehr durch-
wanderten irdischen Jammertal und dem einer besseren
Welt Entgegenschlummern, und wie das zum Aus-
druck gebracht zu werden pflegte in der Form ein-
facher Hügel mit dem nüchternen Kreuzmotiv, das
paßte nicht mehr in die immer mehr lebensbejahende,
ihre Wegmacher schon bis zu Monismus voraus-
sendende Zeit. Pastor Johannes Bestmann-Mölln
schreibt in seiner 1910 bei Bertelsmann in Gütersloh
erschienenen kleinen aber sehr gründigen Schrift
»Über Friedhofskunst sonst und jetzt«: »Die prote-
stantische Kirche hat bisher, wenn man die herkömm-
liche Auffassung, die Vulgata, fragt, nur das Kreuz
gekannt als einzigen Grabesschmuck. Daraus erklärt
sich, daß die mit dem Glauben an das Evangelium
vielfach zerfallene Kunst in stummem Zorn das Sym-
bol vielfach beiseite schiebt. Sie will den Schimmer
des Lebens, das sie in dauernden Gestalten festzu-
halten bemüht ist, noch auf dem Grabhügel auf-
leuchten lassen. Und nun sucht sie nach einer Form
dafür auch unter dem Schatten des Todesgedankens.«
Er fragt weiter: »Soll es nun so sein, daß das Gei-
belsche Wort n
»deiner Kirchen Formen fassen,
dein Geheimnis, Herr, nicht mehr —«
auf die Entwicklung seine Anwendung findet? Man
hört so sagen heute. Ich glaube es nicht! Ich glaube
nicht, daß die recht haben, welche sagen, daß die
religiöse Kunst im Dienste der Kirche verkümmern
müsse, daß die grenzenlose Nüchternheit der Kirche
des 19. Jahrhunderts in bezug auf die Kunst ihr ins
Stammbuch geschrieben werden müsse. Die Kirche
ist nicht im Verfall, denn es gibt keine religiöse
Selbständigkeit des Volkes ohne Gemeinschaft, ohne
Kirche . . .« Und weiter schreibt er: »Luthers Re-
formation hat die Angst gebrochen, welche die
Kunst band. Das Gotteswort drang in den Friedhof.
Die Renaissance aber findet die Form der Darstellung
für das persönliche Leben, auch im Auferstehungs-
OQ A
Entwurf: Ad. Sonnenschein, Ausführung: Herrn. Stein
Entwurf: Arch. Siemang, Ausf.: Schlossermstr. Schöne
Kunstgewerbeverein in Dresden
□ Also diese Stellung der katholischen Kirche wünschte
der Erzbischof von Köln wieder maßgebend zu machen!
Wie hat sich aber die evangelische Kirche verhalten?
Vollkommen passiv. Sie hat allerdings nie den Ge-
wissenszwang gegen die Künstler versucht wie die
katholische Kirche, aber sie ließ es besonders der
Grabmalkunst gegenüber an jeder Förderung fehlen.
Ihr Totenkultus, ihr Dogma von dem nunmehr durch-
wanderten irdischen Jammertal und dem einer besseren
Welt Entgegenschlummern, und wie das zum Aus-
druck gebracht zu werden pflegte in der Form ein-
facher Hügel mit dem nüchternen Kreuzmotiv, das
paßte nicht mehr in die immer mehr lebensbejahende,
ihre Wegmacher schon bis zu Monismus voraus-
sendende Zeit. Pastor Johannes Bestmann-Mölln
schreibt in seiner 1910 bei Bertelsmann in Gütersloh
erschienenen kleinen aber sehr gründigen Schrift
»Über Friedhofskunst sonst und jetzt«: »Die prote-
stantische Kirche hat bisher, wenn man die herkömm-
liche Auffassung, die Vulgata, fragt, nur das Kreuz
gekannt als einzigen Grabesschmuck. Daraus erklärt
sich, daß die mit dem Glauben an das Evangelium
vielfach zerfallene Kunst in stummem Zorn das Sym-
bol vielfach beiseite schiebt. Sie will den Schimmer
des Lebens, das sie in dauernden Gestalten festzu-
halten bemüht ist, noch auf dem Grabhügel auf-
leuchten lassen. Und nun sucht sie nach einer Form
dafür auch unter dem Schatten des Todesgedankens.«
Er fragt weiter: »Soll es nun so sein, daß das Gei-
belsche Wort n
»deiner Kirchen Formen fassen,
dein Geheimnis, Herr, nicht mehr —«
auf die Entwicklung seine Anwendung findet? Man
hört so sagen heute. Ich glaube es nicht! Ich glaube
nicht, daß die recht haben, welche sagen, daß die
religiöse Kunst im Dienste der Kirche verkümmern
müsse, daß die grenzenlose Nüchternheit der Kirche
des 19. Jahrhunderts in bezug auf die Kunst ihr ins
Stammbuch geschrieben werden müsse. Die Kirche
ist nicht im Verfall, denn es gibt keine religiöse
Selbständigkeit des Volkes ohne Gemeinschaft, ohne
Kirche . . .« Und weiter schreibt er: »Luthers Re-
formation hat die Angst gebrochen, welche die
Kunst band. Das Gotteswort drang in den Friedhof.
Die Renaissance aber findet die Form der Darstellung
für das persönliche Leben, auch im Auferstehungs-