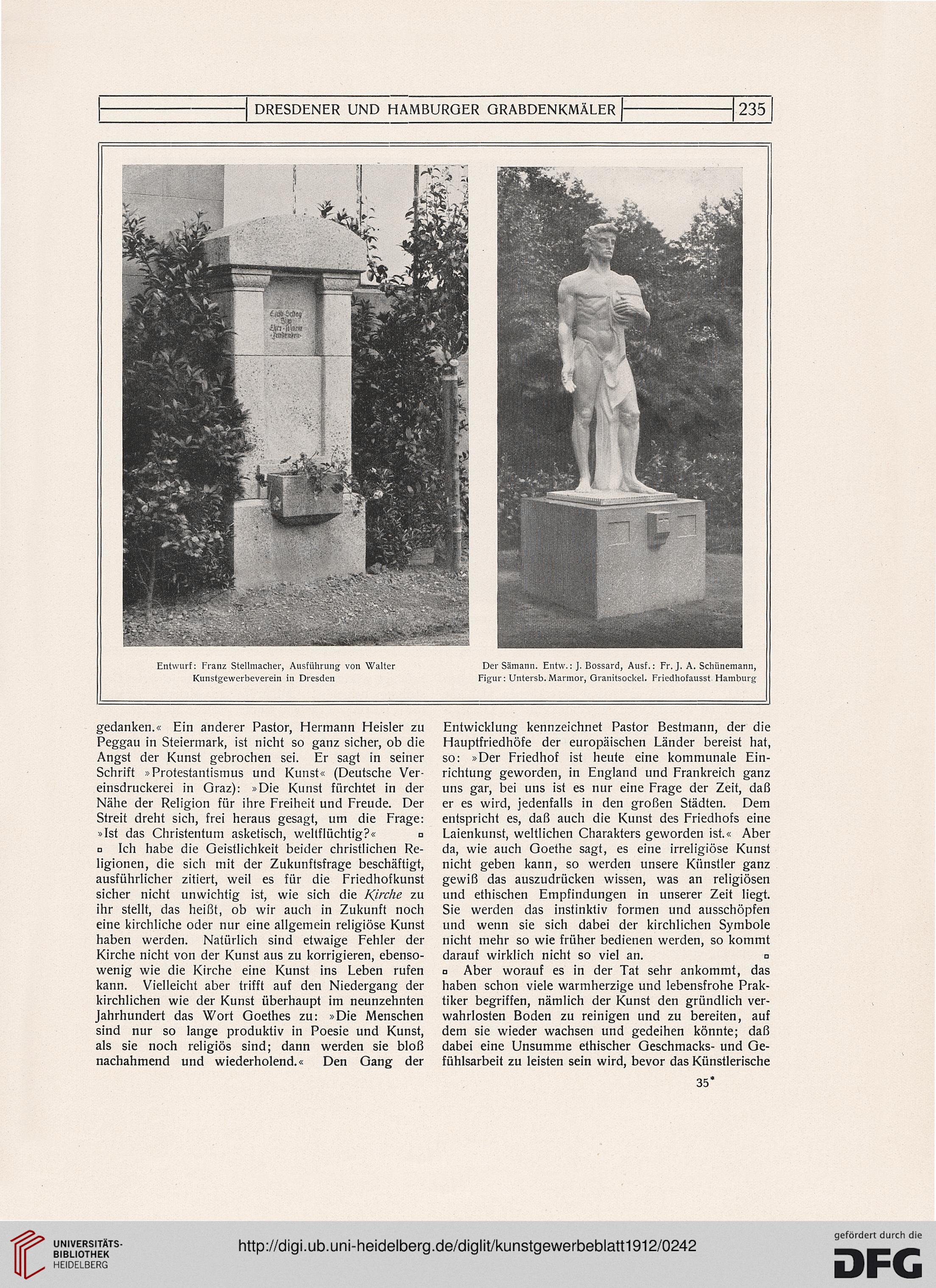DRESDENER UND HAMBURGER GRABDENKMÄLER
235
Entwurf: Franz Stellmacher, Ausführung von Walter Der Sämann. Entw.: J. Bossard, Ausf.: Fr. J. A. Schünemann,
Kunstgewerbeverein in Dresden Figur: Untersb. Marmor, Granitsockel. Friedhofausst. Hamburg
gedanken.« Ein anderer Pastor, Hermann Heisler zu
Peggau in Steiermark, ist nicht so ganz sicher, ob die
Angst der Kunst gebrochen sei. Er sagt in seiner
Schrift »Protestantismus und Kunst« (Deutsche Ver-
einsdruckerei in Graz): »Die Kunst fürchtet in der
Nähe der Religion für ihre Freiheit und Freude. Der
Streit dreht sich, frei heraus gesagt, um die Frage:
»Ist das Christentum asketisch, weltflüchtig?« □
□ Ich habe die Geistlichkeit beider christlichen Re-
ligionen, die sich mit der Zukunftsfrage beschäftigt,
ausführlicher zitiert, weil es für die Friedhofkunst
sicher nicht unwichtig ist, wie sich die Kirche zu
ihr stellt, das heißt, ob wir auch in Zukunft noch
eine kirchliche oder nur eine allgemein religiöse Kunst
haben werden. Natürlich sind etwaige Fehler der
Kirche nicht von der Kunst aus zu korrigieren, ebenso-
wenig wie die Kirche eine Kunst ins Leben rufen
kann. Vielleicht aber trifft auf den Niedergang der
kirchlichen wie der Kunst überhaupt im neunzehnten
Jahrhundert das Wort Goethes zu: »Die Menschen
sind nur so lange produktiv in Poesie und Kunst,
als sie noch religiös sind; dann werden sie bloß
nachahmend und wiederholend.« Den Gang der
Entwicklung kennzeichnet Pastor Bestmann, der die
Hauptfriedhöfe der europäischen Länder bereist hat,
so: »Der Friedhof ist heute eine kommunale Ein-
richtung geworden, in England und Frankreich ganz
uns gar, bei uns ist es nur eine Frage der Zeit, daß
er es wird, jedenfalls in den großen Städten. Dem
entspricht es, daß auch die Kunst des Friedhofs eine
Laienkunst, weltlichen Charakters geworden ist.« Aber
da, wie auch Goethe sagt, es eine irreligiöse Kunst
nicht geben kann, so werden unsere Künstler ganz
gewiß das auszudrücken wissen, was an religiösen
und ethischen Empfindungen in unserer Zeit liegt.
Sie werden das instinktiv formen und ausschöpfen
und wenn sie sich dabei der kirchlichen Symbole
nicht mehr so wie früher bedienen werden, so kommt
darauf wirklich nicht so viel an. □
□ Aber worauf es in der Tat sehr ankommt, das
haben schon viele warmherzige und lebensfrohe Prak-
tiker begriffen, nämlich der Kunst den gründlich ver-
wahrlosten Boden zu reinigen und zu bereiten, auf
dem sie wieder wachsen und gedeihen könnte; daß
dabei eine Unsumme ethischer Geschmacks- und Ge-
fühlsarbeit zu leisten sein wird, bevor das Künstlerische
35
235
Entwurf: Franz Stellmacher, Ausführung von Walter Der Sämann. Entw.: J. Bossard, Ausf.: Fr. J. A. Schünemann,
Kunstgewerbeverein in Dresden Figur: Untersb. Marmor, Granitsockel. Friedhofausst. Hamburg
gedanken.« Ein anderer Pastor, Hermann Heisler zu
Peggau in Steiermark, ist nicht so ganz sicher, ob die
Angst der Kunst gebrochen sei. Er sagt in seiner
Schrift »Protestantismus und Kunst« (Deutsche Ver-
einsdruckerei in Graz): »Die Kunst fürchtet in der
Nähe der Religion für ihre Freiheit und Freude. Der
Streit dreht sich, frei heraus gesagt, um die Frage:
»Ist das Christentum asketisch, weltflüchtig?« □
□ Ich habe die Geistlichkeit beider christlichen Re-
ligionen, die sich mit der Zukunftsfrage beschäftigt,
ausführlicher zitiert, weil es für die Friedhofkunst
sicher nicht unwichtig ist, wie sich die Kirche zu
ihr stellt, das heißt, ob wir auch in Zukunft noch
eine kirchliche oder nur eine allgemein religiöse Kunst
haben werden. Natürlich sind etwaige Fehler der
Kirche nicht von der Kunst aus zu korrigieren, ebenso-
wenig wie die Kirche eine Kunst ins Leben rufen
kann. Vielleicht aber trifft auf den Niedergang der
kirchlichen wie der Kunst überhaupt im neunzehnten
Jahrhundert das Wort Goethes zu: »Die Menschen
sind nur so lange produktiv in Poesie und Kunst,
als sie noch religiös sind; dann werden sie bloß
nachahmend und wiederholend.« Den Gang der
Entwicklung kennzeichnet Pastor Bestmann, der die
Hauptfriedhöfe der europäischen Länder bereist hat,
so: »Der Friedhof ist heute eine kommunale Ein-
richtung geworden, in England und Frankreich ganz
uns gar, bei uns ist es nur eine Frage der Zeit, daß
er es wird, jedenfalls in den großen Städten. Dem
entspricht es, daß auch die Kunst des Friedhofs eine
Laienkunst, weltlichen Charakters geworden ist.« Aber
da, wie auch Goethe sagt, es eine irreligiöse Kunst
nicht geben kann, so werden unsere Künstler ganz
gewiß das auszudrücken wissen, was an religiösen
und ethischen Empfindungen in unserer Zeit liegt.
Sie werden das instinktiv formen und ausschöpfen
und wenn sie sich dabei der kirchlichen Symbole
nicht mehr so wie früher bedienen werden, so kommt
darauf wirklich nicht so viel an. □
□ Aber worauf es in der Tat sehr ankommt, das
haben schon viele warmherzige und lebensfrohe Prak-
tiker begriffen, nämlich der Kunst den gründlich ver-
wahrlosten Boden zu reinigen und zu bereiten, auf
dem sie wieder wachsen und gedeihen könnte; daß
dabei eine Unsumme ethischer Geschmacks- und Ge-
fühlsarbeit zu leisten sein wird, bevor das Künstlerische
35