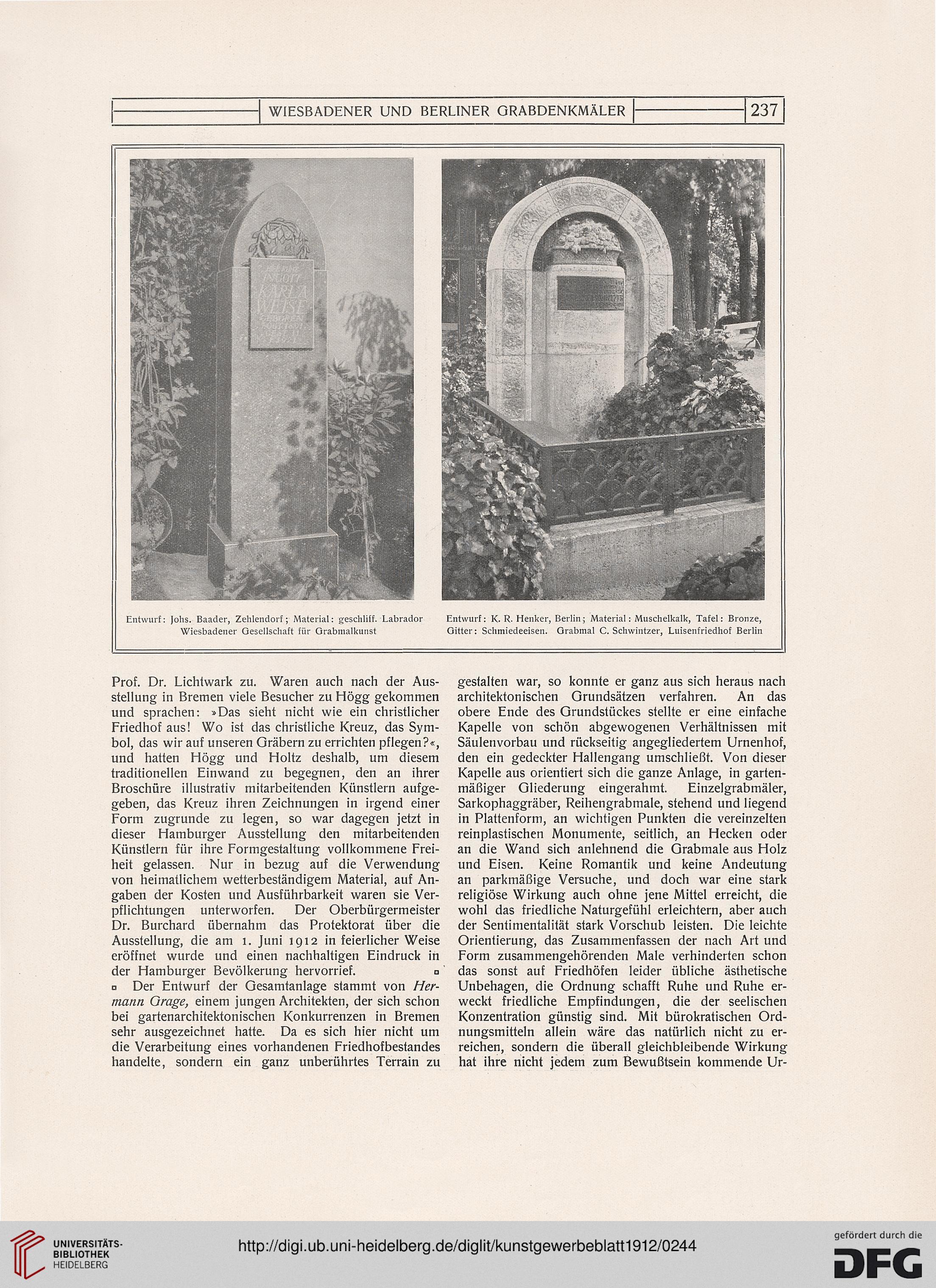WIESBADENER UND BERLINER GRABDENKMÄLER
237
Entwurf: Johs. Baader, Zehlendorf; Material: geschliff. Labrador Entwurf: K. R. Henker, Berlin$ Material: Muschelkalk, Tafel: Bronze,
Wiesbadener Gesellschaft für Grabmalkunst Gitter: Schmiedeeisen. Grabmal C. Schwintzer, Luisenfriedhof Berlin
Prof. Dr. Lichtwark zu. Waren auch nach der Aus-
stellung in Bremen viele Besucher zu Högg gekommen
und sprachen: »Das sieht nicht wie ein christlicher
Friedhof aus! Wo ist das christliche Kreuz, das Sym-
bol, das wir auf unseren Gräbern zu errichten pflegen?«,
und hatten Högg und Holtz deshalb, um diesem
traditionellen Einwand zu begegnen, den an ihrer
Broschüre illustrativ mitarbeitenden Künstlern aufge-
geben, das Kreuz ihren Zeichnungen in irgend einer
Form zugrunde zu legen, so war dagegen jetzt in
dieser Hamburger Ausstellung den mitarbeitenden
Künstlern für ihre Formgestaltung vollkommene Frei-
heit gelassen. Nur in bezug auf die Verwendung
von heimatlichem wetterbeständigem Material, auf An-
gaben der Kosten und Ausführbarkeit waren sie Ver-
pflichtungen unterworfen. Der Oberbürgermeister
Dr. Burchard übernahm das Protektorat über die
Ausstellung, die am 1. Juni 1912 in feierlicher Weise
eröffnet wurde und einen nachhaltigen Eindruck in
der Hamburger Bevölkerung hervorrief. □
□ Der Entwurf der Gesamtanlage stammt von Her-
mann Grage, einem jungen Architekten, der sich schon
bei gartenarchitektonischen Konkurrenzen in Bremen
sehr ausgezeichnet hatte. Da es sich hier nicht um
die Verarbeitung eines vorhandenen Friedhofbestandes
handelte, sondern ein ganz unberührtes Terrain zu
gestalten war, so konnte er ganz aus sich heraus nach
architektonischen Grundsätzen verfahren. An das
obere Ende des Grundstückes stellte er eine einfache
Kapelle von schön abgewogenen Verhältnissen mit
Säulenvorbau und rückseitig angegliedertem Urnenhof,
den ein gedeckter Hallengang umschließt. Von dieser
Kapelle aus orientiert sich die ganze Anlage, in garten-
mäßiger Gliederung eingerahmt. Einzelgrabmäler,
Sarkophaggräber, Reihengrabmale, stehend und liegend
in Plattenform, an wichtigen Punkten die vereinzelten
reinplastischen Monumente, seitlich, an Hecken oder
an die Wand sich anlehnend die Grabmale aus Holz
und Eisen. Keine Romantik und keine Andeutung
an parkmäßige Versuche, und doch war eine stark
religiöse Wirkung auch ohne jene Mittel erreicht, die
wohl das friedliche Naturgefühl erleichtern, aber auch
der Sentimentalität stark Vorschub leisten. Die leichte
Orientierung, das Zusammenfassen der nach Art und
Form zusammengehörenden Male verhinderten schon
das sonst auf Friedhöfen leider übliche ästhetische
Unbehagen, die Ordnung schafft Ruhe und Ruhe er-
weckt friedliche Empfindungen, die der seelischen
Konzentration günstig sind. Mit bürokratischen Ord-
nungsmitteln allein wäre das natürlich nicht zu er-
reichen, sondern die überall gleichbleibende Wirkung
hat ihre nicht jedem zum Bewußtsein kommende Ur-
237
Entwurf: Johs. Baader, Zehlendorf; Material: geschliff. Labrador Entwurf: K. R. Henker, Berlin$ Material: Muschelkalk, Tafel: Bronze,
Wiesbadener Gesellschaft für Grabmalkunst Gitter: Schmiedeeisen. Grabmal C. Schwintzer, Luisenfriedhof Berlin
Prof. Dr. Lichtwark zu. Waren auch nach der Aus-
stellung in Bremen viele Besucher zu Högg gekommen
und sprachen: »Das sieht nicht wie ein christlicher
Friedhof aus! Wo ist das christliche Kreuz, das Sym-
bol, das wir auf unseren Gräbern zu errichten pflegen?«,
und hatten Högg und Holtz deshalb, um diesem
traditionellen Einwand zu begegnen, den an ihrer
Broschüre illustrativ mitarbeitenden Künstlern aufge-
geben, das Kreuz ihren Zeichnungen in irgend einer
Form zugrunde zu legen, so war dagegen jetzt in
dieser Hamburger Ausstellung den mitarbeitenden
Künstlern für ihre Formgestaltung vollkommene Frei-
heit gelassen. Nur in bezug auf die Verwendung
von heimatlichem wetterbeständigem Material, auf An-
gaben der Kosten und Ausführbarkeit waren sie Ver-
pflichtungen unterworfen. Der Oberbürgermeister
Dr. Burchard übernahm das Protektorat über die
Ausstellung, die am 1. Juni 1912 in feierlicher Weise
eröffnet wurde und einen nachhaltigen Eindruck in
der Hamburger Bevölkerung hervorrief. □
□ Der Entwurf der Gesamtanlage stammt von Her-
mann Grage, einem jungen Architekten, der sich schon
bei gartenarchitektonischen Konkurrenzen in Bremen
sehr ausgezeichnet hatte. Da es sich hier nicht um
die Verarbeitung eines vorhandenen Friedhofbestandes
handelte, sondern ein ganz unberührtes Terrain zu
gestalten war, so konnte er ganz aus sich heraus nach
architektonischen Grundsätzen verfahren. An das
obere Ende des Grundstückes stellte er eine einfache
Kapelle von schön abgewogenen Verhältnissen mit
Säulenvorbau und rückseitig angegliedertem Urnenhof,
den ein gedeckter Hallengang umschließt. Von dieser
Kapelle aus orientiert sich die ganze Anlage, in garten-
mäßiger Gliederung eingerahmt. Einzelgrabmäler,
Sarkophaggräber, Reihengrabmale, stehend und liegend
in Plattenform, an wichtigen Punkten die vereinzelten
reinplastischen Monumente, seitlich, an Hecken oder
an die Wand sich anlehnend die Grabmale aus Holz
und Eisen. Keine Romantik und keine Andeutung
an parkmäßige Versuche, und doch war eine stark
religiöse Wirkung auch ohne jene Mittel erreicht, die
wohl das friedliche Naturgefühl erleichtern, aber auch
der Sentimentalität stark Vorschub leisten. Die leichte
Orientierung, das Zusammenfassen der nach Art und
Form zusammengehörenden Male verhinderten schon
das sonst auf Friedhöfen leider übliche ästhetische
Unbehagen, die Ordnung schafft Ruhe und Ruhe er-
weckt friedliche Empfindungen, die der seelischen
Konzentration günstig sind. Mit bürokratischen Ord-
nungsmitteln allein wäre das natürlich nicht zu er-
reichen, sondern die überall gleichbleibende Wirkung
hat ihre nicht jedem zum Bewußtsein kommende Ur-